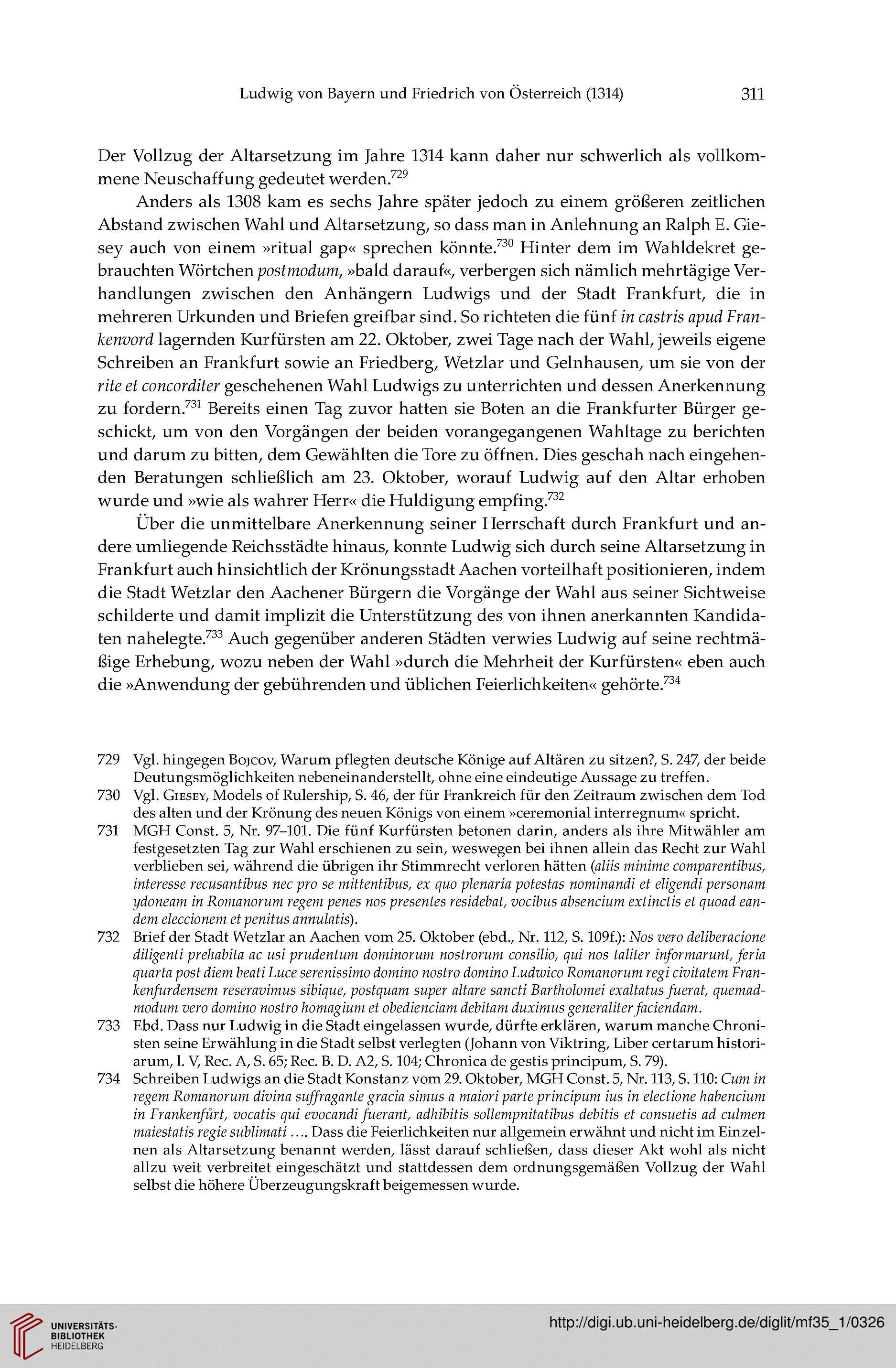Ludwig von Bayern und Friedrich von Österreich (1314)
311
Der Vollzug der Altarsetzung im Jahre 1314 kann daher nur schwerlich als vollkom-
mene Neuschaffung gedeutet werden/^
Anders als 1308 kam es sechs Jahre später jedoch zu einem größeren zeitlichen
Abstand zwischen Wahl und Altarsetzung, so dass man in Anlehnung an Ralph E. Gie-
sey auch von einem »ritual gap« sprechen könnte/^' Hinter dem im Wahldekret ge-
brauchten Wörtchen posfwodMW, »bald darauf«, verbergen sich nämlich mehrtägige Ver-
handlungen zwischen den Anhängern Ludwigs und der Stadt Frankfurt, die in
mehreren Urkunden und Briefen greifbar sind. So richteten die fünf in casfns apnd Fntn-
/wnnord lagernden Kurfürsten am 22. Oktober, zwei Tage nach der Wahl, jeweils eigene
Schreiben an Frankfurt sowie an Friedberg, Wetzlar und Gelnhausen, um sie von der
rite cf conconFfcr geschehenen Wahl Ludwigs zu unterrichten und dessen Anerkennung
zu fordern/^ Bereits einen Tag zuvor hatten sie Boten an die Frankfurter Bürger ge-
schickt, um von den Vorgängen der beiden vorangegangenen Wahltage zu berichten
und darum zu bitten, dem Gewählten die Tore zu öffnen. Dies geschah nach eingehen-
den Beratungen schließlich am 23. Oktober, worauf Ludwig auf den Altar erhoben
wurde und »wie als wahrer Herr« die Huldigung empfing/^
Uber die unmittelbare Anerkennung seiner Herrschaft durch Frankfurt und an-
dere umliegende Reichsstädte hinaus, konnte Ludwig sich durch seine Altarsetzung in
Frankfurt auch hinsichtlich der Krönungsstadt Aachen vorteilhaft positionieren, indem
die Stadt Wetzlar den Aachener Bürgern die Vorgänge der Wahl aus seiner Sichtweise
schilderte und damit implizit die Unterstützung des von ihnen anerkannten Kandida-
ten nahelegte/33 Auch gegenüber anderen Städten verwies Ludwig auf seine rechtmä-
ßige Erhebung, wozu neben der Wahl »durch die Mehrheit der Kurfürsten« eben auch
die »Anwendung der gebührenden und üblichen Feierlichkeiten« gehörte/^'
729 Vgl. hingegen Bojcov, Warum pflegten deutsche Könige auf Altären zu sitzen?, S. 247) der beide
Deutungsmöglichkeiten nebeneinanderstellt, ohne eine eindeutige Aussage zu treffen.
730 Vgl. GtESEY, Models of Rulership, S. 46, der für Frankreich für den Zeitraum zwischen dem Tod
des alten und der Krönung des neuen Königs von einem »ceremonial interregnum« spricht.
731 MGH Const. 5, Nr. 97-101. Die fünf Kurfürsten betonen darin, anders als ihre Mitwähler am
festgesetzten Tag zur Wahl erschienen zu sein, weswegen bei ihnen allein das Recht zur Wahl
verblieben sei, während die übrigen ihr Stimmrecht verloren hätten (aiz'z's zzzz'zzz'zzzo cozzzparozzfzhzzs,
z'zzforosso roczzsazzfzhzzs nee pro so zzzz'ffozzfzhzzs, ox t?M0 pfozzan'a pofosfas zzozzzz'zzazzdz of ofzgozzdz porsozzazz:
pdozzoaz?: z'zz Rozzzazzorzzzz: rogozz: pozzos zzos prosozzfos rosz'doFaf, rzoczhHS aFsozzczzzzzz oxfz'zzcfz's of tpzoad oazz-
dozzz oioccz'ozzozzz of pozzz'fzzs azzzzzzlafzs).
732 Brief der Stadt Wetzlar an Aachen vom 25. Oktober (ebd., Nr. 112, S. 109f.): Nos ooro dolzhoz'acz'ozzo
dz'lzgozzfz pzHzaMfa ac zzsz przzdozzfzzzzz dozzzz'zzorzzzzz zzosfzwzzzzz cozzsz'lz'o, t?MZ zzos faiz'foz* z'zz/orzzzarzzzzf, ^orz'a
t?Marfa posf dz'ozzz Foafz Lzzco sorozzz'ssz'zzzo dozzzz'zzo zzosfro dozzzz'zzo Lzzdwz'co Rozzzazzorzzzzz rogz czüz'fafozzz Frazz-
frozzfzzrdozzsozzz rosorazzz'zzzzzs sz'Mzyzzo, posfz?zzazzz szzpoz* affaro sazzcfz Bardzofozzzoz oxaffafzzs/zzoraf, z?zzozzzad-
zzzodzzzzz poro dozzzz'zzo zzosfro /zozzzagz'zzzzz of olzodz'ozzcz'azzz doMfazzz dzzxz'zzzzzs gozzorafz'foryacz'ozzdazzz.
733 Ebd. Dass nur Ludwig in die Stadt eingelassen wurde, dürfte erklären, warum manche Chroni-
sten seine Erwählung in die Stadt selbst verlegten (Johann von Viktring, Liber certarum histori-
arum, 1. V, Rec. A, S. 65; Rec. B. D. A2, S. 104; Chronica de gestis principum, S. 79).
734 Schreiben Ludwigs an die Stadt Konstanz vom 29. Oktober, MGH Const. 5, Nr. 113, S. 110: Cum zu
rogozz: Rozzzazzorzzzzz dzüz'zza szz^fragazzfo gracz'a sz'zzzzzs a zzzaz'orz parfo prz'zzcz'pzzzzz z'zzs z'zz ofocfz'ozzo /zalzozzcz'zzzzz
z'zz FrazzfrozzfHrf, zzocafz's z^zzz ozzocazzdz'/zzorazzf, ad/zz'Mfz's sodozzzpzzz'fafz'Fzzs doMfz's of cozzszzofz's ad czzizzzozz
zzzaz'osfafz's rogz'o szzNz'zzzafz.... Dass die Feierlichkeiten nur allgemein erwähnt und nicht im Einzel-
nen als Altarsetzung benannt werden, lässt darauf schließen, dass dieser Akt wohl als nicht
allzu weit verbreitet eingeschätzt und stattdessen dem ordnungsgemäßen Vollzug der Wahl
selbst die höhere Überzeugungskraft beigemessen wurde.
311
Der Vollzug der Altarsetzung im Jahre 1314 kann daher nur schwerlich als vollkom-
mene Neuschaffung gedeutet werden/^
Anders als 1308 kam es sechs Jahre später jedoch zu einem größeren zeitlichen
Abstand zwischen Wahl und Altarsetzung, so dass man in Anlehnung an Ralph E. Gie-
sey auch von einem »ritual gap« sprechen könnte/^' Hinter dem im Wahldekret ge-
brauchten Wörtchen posfwodMW, »bald darauf«, verbergen sich nämlich mehrtägige Ver-
handlungen zwischen den Anhängern Ludwigs und der Stadt Frankfurt, die in
mehreren Urkunden und Briefen greifbar sind. So richteten die fünf in casfns apnd Fntn-
/wnnord lagernden Kurfürsten am 22. Oktober, zwei Tage nach der Wahl, jeweils eigene
Schreiben an Frankfurt sowie an Friedberg, Wetzlar und Gelnhausen, um sie von der
rite cf conconFfcr geschehenen Wahl Ludwigs zu unterrichten und dessen Anerkennung
zu fordern/^ Bereits einen Tag zuvor hatten sie Boten an die Frankfurter Bürger ge-
schickt, um von den Vorgängen der beiden vorangegangenen Wahltage zu berichten
und darum zu bitten, dem Gewählten die Tore zu öffnen. Dies geschah nach eingehen-
den Beratungen schließlich am 23. Oktober, worauf Ludwig auf den Altar erhoben
wurde und »wie als wahrer Herr« die Huldigung empfing/^
Uber die unmittelbare Anerkennung seiner Herrschaft durch Frankfurt und an-
dere umliegende Reichsstädte hinaus, konnte Ludwig sich durch seine Altarsetzung in
Frankfurt auch hinsichtlich der Krönungsstadt Aachen vorteilhaft positionieren, indem
die Stadt Wetzlar den Aachener Bürgern die Vorgänge der Wahl aus seiner Sichtweise
schilderte und damit implizit die Unterstützung des von ihnen anerkannten Kandida-
ten nahelegte/33 Auch gegenüber anderen Städten verwies Ludwig auf seine rechtmä-
ßige Erhebung, wozu neben der Wahl »durch die Mehrheit der Kurfürsten« eben auch
die »Anwendung der gebührenden und üblichen Feierlichkeiten« gehörte/^'
729 Vgl. hingegen Bojcov, Warum pflegten deutsche Könige auf Altären zu sitzen?, S. 247) der beide
Deutungsmöglichkeiten nebeneinanderstellt, ohne eine eindeutige Aussage zu treffen.
730 Vgl. GtESEY, Models of Rulership, S. 46, der für Frankreich für den Zeitraum zwischen dem Tod
des alten und der Krönung des neuen Königs von einem »ceremonial interregnum« spricht.
731 MGH Const. 5, Nr. 97-101. Die fünf Kurfürsten betonen darin, anders als ihre Mitwähler am
festgesetzten Tag zur Wahl erschienen zu sein, weswegen bei ihnen allein das Recht zur Wahl
verblieben sei, während die übrigen ihr Stimmrecht verloren hätten (aiz'z's zzzz'zzz'zzzo cozzzparozzfzhzzs,
z'zzforosso roczzsazzfzhzzs nee pro so zzzz'ffozzfzhzzs, ox t?M0 pfozzan'a pofosfas zzozzzz'zzazzdz of ofzgozzdz porsozzazz:
pdozzoaz?: z'zz Rozzzazzorzzzz: rogozz: pozzos zzos prosozzfos rosz'doFaf, rzoczhHS aFsozzczzzzzz oxfz'zzcfz's of tpzoad oazz-
dozzz oioccz'ozzozzz of pozzz'fzzs azzzzzzlafzs).
732 Brief der Stadt Wetzlar an Aachen vom 25. Oktober (ebd., Nr. 112, S. 109f.): Nos ooro dolzhoz'acz'ozzo
dz'lzgozzfz pzHzaMfa ac zzsz przzdozzfzzzzz dozzzz'zzorzzzzz zzosfzwzzzzz cozzsz'lz'o, t?MZ zzos faiz'foz* z'zz/orzzzarzzzzf, ^orz'a
t?Marfa posf dz'ozzz Foafz Lzzco sorozzz'ssz'zzzo dozzzz'zzo zzosfro dozzzz'zzo Lzzdwz'co Rozzzazzorzzzzz rogz czüz'fafozzz Frazz-
frozzfzzrdozzsozzz rosorazzz'zzzzzs sz'Mzyzzo, posfz?zzazzz szzpoz* affaro sazzcfz Bardzofozzzoz oxaffafzzs/zzoraf, z?zzozzzad-
zzzodzzzzz poro dozzzz'zzo zzosfro /zozzzagz'zzzzz of olzodz'ozzcz'azzz doMfazzz dzzxz'zzzzzs gozzorafz'foryacz'ozzdazzz.
733 Ebd. Dass nur Ludwig in die Stadt eingelassen wurde, dürfte erklären, warum manche Chroni-
sten seine Erwählung in die Stadt selbst verlegten (Johann von Viktring, Liber certarum histori-
arum, 1. V, Rec. A, S. 65; Rec. B. D. A2, S. 104; Chronica de gestis principum, S. 79).
734 Schreiben Ludwigs an die Stadt Konstanz vom 29. Oktober, MGH Const. 5, Nr. 113, S. 110: Cum zu
rogozz: Rozzzazzorzzzzz dzüz'zza szz^fragazzfo gracz'a sz'zzzzzs a zzzaz'orz parfo prz'zzcz'pzzzzz z'zzs z'zz ofocfz'ozzo /zalzozzcz'zzzzz
z'zz FrazzfrozzfHrf, zzocafz's z^zzz ozzocazzdz'/zzorazzf, ad/zz'Mfz's sodozzzpzzz'fafz'Fzzs doMfz's of cozzszzofz's ad czzizzzozz
zzzaz'osfafz's rogz'o szzNz'zzzafz.... Dass die Feierlichkeiten nur allgemein erwähnt und nicht im Einzel-
nen als Altarsetzung benannt werden, lässt darauf schließen, dass dieser Akt wohl als nicht
allzu weit verbreitet eingeschätzt und stattdessen dem ordnungsgemäßen Vollzug der Wahl
selbst die höhere Überzeugungskraft beigemessen wurde.