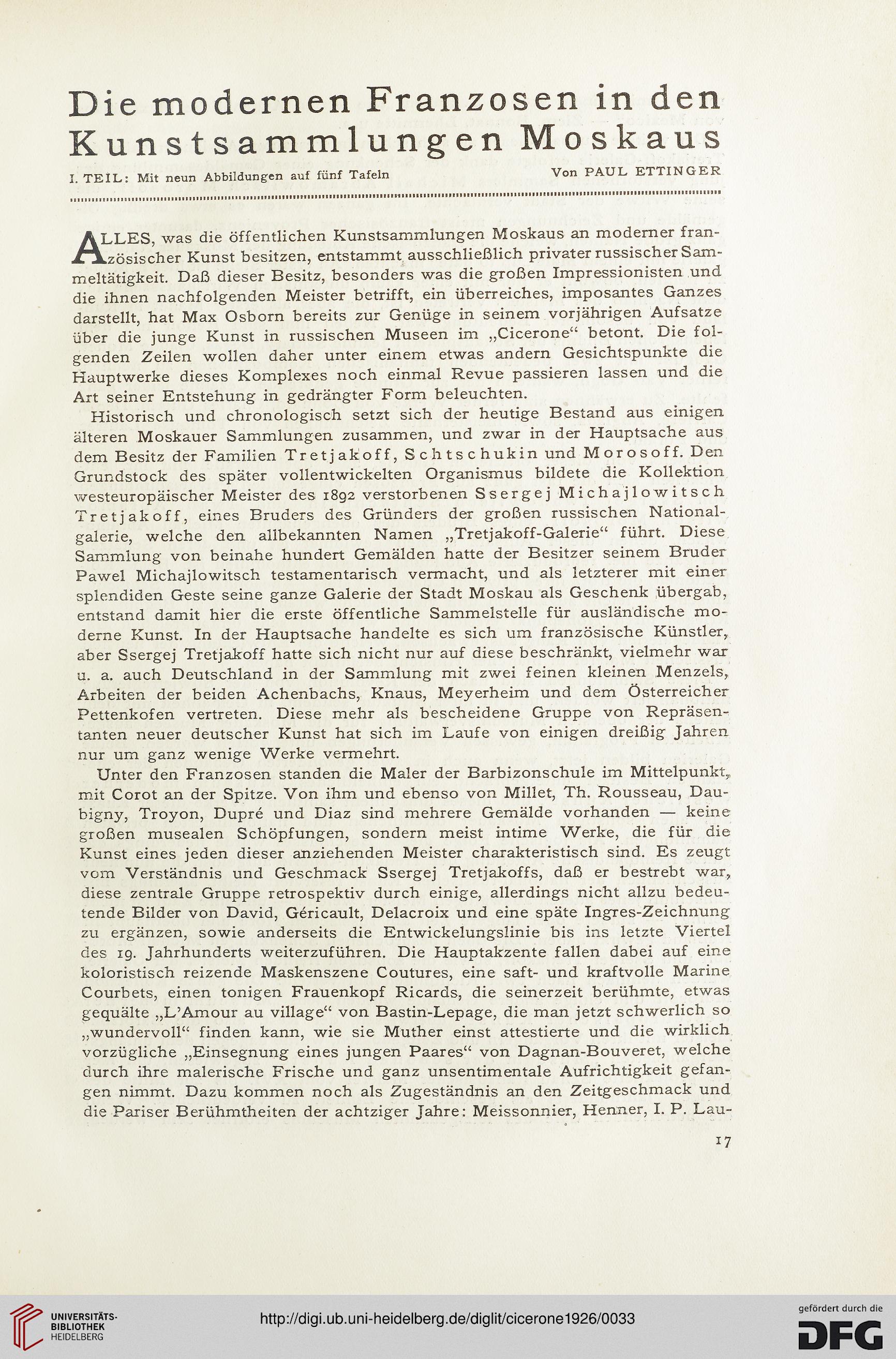Die modernen Franzosen in den
Kunstsammlungen Moskaus
I. TEIL: Mit neun Abbildungen auf fünf Tafeln Von PAUL ETTING ER
ALLES, was die öffentlichen Kunstsammlungen Moskaus an moderner fran-
Lzösischer Kunst besitzen, entstammt ausschließlich privater russischer Sam-
meltätigkeit. Daß dieser Besitz, besonders was die großen Impressionisten und
die ihnen nachfolgenden Meister betrifft, ein überreiches, imposantes Ganzes
darstellt, hat Max Osborn bereits zur Genüge in seinem vorjährigen Aufsatze
über die junge Kunst in russischen Museen im „Cicerone“ betont. Die fol-
genden Zeilen wollen daher unter einem etwas andern Gesichtspunkte die
Hauptwerke dieses Komplexes noch einmal Revue passieren lassen und die
Art seiner Entstehung in gedrängter Form beleuchten.
Historisch und chronologisch setzt sich der heutige Bestand aus einigen
älteren Moskauer Sammlungen zusammen, und zwar in der Hauptsache aus
dem Besitz der Familien Tretjakoff, Schtschukin und Morosoff. Den
Grundstock des später vollentwickelten Organismus bildete die Kollektion
westeuropäischer Meister des 1892 verstorbenen Ssergej Michajlowitsch
Tretjakoff, eines Bruders des Gründete der großen russischen National-
galerie, welche den allbekannten Namen „Tretjakoff-Galerie“ führt. Diese
Sammlung von beinahe hundert Gemälden hatte der Besitzer seinem Bruder
Pawel Michajlowitsch testamentarisch vermacht, und als letzterer mit einer
splendiden Geste seine ganze Galerie der Stadt Moskau als Geschenk übergab,
entstand damit hier die erste öffentliche Sammelstelle für ausländische mo-
derne Kunst. In der Hauptsache handelte es sich um französische Künstler,
aber Ssergej Tretjakoff hatte sich nicht nur auf diese beschränkt, vielmehr war
u. a. auch Deutschland in der Sammlung mit zwei feinen kleinen Menzels,
Arbeiten der beiden Achenbachs, Knaus, Meyerheim und dem Österreicher
Pettenkofen vertreten. Diese mehr als bescheidene Gruppe von Repräsen-
tanten neuer deutscher Kunst hat sich im Laufe von einigen dreißig Jahren
nur um ganz wenige Werke vermehrt.
Unter den Franzosen standen die Maler der Barbizonschule im Mittelpunkt,,
mit Corot an der Spitze. Von ihm und ebenso von Millet, Th. Rousseau, Dau-
bigny, Troyon, Dupre und Diaz sind mehrere Gemälde vorhanden — keine
großen musealen Schöpfungen, sondern meist intime Werke, die für die
Kunst eines jeden dieser anziehenden Meister charakteristisch sind. Es zeugt
vom Verständnis und Geschmack Ssergej Tretjakoffs, daß er bestrebt war,
diese zentrale Gruppe retrospektiv durch einige, allerdings nicht allzu bedeu-
tende Bilder von David, Gericault, Delacroix und eine späte Ingres-Zeichnung
zu ergänzen, sowie anderseits die Entwickelungslinie bis ins letzte Viertel
des ig. Jahrhunderts weiterzuführen. Die Hauptakzente fallen dabei auf eine
koloristisch reizende Maskenszene Coutures, eine saft- und kraftvolle Marine
Courbets, einen tonigen Frauenkopf Ricards, die seinerzeit berühmte, etwas
gequälte „L’Amour au village“ von Bastin-Lepage, die man jetzt schwerlich so
„wundervoll“ finden kann, wie sie Muther einst attestierte und die wirklich
vorzügliche „Einsegnung eines jungen Paares“ von Dagnan-Bouveret, welche
durch ihre malerische Frische und ganz unsentimentale Aufrichtigkeit gefan-
gen nimmt. Dazu kommen noch als Zugeständnis an den Zeitgeschmack und
die Pariser Berühmtheiten der achtziger Jahre: Meissonnier, Henner, I. P. Lau-
17
Kunstsammlungen Moskaus
I. TEIL: Mit neun Abbildungen auf fünf Tafeln Von PAUL ETTING ER
ALLES, was die öffentlichen Kunstsammlungen Moskaus an moderner fran-
Lzösischer Kunst besitzen, entstammt ausschließlich privater russischer Sam-
meltätigkeit. Daß dieser Besitz, besonders was die großen Impressionisten und
die ihnen nachfolgenden Meister betrifft, ein überreiches, imposantes Ganzes
darstellt, hat Max Osborn bereits zur Genüge in seinem vorjährigen Aufsatze
über die junge Kunst in russischen Museen im „Cicerone“ betont. Die fol-
genden Zeilen wollen daher unter einem etwas andern Gesichtspunkte die
Hauptwerke dieses Komplexes noch einmal Revue passieren lassen und die
Art seiner Entstehung in gedrängter Form beleuchten.
Historisch und chronologisch setzt sich der heutige Bestand aus einigen
älteren Moskauer Sammlungen zusammen, und zwar in der Hauptsache aus
dem Besitz der Familien Tretjakoff, Schtschukin und Morosoff. Den
Grundstock des später vollentwickelten Organismus bildete die Kollektion
westeuropäischer Meister des 1892 verstorbenen Ssergej Michajlowitsch
Tretjakoff, eines Bruders des Gründete der großen russischen National-
galerie, welche den allbekannten Namen „Tretjakoff-Galerie“ führt. Diese
Sammlung von beinahe hundert Gemälden hatte der Besitzer seinem Bruder
Pawel Michajlowitsch testamentarisch vermacht, und als letzterer mit einer
splendiden Geste seine ganze Galerie der Stadt Moskau als Geschenk übergab,
entstand damit hier die erste öffentliche Sammelstelle für ausländische mo-
derne Kunst. In der Hauptsache handelte es sich um französische Künstler,
aber Ssergej Tretjakoff hatte sich nicht nur auf diese beschränkt, vielmehr war
u. a. auch Deutschland in der Sammlung mit zwei feinen kleinen Menzels,
Arbeiten der beiden Achenbachs, Knaus, Meyerheim und dem Österreicher
Pettenkofen vertreten. Diese mehr als bescheidene Gruppe von Repräsen-
tanten neuer deutscher Kunst hat sich im Laufe von einigen dreißig Jahren
nur um ganz wenige Werke vermehrt.
Unter den Franzosen standen die Maler der Barbizonschule im Mittelpunkt,,
mit Corot an der Spitze. Von ihm und ebenso von Millet, Th. Rousseau, Dau-
bigny, Troyon, Dupre und Diaz sind mehrere Gemälde vorhanden — keine
großen musealen Schöpfungen, sondern meist intime Werke, die für die
Kunst eines jeden dieser anziehenden Meister charakteristisch sind. Es zeugt
vom Verständnis und Geschmack Ssergej Tretjakoffs, daß er bestrebt war,
diese zentrale Gruppe retrospektiv durch einige, allerdings nicht allzu bedeu-
tende Bilder von David, Gericault, Delacroix und eine späte Ingres-Zeichnung
zu ergänzen, sowie anderseits die Entwickelungslinie bis ins letzte Viertel
des ig. Jahrhunderts weiterzuführen. Die Hauptakzente fallen dabei auf eine
koloristisch reizende Maskenszene Coutures, eine saft- und kraftvolle Marine
Courbets, einen tonigen Frauenkopf Ricards, die seinerzeit berühmte, etwas
gequälte „L’Amour au village“ von Bastin-Lepage, die man jetzt schwerlich so
„wundervoll“ finden kann, wie sie Muther einst attestierte und die wirklich
vorzügliche „Einsegnung eines jungen Paares“ von Dagnan-Bouveret, welche
durch ihre malerische Frische und ganz unsentimentale Aufrichtigkeit gefan-
gen nimmt. Dazu kommen noch als Zugeständnis an den Zeitgeschmack und
die Pariser Berühmtheiten der achtziger Jahre: Meissonnier, Henner, I. P. Lau-
17