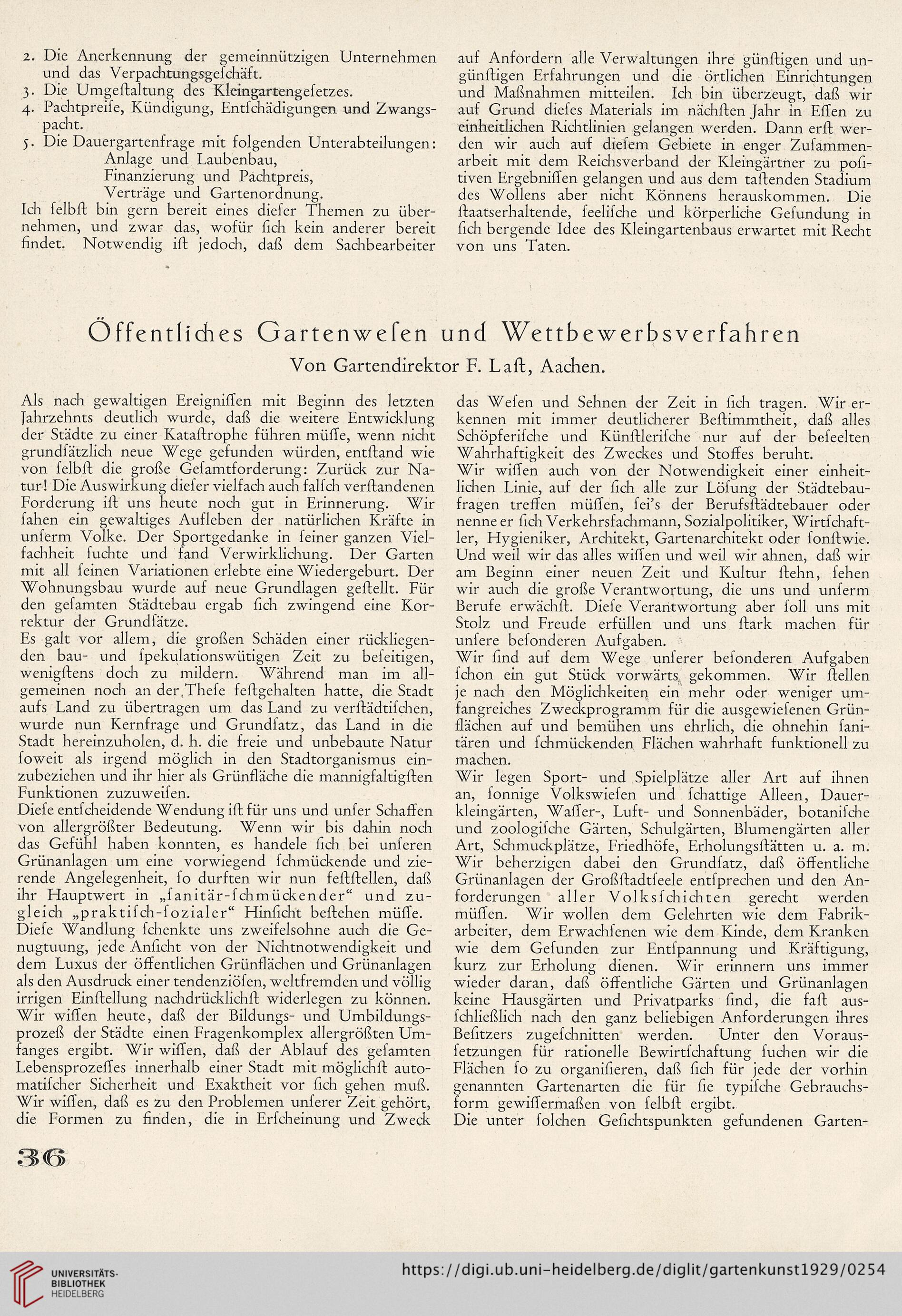2. Die Anerkennung der gemeinnützigen Unternehmen
und das Verpachtungsgelchäft.
3. Die Umgestaltung des Kleingartengesetzes.
4. Pachtpreise, Kündigung, Entschädigungen und Zwangs-
pacht.
5. Die Dauergartenfrage mit folgenden Unterabteilungen:
Anlage und Laubenbau,
Finanzierung und Pachtpreis,
Verträge und Gartenordnung.
Ich selbst bin gern bereit eines dieser Themen zu über-
nehmen, und zwar das, wofür sielt kein anderer bereit
findet. Notwendig ist jedoch, daß dem Sachbearbeiter
auf Anfordern alle Verwaltungen ihre günstigen und un-
günstigen Erfahrungen und die örtlichen Einrichtungen
und Maßnahmen mitteilen. Ich bin überzeugt, daß wir
auf Grund dieses Materials im nächslen Jahr in Elsen zu
einheitlichen Richtlinien gelangen werden. Dann ersl wer-
den wir auch auf diesem Gebiete in enger Zusammen-
arbeit mit dem Reichsverband der Kleingärtner zu posi-
tiven Ergebnissen gelangen und aus dem tastenden Stadium
des Wollens aber nicht Könnens herauskommen. Die
staatserhaltende, seelische und körperliche Gesundung in
sich bergende Idee des Kleingartenbaus erwartet mit Recht
von uns Taten.
Öffentliches Gartenwesen und Wettbewerbsverfahren
Von Gartendirektor F. Last, Aachen.
Als nach gewaltigen Ereignisfen mit Beginn des letzten
Jahrzehnts deutlich wurde, daß die weitere Entwicklung
der Städte zu einer Katastrophe führen müsse, wenn nicht
grundsätzlich neue Wege gefunden würden, entstand wie
von selbst die große Gesamtforderung: Zurück zur Na-
tur! Die Auswirkung dieser vielfach auch falsch verstandenen
Forderung ist uns heute noch gut in Erinnerung. Wir
sahen ein gewaltiges Aufleben der natürlichen Kräfte in
unserm Volke. Der Sportgedanke in seiner ganzen Viel-
fachheit suchte und fand Verwirklichung. Der Garten
mit all seinen Variationen erlebte eine Wiedergeburt. Der
Wohnungsbau wurde auf neue Grundlagen gestellt. Für
den gesamten Städtebau ergab sich zwingend eine Kor-
rektur der Grundsätze.
Es galt vor allem, die großen Schäden einer rückliegen-
den bau- und spekulationswütigen Zeit zu beseitigen,
wenigstens doch zu mildern. Während man im all-
gemeinen noch an der.These festgehalten hatte, die Stadt
aufs Land zu übertragen um das Land zu verstädtischen,
wurde nun Kernfrage und Grundsatz, das Land in die
Stadt hereinzuholen, d. h. die freie und unbebaute Natur
soweit als irgend möglich in den Stadtorganismus ein-
zubeziehen und ihr hier als Grünfläche die mannigfaltigsten
Funktionen zuzuweisen.
Diese entseheidende Wendung ist für uns und unser Schaffen
von allergrößter Bedeutung. Wenn wir bis dahin noch
das Gefühl haben konnten, es handele sich bei unseren
Grünanlagen um eine vorwiegend schmückende und zie-
rende Angelegenheit, so durften wir nun feststellen, daß
ihr Hauptwert in „sanitär-schmückender“ und zu-
gleich „praktisch-sozialer“ Hinsicht bestehen mülle.
Diese Wandlung schenkte uns zweifelsohne auch die Ge-
nugtuung, jede Ansicht von der Nichtnotwendigkeit und
dem Luxus der öffentlichen Grünflächen und Grünanlagen
als den Ausdruck einer tendenziösen, weltfremden und völlig
irrigen Einstellung nachdrücklichst widerlegen zu können.
Wir willen heute, daß der Bildungs- und Umbildungs-
prozeß der Städte einen Fragenkomplex allergrößten Um-
fanges ergibt. Wir willen, daß der Ablauf des gesamten
Lebensprozesses innerhalb einer Stadt mit möglichst auto-
matischer Sicherheit und Exaktheit vor sich gehen muß.
Wir willen, daß es zu den Problemen unserer Zeit gehört,
die Formen zu finden, die in Erscheinung und Zweck
das Wesen und Sehnen der Zeit in sich tragen. Wir er-
kennen mit immer deutlicherer Bestimmtheit, daß alles
Schöpferische und Künstlerische nur auf der beseelten
Wahrhaftigkeit des Zweckes und Stoffes beruht.
Wir willen auch von der Notwendigkeit einer einheit-
lichen Linie, auf der sich alle zur Lösung der Städtebau-
fragen treffen müssen, sei’s der Berufsstädtebauer oder
nenne er sich Verkehrsfachmann, Sozialpolitiker, Wirtschaft-
ler, Hygieniker, Architekt, Gartenarchitekt oder sonstwie.
Und weil wir das alles willen und weil wir ahnen, daß wir
am Beginn einer neuen Zeit und Kultur stehn, sehen
wir auch die große Verantwortung, die uns und unserm
Berufe erwächst. Diese Verantwortung aber soll uns mit
Stolz und Freude erfüllen und uns stark machen für
unsere besonderen Aufgaben.
Wir sind auf dem Wege unserer besonderen Aufgaben
schon ein gut Stück vorwärts, gekommen. Wir stellen
je nach den Möglichkeiten ein mehr oder weniger um-
fangreiches Zweckprogramm für die ausgewiesenen Grün-
flächen auf und bemühen uns ehrlich, die ohnehin sani-
tären und schmückenden Flächen wahrhaft funktionell zu
machen.
Wir legen Sport- und Spielplätze aller Art auf ihnen
an, sonnige Volkswiesen und schattige Alleen, Dauer-
kleingärten, Waller-, Luft- und Sonnenbäder, botanische
und zoologische Gärten, Schulgärten, Blumengärten aller
Art, Schmuckplätze, Friedhöfe, Erholungsstätten u. a. m.
Wir beherzigen dabei den Grundsatz, daß öffentliche
Grünanlagen der Großstadtseele entsprechen und den An-
forderungen aller Volksschichten gerecht werden
müssen. Wir wollen dem Gelehrten wie dem Fabrik-
arbeiter, dem Erwachsenen wie dem Kinde, dem Kranken
wie dem Gesunden zur Entspannung und Kräftigung,
kurz zur Erholung dienen. Wir erinnern uns immer
wieder daran, daß öffentliche Gärten und Grünanlagen
keine Hausgärten und Privatparks sind, die fall: aus-
schließlich nach den ganz beliebigen Anforderungen ihres
Besitzers zugeschnitten werden. Unter den Voraus-
setzungen für rationelle Bewirtschaftung suchen wir die
Flächen so zu organisieren, daß sich für jede der vorhin
genannten Gartenarten die für sie typische Gebrauchs-
form gewissermaßen von selbst ergibt.
Die unter solchen Gesichtspunkten gefundenen Garten-
und das Verpachtungsgelchäft.
3. Die Umgestaltung des Kleingartengesetzes.
4. Pachtpreise, Kündigung, Entschädigungen und Zwangs-
pacht.
5. Die Dauergartenfrage mit folgenden Unterabteilungen:
Anlage und Laubenbau,
Finanzierung und Pachtpreis,
Verträge und Gartenordnung.
Ich selbst bin gern bereit eines dieser Themen zu über-
nehmen, und zwar das, wofür sielt kein anderer bereit
findet. Notwendig ist jedoch, daß dem Sachbearbeiter
auf Anfordern alle Verwaltungen ihre günstigen und un-
günstigen Erfahrungen und die örtlichen Einrichtungen
und Maßnahmen mitteilen. Ich bin überzeugt, daß wir
auf Grund dieses Materials im nächslen Jahr in Elsen zu
einheitlichen Richtlinien gelangen werden. Dann ersl wer-
den wir auch auf diesem Gebiete in enger Zusammen-
arbeit mit dem Reichsverband der Kleingärtner zu posi-
tiven Ergebnissen gelangen und aus dem tastenden Stadium
des Wollens aber nicht Könnens herauskommen. Die
staatserhaltende, seelische und körperliche Gesundung in
sich bergende Idee des Kleingartenbaus erwartet mit Recht
von uns Taten.
Öffentliches Gartenwesen und Wettbewerbsverfahren
Von Gartendirektor F. Last, Aachen.
Als nach gewaltigen Ereignisfen mit Beginn des letzten
Jahrzehnts deutlich wurde, daß die weitere Entwicklung
der Städte zu einer Katastrophe führen müsse, wenn nicht
grundsätzlich neue Wege gefunden würden, entstand wie
von selbst die große Gesamtforderung: Zurück zur Na-
tur! Die Auswirkung dieser vielfach auch falsch verstandenen
Forderung ist uns heute noch gut in Erinnerung. Wir
sahen ein gewaltiges Aufleben der natürlichen Kräfte in
unserm Volke. Der Sportgedanke in seiner ganzen Viel-
fachheit suchte und fand Verwirklichung. Der Garten
mit all seinen Variationen erlebte eine Wiedergeburt. Der
Wohnungsbau wurde auf neue Grundlagen gestellt. Für
den gesamten Städtebau ergab sich zwingend eine Kor-
rektur der Grundsätze.
Es galt vor allem, die großen Schäden einer rückliegen-
den bau- und spekulationswütigen Zeit zu beseitigen,
wenigstens doch zu mildern. Während man im all-
gemeinen noch an der.These festgehalten hatte, die Stadt
aufs Land zu übertragen um das Land zu verstädtischen,
wurde nun Kernfrage und Grundsatz, das Land in die
Stadt hereinzuholen, d. h. die freie und unbebaute Natur
soweit als irgend möglich in den Stadtorganismus ein-
zubeziehen und ihr hier als Grünfläche die mannigfaltigsten
Funktionen zuzuweisen.
Diese entseheidende Wendung ist für uns und unser Schaffen
von allergrößter Bedeutung. Wenn wir bis dahin noch
das Gefühl haben konnten, es handele sich bei unseren
Grünanlagen um eine vorwiegend schmückende und zie-
rende Angelegenheit, so durften wir nun feststellen, daß
ihr Hauptwert in „sanitär-schmückender“ und zu-
gleich „praktisch-sozialer“ Hinsicht bestehen mülle.
Diese Wandlung schenkte uns zweifelsohne auch die Ge-
nugtuung, jede Ansicht von der Nichtnotwendigkeit und
dem Luxus der öffentlichen Grünflächen und Grünanlagen
als den Ausdruck einer tendenziösen, weltfremden und völlig
irrigen Einstellung nachdrücklichst widerlegen zu können.
Wir willen heute, daß der Bildungs- und Umbildungs-
prozeß der Städte einen Fragenkomplex allergrößten Um-
fanges ergibt. Wir willen, daß der Ablauf des gesamten
Lebensprozesses innerhalb einer Stadt mit möglichst auto-
matischer Sicherheit und Exaktheit vor sich gehen muß.
Wir willen, daß es zu den Problemen unserer Zeit gehört,
die Formen zu finden, die in Erscheinung und Zweck
das Wesen und Sehnen der Zeit in sich tragen. Wir er-
kennen mit immer deutlicherer Bestimmtheit, daß alles
Schöpferische und Künstlerische nur auf der beseelten
Wahrhaftigkeit des Zweckes und Stoffes beruht.
Wir willen auch von der Notwendigkeit einer einheit-
lichen Linie, auf der sich alle zur Lösung der Städtebau-
fragen treffen müssen, sei’s der Berufsstädtebauer oder
nenne er sich Verkehrsfachmann, Sozialpolitiker, Wirtschaft-
ler, Hygieniker, Architekt, Gartenarchitekt oder sonstwie.
Und weil wir das alles willen und weil wir ahnen, daß wir
am Beginn einer neuen Zeit und Kultur stehn, sehen
wir auch die große Verantwortung, die uns und unserm
Berufe erwächst. Diese Verantwortung aber soll uns mit
Stolz und Freude erfüllen und uns stark machen für
unsere besonderen Aufgaben.
Wir sind auf dem Wege unserer besonderen Aufgaben
schon ein gut Stück vorwärts, gekommen. Wir stellen
je nach den Möglichkeiten ein mehr oder weniger um-
fangreiches Zweckprogramm für die ausgewiesenen Grün-
flächen auf und bemühen uns ehrlich, die ohnehin sani-
tären und schmückenden Flächen wahrhaft funktionell zu
machen.
Wir legen Sport- und Spielplätze aller Art auf ihnen
an, sonnige Volkswiesen und schattige Alleen, Dauer-
kleingärten, Waller-, Luft- und Sonnenbäder, botanische
und zoologische Gärten, Schulgärten, Blumengärten aller
Art, Schmuckplätze, Friedhöfe, Erholungsstätten u. a. m.
Wir beherzigen dabei den Grundsatz, daß öffentliche
Grünanlagen der Großstadtseele entsprechen und den An-
forderungen aller Volksschichten gerecht werden
müssen. Wir wollen dem Gelehrten wie dem Fabrik-
arbeiter, dem Erwachsenen wie dem Kinde, dem Kranken
wie dem Gesunden zur Entspannung und Kräftigung,
kurz zur Erholung dienen. Wir erinnern uns immer
wieder daran, daß öffentliche Gärten und Grünanlagen
keine Hausgärten und Privatparks sind, die fall: aus-
schließlich nach den ganz beliebigen Anforderungen ihres
Besitzers zugeschnitten werden. Unter den Voraus-
setzungen für rationelle Bewirtschaftung suchen wir die
Flächen so zu organisieren, daß sich für jede der vorhin
genannten Gartenarten die für sie typische Gebrauchs-
form gewissermaßen von selbst ergibt.
Die unter solchen Gesichtspunkten gefundenen Garten-