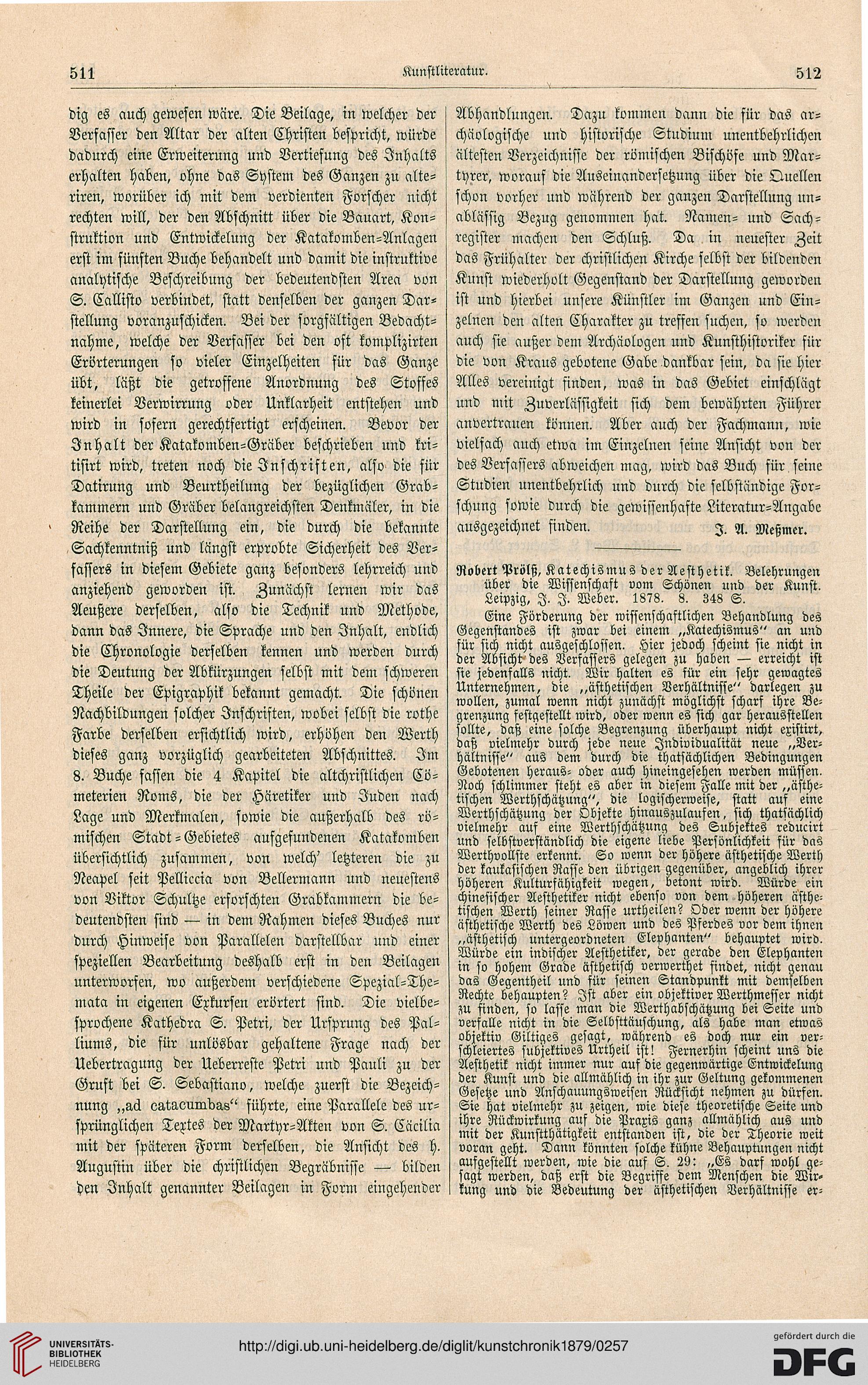511
Kunstliteratur.
512
dig es ciuch gewesen wäre. Die Beilage, in welcher der
Verfasser den Altar der alten Christen bespricht, würde
dadurch eine Erweiterung und Vertiefung des Jnhalts
erhalten haben, ohne das System des Ganzen zu alte-
riren, worüber ich mit dem verdienten Forscher nicht
rechten will, der den Abschnitt über die Bauart, Kon-
strultion und Entwickelung der Katakomben-Anlagen
erst im fünften Buche behandelt und damit die instruktive
analytische Beschreibung der bedeutendsten Area von
S. Callisto verbindet, statt denselben der ganzen Dar-
stellung voranzuschicken. Bei der sorgfältigen Bedacht-
nahme, welche der Verfasser bei den ost komplizirten
Erörterungen so vieler Einzelheiten für das Ganze
übt, läßt die getroffene Anordnung des Stoffes
keinerlei Verwirrung oder Unklarheit entstehen und
wird in sofern gerechtfertigt erscheinen. Bevor der
Jnhalt der Katakomben-Gräber beschrieben und kri-
tisirt wird, treten noch die Jnschriften, also die für
Datirung und Beurtheilung der bezüglichen Grab-
kammern und Gräber belangreichsten Denknäler, in die
Reihe der Darstellung ein, die durch die bekannte
Sachkenntniß und längst erprobte Sicherheit des Ver-
fassers in diesem Gebiete ganz besonders lehrreich und
anziehend geworden ist. Zunächst lernen wir das
Aeußere derselben, also die Technik und Methode,
dann das Jnnere, die Sprache und den Jnhalt, endlich
die Chronologie derselben kennen und werden durch
die Deutung der Abkürzungen selbst mit dem schweren
Theile der Epigraphik bekannt gemacht. Die schönen
Nachbildungen solcher Jnschriften, wobei selbst die rothe
Farbe derselben ersichtlich wird, erhöhen den Werth
dieses ganz vorzüglich gearbeiteten Abschnittes. Jm
8. Buche fassen die 4 Kapitel die altchristlichen Cö-
meterien Roms, die der Häretiker und Juden nach
Lage und Merkmalen, sowie die außerhalb des rö-
mischen Stadt - Gebietes aufgefundenen Katakomben
übersichtlich zusammen, von welch' letzteren die zu
Neapel seit Pelliccia von Bellermann und neuestens
von Viktor Schultze erforschten Grabkammern die be-
deutendsten sind — in dem Rahmen dieses Buches nur
durch Hinweise von Parallelen darstellbar und einer
speziellen Bearbeitung deshalb erst in den Beilagen
unterworfen, wo außerdem verschiedene Spezial-The-
mata in eigenen Exkursen erörtert sind. Die vielbe-
sprochene Kathedra S. Petri, der Ursprung des Pal-
liums, die für unlösbar gehaltene Frage nach der
Uebertragung der Ueberreste Petri und Pauli zu der
Gruft bei S- Sebastiano, welche zuerst die Bezeich-
nung „uä outuoumbas" führte, eine Parallele des ur-
sprünglichen Textes der Martyr-Akten von S. Cäcilia
mit der späteren Form derselben, die Ansicht des h.
Augustin über die christlichen Begräbnisse — bilden
den Jnhalt genannter Beilagen in Form eingehender
Abhandlungen. Dazu kommen dann die für das ar-
chäologische und historische Studium unentbehrlichen
ältesten Verzeichnisse der römischen Bischöfe und Mar-
tyrer, worauf die Auseinandersetzung über die Ouellen
schon vorher und während der ganzen Darstellung nn-
ablässig Bezug genommen hat. Namen- und Sach-
register machen den Schluß. Da in neuester Zeit
das Frühalter der christlichen Kirche selbst der bildcndcn
Kunst wiederholt Gegenstand der Darstellung geworden
ist und hierbei unsere Künstler im Ganzen und Ein-
zelnen den alten Charakter zu treffen suchen, so werdcn
auch sie außer dcm Archäologen und Kunsthistoriker für
die von Kraus gebotene Gabe dankbar sein, da sie hier
Alles vereinigt finden, was in das Gebiet einschlägt
und nnt Zuverlässigkeit sich dem bewährten Führer
anvertrauen können. Aber auch der Fachmann, wie
vielfach auch etwa im Einzelnen seine Ansicht von der
des Versassers abweichcn mag, wird das Buch für seinc
Studien unentbehrlich und durch die selbständige For-
schung sowie durch die gewissenhafte Literatur-Angabe
ausgezeichnet finden. z, N. Meßmer.
Nobert Prölß, Katechismus der Aesthetik. Belehrungen
über die Wissenschaft vom Schönen und der Kunst.
Lsipzig, I. I. Weber. 1878. 8. 348 S.
Eine Förderung der wissenschaftlichen Behandlung des
Gegenstandes ist zwar bei einem „Katechismus" an und
für sich nicht ausgeschlosssn. Hier jedoch scheint sie nicht in
der Absicht des Verfassers gelegen zu haben — erreicht ist
sie jedenfalls nicht. Wir halten es für ein sehr gewagtes
Unternehmen, die „ästhetischsn Verhältnisse" darlegen zu
wollen, zuinal wenn nicht zunächst möglichst scharf ihre Be-
grenzung festgestellt wird, oder wenn es sich gar herausstsllen
sollte, daß eine solche Begrenzung überhaupt nicht existirt,
daß vielmehr durch jede neue Jndividualität neue „Ver-
hältnisss" aus dem durch die thatsächlichen Bedingungen
Gebotenen heraus- oder auch hineingesehen werden müssen.
Noch schlimmer steht es aber in diesem Falle mit der „ästhe-
tischsn Werthschätzung", die logischerweise, statt auf eine
Werthschätzung der Objekte hinauszulaufen, sich thatsächlich
vielmehr auf eine Werthschätzung des Subjektes reducirt
und selbstvsrständlich die eigene liebe Persönlichkeit für das
Werthvollste srkennt. So wenn der höhere ästhetische Werth
der kaukasischen Rasse den übrigen gegenüber, angeblich ihrer
höheren Kulturfähigkeit wegen, betont wird. Würde ein
chinesischer Assthstiker nicht ebenso von dem höheren ästhe-
tischen Werth ssiner Rasse urtheilen? Oder wenn der höhere
ästhetische Werth des Löwen und des Pferdes vor dem ihnen
„ästhetisch untsrgeordnsten Elephanten" behauptet wird.
Würde ein indischer Aesthetiker, dsr gerade den Elephanten
in so hohem Grade ästhetisch verwsrthet findet, nicht genau
das Gegentheil und für seinen Standpunkt mit demselben
Rechte behauptsn? Jst aber ein objektiver Werthmesser nicht
zu finden, so lasse man dis Werthabschätzung bei Seite und
verfalle nicht in dis Selbsttäuschung, als habe man etwas
objektiv Giltiges gesagt, während es doch nur ein ver-
schleiertes subjektives Urtheil ist! Fsrnerhin scheint uns die
Aesthetik nicht immer nur auf die gegenwärtige Entwickslung
der Kunst und die allmählich in ihr zur Geltung gekommenen
Gesetze und Anschauungsweisen Rücksicht nehmen zu dürfen.
Sie hat vislmehr zu zeigen, wie diese theoretische Seite und
ihrs Rückwirkung auf die Praxis ganz allmählich aus und
mit der Kunstthätigkeit entstanden ist, die der Theorie weit
voran geht. Dann könnten solche kühne Behauptungen nicht
aufgestellt werden, wis die auf S. 29: „Es darf wohl ge-
sagt werden, daß erst die Begriffe dem Menschen die Wir-
kung und die Bedeutung der ästhetischen Verhältnisse er-
Kunstliteratur.
512
dig es ciuch gewesen wäre. Die Beilage, in welcher der
Verfasser den Altar der alten Christen bespricht, würde
dadurch eine Erweiterung und Vertiefung des Jnhalts
erhalten haben, ohne das System des Ganzen zu alte-
riren, worüber ich mit dem verdienten Forscher nicht
rechten will, der den Abschnitt über die Bauart, Kon-
strultion und Entwickelung der Katakomben-Anlagen
erst im fünften Buche behandelt und damit die instruktive
analytische Beschreibung der bedeutendsten Area von
S. Callisto verbindet, statt denselben der ganzen Dar-
stellung voranzuschicken. Bei der sorgfältigen Bedacht-
nahme, welche der Verfasser bei den ost komplizirten
Erörterungen so vieler Einzelheiten für das Ganze
übt, läßt die getroffene Anordnung des Stoffes
keinerlei Verwirrung oder Unklarheit entstehen und
wird in sofern gerechtfertigt erscheinen. Bevor der
Jnhalt der Katakomben-Gräber beschrieben und kri-
tisirt wird, treten noch die Jnschriften, also die für
Datirung und Beurtheilung der bezüglichen Grab-
kammern und Gräber belangreichsten Denknäler, in die
Reihe der Darstellung ein, die durch die bekannte
Sachkenntniß und längst erprobte Sicherheit des Ver-
fassers in diesem Gebiete ganz besonders lehrreich und
anziehend geworden ist. Zunächst lernen wir das
Aeußere derselben, also die Technik und Methode,
dann das Jnnere, die Sprache und den Jnhalt, endlich
die Chronologie derselben kennen und werden durch
die Deutung der Abkürzungen selbst mit dem schweren
Theile der Epigraphik bekannt gemacht. Die schönen
Nachbildungen solcher Jnschriften, wobei selbst die rothe
Farbe derselben ersichtlich wird, erhöhen den Werth
dieses ganz vorzüglich gearbeiteten Abschnittes. Jm
8. Buche fassen die 4 Kapitel die altchristlichen Cö-
meterien Roms, die der Häretiker und Juden nach
Lage und Merkmalen, sowie die außerhalb des rö-
mischen Stadt - Gebietes aufgefundenen Katakomben
übersichtlich zusammen, von welch' letzteren die zu
Neapel seit Pelliccia von Bellermann und neuestens
von Viktor Schultze erforschten Grabkammern die be-
deutendsten sind — in dem Rahmen dieses Buches nur
durch Hinweise von Parallelen darstellbar und einer
speziellen Bearbeitung deshalb erst in den Beilagen
unterworfen, wo außerdem verschiedene Spezial-The-
mata in eigenen Exkursen erörtert sind. Die vielbe-
sprochene Kathedra S. Petri, der Ursprung des Pal-
liums, die für unlösbar gehaltene Frage nach der
Uebertragung der Ueberreste Petri und Pauli zu der
Gruft bei S- Sebastiano, welche zuerst die Bezeich-
nung „uä outuoumbas" führte, eine Parallele des ur-
sprünglichen Textes der Martyr-Akten von S. Cäcilia
mit der späteren Form derselben, die Ansicht des h.
Augustin über die christlichen Begräbnisse — bilden
den Jnhalt genannter Beilagen in Form eingehender
Abhandlungen. Dazu kommen dann die für das ar-
chäologische und historische Studium unentbehrlichen
ältesten Verzeichnisse der römischen Bischöfe und Mar-
tyrer, worauf die Auseinandersetzung über die Ouellen
schon vorher und während der ganzen Darstellung nn-
ablässig Bezug genommen hat. Namen- und Sach-
register machen den Schluß. Da in neuester Zeit
das Frühalter der christlichen Kirche selbst der bildcndcn
Kunst wiederholt Gegenstand der Darstellung geworden
ist und hierbei unsere Künstler im Ganzen und Ein-
zelnen den alten Charakter zu treffen suchen, so werdcn
auch sie außer dcm Archäologen und Kunsthistoriker für
die von Kraus gebotene Gabe dankbar sein, da sie hier
Alles vereinigt finden, was in das Gebiet einschlägt
und nnt Zuverlässigkeit sich dem bewährten Führer
anvertrauen können. Aber auch der Fachmann, wie
vielfach auch etwa im Einzelnen seine Ansicht von der
des Versassers abweichcn mag, wird das Buch für seinc
Studien unentbehrlich und durch die selbständige For-
schung sowie durch die gewissenhafte Literatur-Angabe
ausgezeichnet finden. z, N. Meßmer.
Nobert Prölß, Katechismus der Aesthetik. Belehrungen
über die Wissenschaft vom Schönen und der Kunst.
Lsipzig, I. I. Weber. 1878. 8. 348 S.
Eine Förderung der wissenschaftlichen Behandlung des
Gegenstandes ist zwar bei einem „Katechismus" an und
für sich nicht ausgeschlosssn. Hier jedoch scheint sie nicht in
der Absicht des Verfassers gelegen zu haben — erreicht ist
sie jedenfalls nicht. Wir halten es für ein sehr gewagtes
Unternehmen, die „ästhetischsn Verhältnisse" darlegen zu
wollen, zuinal wenn nicht zunächst möglichst scharf ihre Be-
grenzung festgestellt wird, oder wenn es sich gar herausstsllen
sollte, daß eine solche Begrenzung überhaupt nicht existirt,
daß vielmehr durch jede neue Jndividualität neue „Ver-
hältnisss" aus dem durch die thatsächlichen Bedingungen
Gebotenen heraus- oder auch hineingesehen werden müssen.
Noch schlimmer steht es aber in diesem Falle mit der „ästhe-
tischsn Werthschätzung", die logischerweise, statt auf eine
Werthschätzung der Objekte hinauszulaufen, sich thatsächlich
vielmehr auf eine Werthschätzung des Subjektes reducirt
und selbstvsrständlich die eigene liebe Persönlichkeit für das
Werthvollste srkennt. So wenn der höhere ästhetische Werth
der kaukasischen Rasse den übrigen gegenüber, angeblich ihrer
höheren Kulturfähigkeit wegen, betont wird. Würde ein
chinesischer Assthstiker nicht ebenso von dem höheren ästhe-
tischen Werth ssiner Rasse urtheilen? Oder wenn der höhere
ästhetische Werth des Löwen und des Pferdes vor dem ihnen
„ästhetisch untsrgeordnsten Elephanten" behauptet wird.
Würde ein indischer Aesthetiker, dsr gerade den Elephanten
in so hohem Grade ästhetisch verwsrthet findet, nicht genau
das Gegentheil und für seinen Standpunkt mit demselben
Rechte behauptsn? Jst aber ein objektiver Werthmesser nicht
zu finden, so lasse man dis Werthabschätzung bei Seite und
verfalle nicht in dis Selbsttäuschung, als habe man etwas
objektiv Giltiges gesagt, während es doch nur ein ver-
schleiertes subjektives Urtheil ist! Fsrnerhin scheint uns die
Aesthetik nicht immer nur auf die gegenwärtige Entwickslung
der Kunst und die allmählich in ihr zur Geltung gekommenen
Gesetze und Anschauungsweisen Rücksicht nehmen zu dürfen.
Sie hat vislmehr zu zeigen, wie diese theoretische Seite und
ihrs Rückwirkung auf die Praxis ganz allmählich aus und
mit der Kunstthätigkeit entstanden ist, die der Theorie weit
voran geht. Dann könnten solche kühne Behauptungen nicht
aufgestellt werden, wis die auf S. 29: „Es darf wohl ge-
sagt werden, daß erst die Begriffe dem Menschen die Wir-
kung und die Bedeutung der ästhetischen Verhältnisse er-