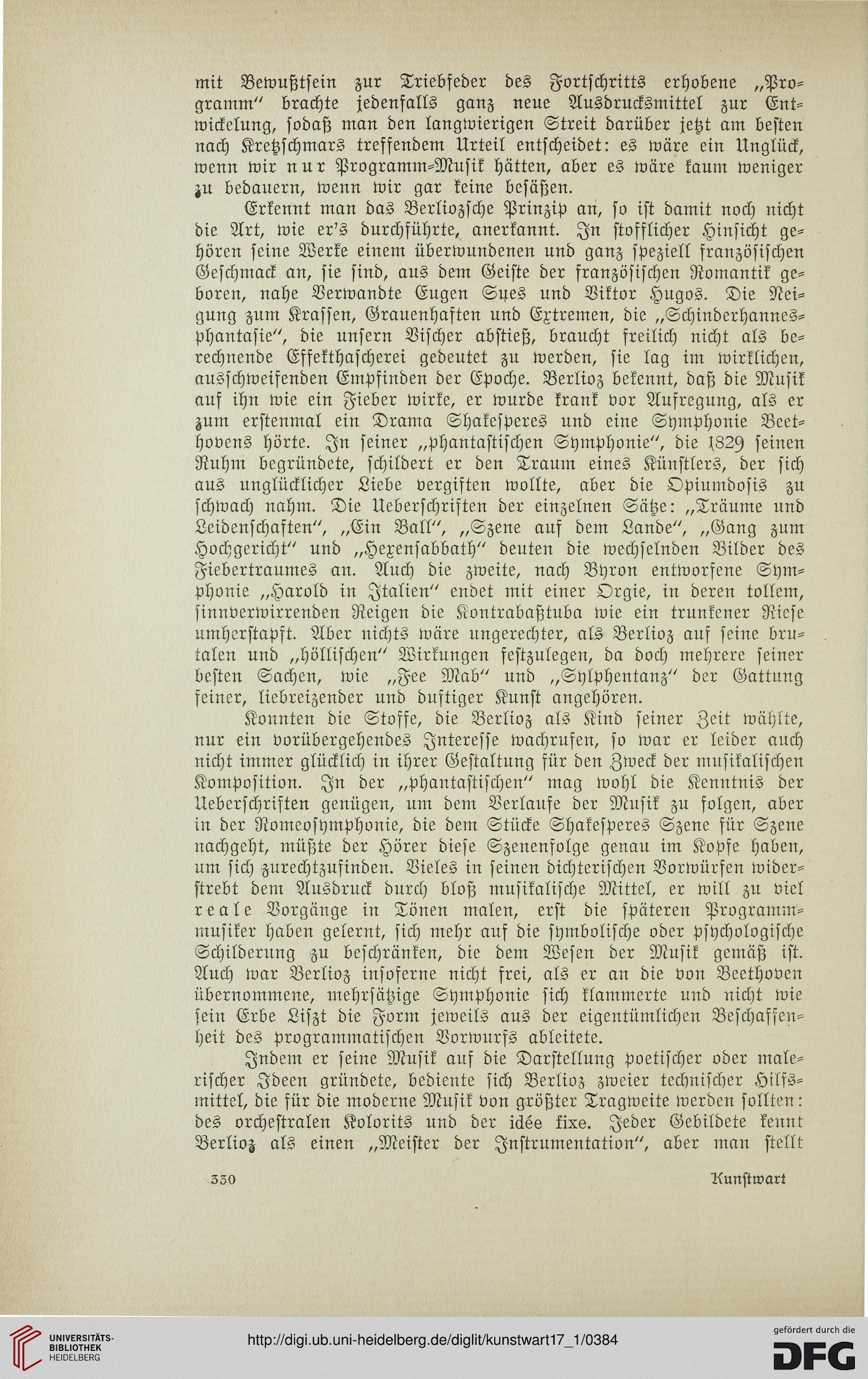mit Bewußtsein zur Triebfeder des Fortschritts erhobene „Pro-
gramm" brachte jedenfalls ganz neue Ausdrucksmittel zur Ent-
wickeluug, sodaß man den langwierigen Streit darüber jetzt am besten
nach Kretzschmars treffendem Urteil entscheidet: es wäre ein Unglück,
wenn wir nur Programm-Musik hätten, aber es wäre kaum weniger
zu bedauern, wenn wir gar keine besäßen.
Erkennt man das Berliozsche Prinzip an, so ist damit noch nicht
die Art, wie er's durchführte, anerkannt. Jn stofflicher Hinsicht ge-
hören seine Werke einem überwundenen und ganz speziell französischen
Geschmack an, sie sind, aus dem Geiste der französischen Romantik ge-
boren, nahe Verwandte Eugen Syes und Viktor Hugos. Die Nei-
gung zum Krassen, Grauenhasten und Extremen, die „Schinderhannes-
phantasie", die unsern Vischer abstieß, braucht freilich nicht als be-
rechnende Efsekthascherei gedeutet zu werden, sie lag im wirklichen,
ausschweisenden Empfinden der Epoche. Berlioz bekennt, daß die Musik
auf ihn wie ein Fieber wirke, er wurde krank vor Aufregung, als er
znm erstenmal ein Drama Shakesperes und eine Symphonie Beet-
hovens hörte. Jn seiner „phantastischen Symphonie", die j829 seinen
Ruhm begründete, schildert er den Tranm eines Künstlers, der sich
aus unglücklicher Liebe vergiften wollte, aber die Opiumdosis zu
schwach nahm. Die Ueberschriften der einzelnen Sätze: „Träume und
Leidenschaften", „Ein Ball", „Szene ans dem Lande", „Gang zum
Hochgericht" nnd „Hexensabbath" denten die wechselnden Bilder des
Fiebertraumes an. Auch die zweite, nach Byron entworfene Sym-
phonie „Harold in Jtalien" endet mit einer Orgie, in deren tollem,
sinnverwirrenden Reigen die Kontrabaßtuba wie ein trunkener Riese
umherstapft. Aber nichts wäre ungerechter, als Berlioz auf seine bru-
talen und „höllischen" Wirkungen festzulegen, da doch mehrere seiner
besten Sachen, wie „Fee Mab" und „Sylphentanz" der Gattung
feiner, liebreizender und dustiger Kunst angehören.
Konnten die Stosfe, die Berlioz als Kind seiner Zeit wählte,
nur ein vorübergehendes Jnteresse wachrusen, so war er leider auch
nicht immer glücklich in ihrer Gestaltung sür den Zweck der musikalischen
Komposition. Jn der „Phantastischen" mag wohl die Kenntnis der
Ueberschristen genügen, um dem Verlaufe der Musik zu folgen, aber
in der Nomeosymphonie, die dem Stücke Shakesperes Szene für Szene
nachgeht, müßte der Hörer diese Szenenfolge genau im Kopfe haben,
um sich zurechtzufinden. Vieles in seinen dichterischen Vorwürfen wider-
strebt dem Ausdruck durch bloß musikalische Mittel, er will zu viel
reale Vorgänge in Tönen malen, erst die späteren Programm-
musiker haben gelernt, sich mehr auf die symbolische oder psychologische
Schilderung zu beschränken, die dem Wesen der Musik gemäß ist.
Auch war Berlioz insoserne nicht srei, als er an die von Beethoven
übernommene, mehrsätzige Symphonie sich klammerte und nicht wie
sein Erbe Liszt die Form jeweils aus der eigentümlichen Beschafsen-
heit des programmatischen Vorwurfs ableitete.
Jndem er seine Musik aus die Darstellung poetischer oder male-
rischer Jdeen gründete, bediente sich Berlioz zweier technischer Hilfs-
mittel, die sür die moderne Musik von größter Tragweite werden sollten:
des orchestralen Kolorits und der iäss kixs. Jeder Gebildete kennt
Berlioz als einen „Meister der Jnstrumentation", aber man stellt
330
RunstwarL
gramm" brachte jedenfalls ganz neue Ausdrucksmittel zur Ent-
wickeluug, sodaß man den langwierigen Streit darüber jetzt am besten
nach Kretzschmars treffendem Urteil entscheidet: es wäre ein Unglück,
wenn wir nur Programm-Musik hätten, aber es wäre kaum weniger
zu bedauern, wenn wir gar keine besäßen.
Erkennt man das Berliozsche Prinzip an, so ist damit noch nicht
die Art, wie er's durchführte, anerkannt. Jn stofflicher Hinsicht ge-
hören seine Werke einem überwundenen und ganz speziell französischen
Geschmack an, sie sind, aus dem Geiste der französischen Romantik ge-
boren, nahe Verwandte Eugen Syes und Viktor Hugos. Die Nei-
gung zum Krassen, Grauenhasten und Extremen, die „Schinderhannes-
phantasie", die unsern Vischer abstieß, braucht freilich nicht als be-
rechnende Efsekthascherei gedeutet zu werden, sie lag im wirklichen,
ausschweisenden Empfinden der Epoche. Berlioz bekennt, daß die Musik
auf ihn wie ein Fieber wirke, er wurde krank vor Aufregung, als er
znm erstenmal ein Drama Shakesperes und eine Symphonie Beet-
hovens hörte. Jn seiner „phantastischen Symphonie", die j829 seinen
Ruhm begründete, schildert er den Tranm eines Künstlers, der sich
aus unglücklicher Liebe vergiften wollte, aber die Opiumdosis zu
schwach nahm. Die Ueberschriften der einzelnen Sätze: „Träume und
Leidenschaften", „Ein Ball", „Szene ans dem Lande", „Gang zum
Hochgericht" nnd „Hexensabbath" denten die wechselnden Bilder des
Fiebertraumes an. Auch die zweite, nach Byron entworfene Sym-
phonie „Harold in Jtalien" endet mit einer Orgie, in deren tollem,
sinnverwirrenden Reigen die Kontrabaßtuba wie ein trunkener Riese
umherstapft. Aber nichts wäre ungerechter, als Berlioz auf seine bru-
talen und „höllischen" Wirkungen festzulegen, da doch mehrere seiner
besten Sachen, wie „Fee Mab" und „Sylphentanz" der Gattung
feiner, liebreizender und dustiger Kunst angehören.
Konnten die Stosfe, die Berlioz als Kind seiner Zeit wählte,
nur ein vorübergehendes Jnteresse wachrusen, so war er leider auch
nicht immer glücklich in ihrer Gestaltung sür den Zweck der musikalischen
Komposition. Jn der „Phantastischen" mag wohl die Kenntnis der
Ueberschristen genügen, um dem Verlaufe der Musik zu folgen, aber
in der Nomeosymphonie, die dem Stücke Shakesperes Szene für Szene
nachgeht, müßte der Hörer diese Szenenfolge genau im Kopfe haben,
um sich zurechtzufinden. Vieles in seinen dichterischen Vorwürfen wider-
strebt dem Ausdruck durch bloß musikalische Mittel, er will zu viel
reale Vorgänge in Tönen malen, erst die späteren Programm-
musiker haben gelernt, sich mehr auf die symbolische oder psychologische
Schilderung zu beschränken, die dem Wesen der Musik gemäß ist.
Auch war Berlioz insoserne nicht srei, als er an die von Beethoven
übernommene, mehrsätzige Symphonie sich klammerte und nicht wie
sein Erbe Liszt die Form jeweils aus der eigentümlichen Beschafsen-
heit des programmatischen Vorwurfs ableitete.
Jndem er seine Musik aus die Darstellung poetischer oder male-
rischer Jdeen gründete, bediente sich Berlioz zweier technischer Hilfs-
mittel, die sür die moderne Musik von größter Tragweite werden sollten:
des orchestralen Kolorits und der iäss kixs. Jeder Gebildete kennt
Berlioz als einen „Meister der Jnstrumentation", aber man stellt
330
RunstwarL