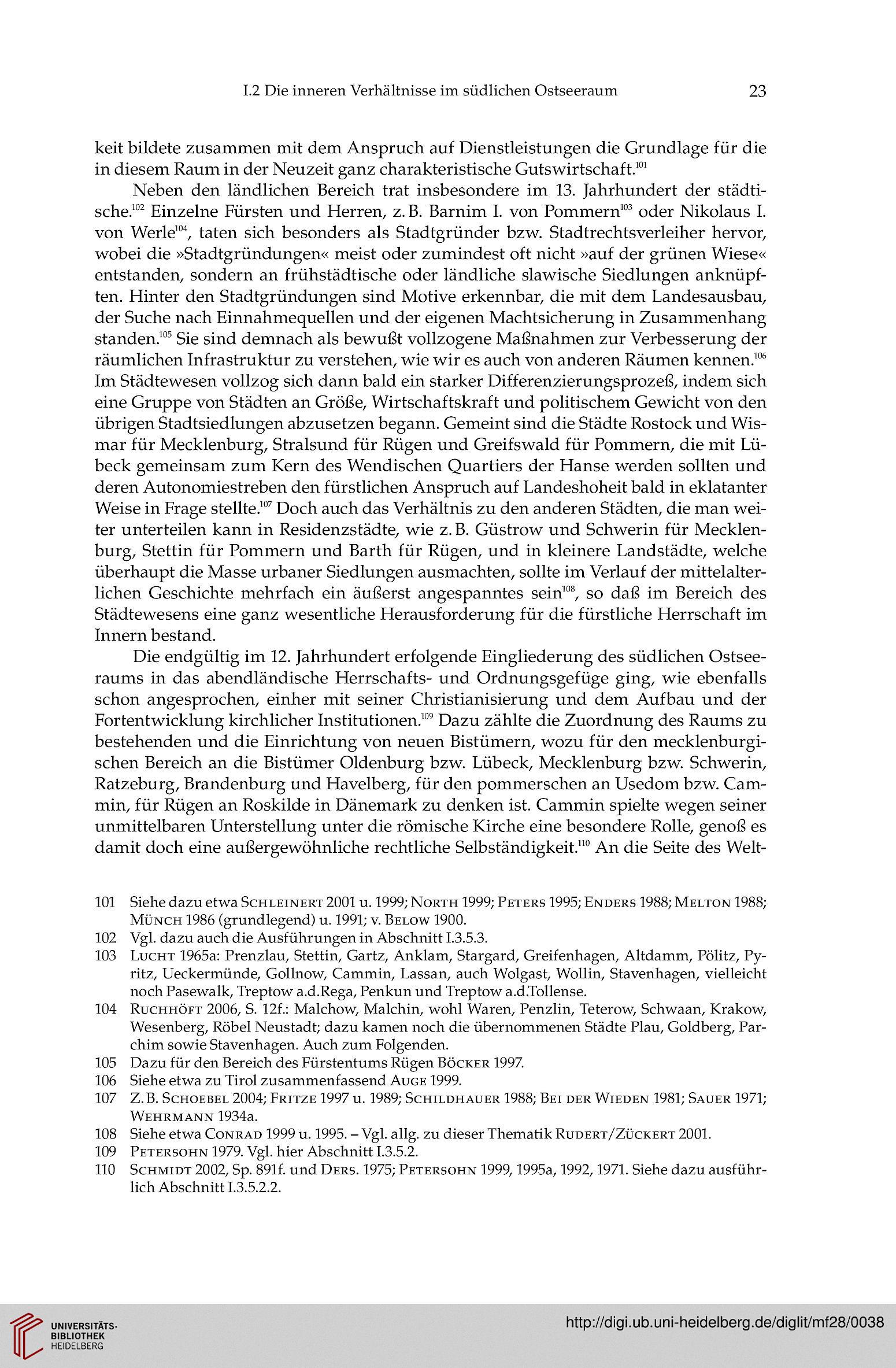1.2 Die inneren Verhältnisse im südlichen Ostseeraum
23
keit bildete zusammen mit dem Anspruch auf Dienstleistungen die Grundlage für die
in diesem Raum in der Neuzeit ganz charakteristische Gutswirtschaft."''
Neben den ländlichen Bereich trat insbesondere im 13. Jahrhundert der städti-
sche!"' Einzelne Fürsten und Herren, z. B. Barnim I. von Pommern*"" oder Nikolaus I.
von Werle'"*, taten sich besonders als Stadtgründer bzw. Stadtrechtsverleiher hervor,
wobei die »Stadtgründungen« meist oder zumindest oft nicht »auf der grünen Wiese«
entstanden, sondern an frühstädtische oder ländliche slawische Siedlungen anknüpf-
ten. Hinter den Stadtgründungen sind Motive erkennbar, die mit dem Landesausbau,
der Suche nach Einnahmequellen und der eigenen Machtsicherung in Zusammenhang
standen.*"" Sie sind demnach als bewußt vollzogene Maßnahmen zur Verbesserung der
räumlichen Infrastruktur zu verstehen, wie wir es auch von anderen Räumen kennen.*""
Im Städtewesen vollzog sich dann bald ein starker Differenzierungsprozeß, indem sich
eine Gruppe von Städten an Größe, Wirtschaftskraft und politischem Gewicht von den
übrigen Stadtsiedlungen abzusetzen begann. Gemeint sind die Städte Rostock und Wis-
mar für Mecklenburg, Stralsund für Rügen und Greifswald für Pommern, die mit Lü-
beck gemeinsam zum Kern des Wendischen Quartiers der Hanse werden sollten und
deren Autonomiestreben den fürstlichen Anspruch auf Landeshoheit bald in eklatanter
Weise in Frage stellte.*"^ Doch auch das Verhältnis zu den anderen Städten, die man wei-
ter unterteilen kann in Residenzstädte, wie z. B. Güstrow und Schwerin für Mecklen-
burg, Stettin für Pommern und Barth für Rügen, und in kleinere Landstädte, welche
überhaupt die Masse urbaner Siedlungen ausmachten, sollte im Verlauf der mittelalter-
lichen Geschichte mehrfach ein äußerst angespanntes sein*"", so daß im Bereich des
Städtewesens eine ganz wesentliche Herausforderung für die fürstliche Herrschaft im
Innern bestand.
Die endgültig im 12. Jahrhundert erfolgende Eingliederung des südlichen Ostsee-
raums in das abendländische Herrschafts- und Ordnungsgefüge ging, wie ebenfalls
schon angesprochen, einher mit seiner Christianisierung und dem Aufbau und der
Fortentwicklung kirchlicher Institutionen.*"" Dazu zählte die Zuordnung des Raums zu
bestehenden und die Einrichtung von neuen Bistümern, wozu für den mecklenburgi-
schen Bereich an die Bistümer Oldenburg bzw. Lübeck, Mecklenburg bzw. Schwerin,
Ratzeburg, Brandenburg und Havelberg, für den pommerschen an Usedom bzw. Cam-
min, für Rügen an Roskilde in Dänemark zu denken ist. Cammin spielte wegen seiner
unmittelbaren Unterstellung unter die römische Kirche eine besondere Rolle, genoß es
damit doch eine außergewöhnliche rechtliche Selbständigkeit.**" An die Seite des Welt-
101 Siehe dazu etwa ScHLEiNERT 2001 u. 1999; NORTH 1999; PETERS 1995; ENDERS 1988; MELTON 1988;
MÜNCH 1986 (grundlegend) u. 1991; v. BELOw 1900.
102 Vgl. dazu auch die Ausführungen in Abschnitt 1.3.5.3.
103 LucHT 1965a: Prenzlau, Stettin, Gartz, Anklam, Stargard, Greifenhagen, Altdamm, Pölitz, Py-
ritz. Ueckermünde, Gollnow, Cammin, Lassan, auch Wolgast, Wohin, Stavenhagen, vielleicht
noch Pasewalk, Treptow a.d.Rega, Penkun und Treptow a.d.Tollense.
104 RucHHÖFT 2006, S. 12f.: Malchow, Malchin, wohl Waren, Penzlin, Teterow, Schwaan, Krakow,
Wesenberg, Röbel Neustadt; dazu kamen noch die übernommenen Städte Plau, Goldberg, Par-
chim sowie Stavenhagen. Auch zum Folgenden.
105 Dazu für den Bereich des Fürstentums Rügen BÖCKER 1997.
106 Siehe etwa zu Tirol zusammenfassend AuGE 1999.
107 Z.B. ScHOEBEL 2004; FRITZE 1997 u. 1989; ScHiLDHAUER 1988; BEI DER WiEDEN 1981; SAUER 1971;
WEHRMANN 1934a.
108 Siehe etwa CONRAD 1999 u. 1995. - Vgl. allg. zu dieser Thematik RuDERT/ZüCKERT 2001.
109 PETERSOHN 1979. Vgl. hier Abschnitt I.3.5.2.
110 SCHMIDT 2002, Sp. 891f. und DERS. 1975; PETERSOHN 1999,1995a, 1992,1971. Siehe dazu ausführ-
lich Abschnitt 1.3.5.2.2.
23
keit bildete zusammen mit dem Anspruch auf Dienstleistungen die Grundlage für die
in diesem Raum in der Neuzeit ganz charakteristische Gutswirtschaft."''
Neben den ländlichen Bereich trat insbesondere im 13. Jahrhundert der städti-
sche!"' Einzelne Fürsten und Herren, z. B. Barnim I. von Pommern*"" oder Nikolaus I.
von Werle'"*, taten sich besonders als Stadtgründer bzw. Stadtrechtsverleiher hervor,
wobei die »Stadtgründungen« meist oder zumindest oft nicht »auf der grünen Wiese«
entstanden, sondern an frühstädtische oder ländliche slawische Siedlungen anknüpf-
ten. Hinter den Stadtgründungen sind Motive erkennbar, die mit dem Landesausbau,
der Suche nach Einnahmequellen und der eigenen Machtsicherung in Zusammenhang
standen.*"" Sie sind demnach als bewußt vollzogene Maßnahmen zur Verbesserung der
räumlichen Infrastruktur zu verstehen, wie wir es auch von anderen Räumen kennen.*""
Im Städtewesen vollzog sich dann bald ein starker Differenzierungsprozeß, indem sich
eine Gruppe von Städten an Größe, Wirtschaftskraft und politischem Gewicht von den
übrigen Stadtsiedlungen abzusetzen begann. Gemeint sind die Städte Rostock und Wis-
mar für Mecklenburg, Stralsund für Rügen und Greifswald für Pommern, die mit Lü-
beck gemeinsam zum Kern des Wendischen Quartiers der Hanse werden sollten und
deren Autonomiestreben den fürstlichen Anspruch auf Landeshoheit bald in eklatanter
Weise in Frage stellte.*"^ Doch auch das Verhältnis zu den anderen Städten, die man wei-
ter unterteilen kann in Residenzstädte, wie z. B. Güstrow und Schwerin für Mecklen-
burg, Stettin für Pommern und Barth für Rügen, und in kleinere Landstädte, welche
überhaupt die Masse urbaner Siedlungen ausmachten, sollte im Verlauf der mittelalter-
lichen Geschichte mehrfach ein äußerst angespanntes sein*"", so daß im Bereich des
Städtewesens eine ganz wesentliche Herausforderung für die fürstliche Herrschaft im
Innern bestand.
Die endgültig im 12. Jahrhundert erfolgende Eingliederung des südlichen Ostsee-
raums in das abendländische Herrschafts- und Ordnungsgefüge ging, wie ebenfalls
schon angesprochen, einher mit seiner Christianisierung und dem Aufbau und der
Fortentwicklung kirchlicher Institutionen.*"" Dazu zählte die Zuordnung des Raums zu
bestehenden und die Einrichtung von neuen Bistümern, wozu für den mecklenburgi-
schen Bereich an die Bistümer Oldenburg bzw. Lübeck, Mecklenburg bzw. Schwerin,
Ratzeburg, Brandenburg und Havelberg, für den pommerschen an Usedom bzw. Cam-
min, für Rügen an Roskilde in Dänemark zu denken ist. Cammin spielte wegen seiner
unmittelbaren Unterstellung unter die römische Kirche eine besondere Rolle, genoß es
damit doch eine außergewöhnliche rechtliche Selbständigkeit.**" An die Seite des Welt-
101 Siehe dazu etwa ScHLEiNERT 2001 u. 1999; NORTH 1999; PETERS 1995; ENDERS 1988; MELTON 1988;
MÜNCH 1986 (grundlegend) u. 1991; v. BELOw 1900.
102 Vgl. dazu auch die Ausführungen in Abschnitt 1.3.5.3.
103 LucHT 1965a: Prenzlau, Stettin, Gartz, Anklam, Stargard, Greifenhagen, Altdamm, Pölitz, Py-
ritz. Ueckermünde, Gollnow, Cammin, Lassan, auch Wolgast, Wohin, Stavenhagen, vielleicht
noch Pasewalk, Treptow a.d.Rega, Penkun und Treptow a.d.Tollense.
104 RucHHÖFT 2006, S. 12f.: Malchow, Malchin, wohl Waren, Penzlin, Teterow, Schwaan, Krakow,
Wesenberg, Röbel Neustadt; dazu kamen noch die übernommenen Städte Plau, Goldberg, Par-
chim sowie Stavenhagen. Auch zum Folgenden.
105 Dazu für den Bereich des Fürstentums Rügen BÖCKER 1997.
106 Siehe etwa zu Tirol zusammenfassend AuGE 1999.
107 Z.B. ScHOEBEL 2004; FRITZE 1997 u. 1989; ScHiLDHAUER 1988; BEI DER WiEDEN 1981; SAUER 1971;
WEHRMANN 1934a.
108 Siehe etwa CONRAD 1999 u. 1995. - Vgl. allg. zu dieser Thematik RuDERT/ZüCKERT 2001.
109 PETERSOHN 1979. Vgl. hier Abschnitt I.3.5.2.
110 SCHMIDT 2002, Sp. 891f. und DERS. 1975; PETERSOHN 1999,1995a, 1992,1971. Siehe dazu ausführ-
lich Abschnitt 1.3.5.2.2.