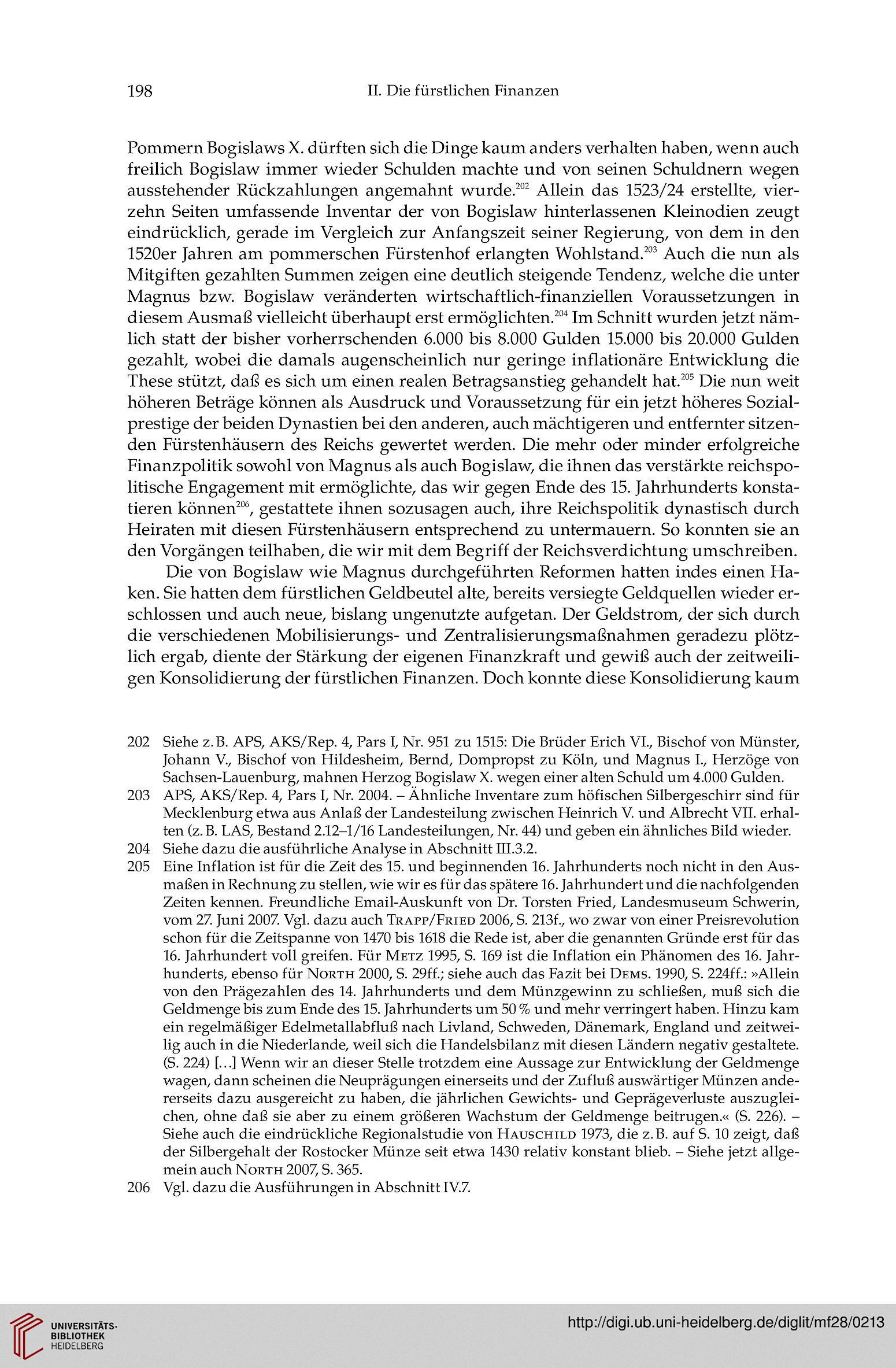198
II. Die fürstlichen Finanzen
Pommern Bogislaws X. dürften sich die Dinge kaum anders verhalten haben, wenn auch
freilich Bogislaw immer wieder Schulden machte und von seinen Schuldnern wegen
ausstehender Rückzahlungen angemahnt wurde.'"' Allein das 1523/24 erstellte, vier-
zehn Seiten umfassende Inventar der von Bogislaw hinterlassenen Kleinodien zeugt
eindrücklich, gerade im Vergleich zur Anfangszeit seiner Regierung, von dem in den
1520er Jahren am pommerschen Fürstenhof erlangten Wohlstand/"" Auch die nun als
Mitgiften gezahlten Summen zeigen eine deutlich steigende Tendenz, welche die unter
Magnus bzw. Bogislaw veränderten wirtschaftlich-finanziellen Voraussetzungen in
diesem Ausmaß vielleicht überhaupt erst ermöglichten/"^ Im Schnitt wurden jetzt näm-
lich statt der bisher vorherrschenden 6.000 bis 8.000 Gulden 15.000 bis 20.000 Gulden
gezahlt, wobei die damals augenscheinlich nur geringe inflationäre Entwicklung die
These stützt, daß es sich um einen realen Betragsanstieg gehandelt hat/"" Die nun weit
höheren Beträge können als Ausdruck und Voraussetzung für ein jetzt höheres Sozial-
prestige der beiden Dynastien bei den anderen, auch mächtigeren und entfernter sitzen-
den Fürstenhäusern des Reichs gewertet werden. Die mehr oder minder erfolgreiche
Finanzpolitik sowohl von Magnus als auch Bogislaw, die ihnen das verstärkte reichspo-
litische Engagement mit ermöglichte, das wir gegen Ende des 15. Jahrhunderts konsta-
tieren können""", gestattete ihnen sozusagen auch, ihre Reichspolitik dynastisch durch
Heiraten mit diesen Fürstenhäusern entsprechend zu untermauern. So konnten sie an
den Vorgängen teilhaben, die wir mit dem Begriff der Reichsverdichtung umschreiben.
Die von Bogislaw wie Magnus durchgeführten Reformen hatten indes einen Ha-
ken. Sie hatten dem fürstlichen Geldbeutel alte, bereits versiegte Geldquellen wieder er-
schlossen und auch neue, bislang ungenutzte aufgetan. Der Geldstrom, der sich durch
die verschiedenen Mobilisierungs- und Zentralisierungsmaßnahmen geradezu plötz-
lich ergab, diente der Stärkung der eigenen Finanzkraft und gewiß auch der zeitweili-
gen Konsolidierung der fürstlichen Finanzen. Doch konnte diese Konsolidierung kaum
202 Siehe z.B. APS, AKS/Rep. 4, Pars I, Nr. 951 zu 1515: Die Brüder Erich VI., Bischof von Münster,
Johann V., Bischof von Hildesheim, Bernd, Dompropst zu Köln, und Magnus I., Herzoge von
Sachsen-Lauenburg, mahnen Herzog Bogislaw X. wegen einer alten Schuld um 4.000 Gulden.
203 APS, AKS/Rep. 4, Pars I, Nr. 2004. - Ähnliche Inventare zum höfischen Silbergeschirr sind für
Mecklenburg etwa aus Anlaß der Landesteilung zwischen Heinrich V. und Albrecht VII. erhal-
ten (z. B. LAS, Bestand 2.12-1/16 Landesteilungen, Nr. 44) und geben ein ähnliches Bild wieder.
204 Siehe dazu die ausführliche Analyse in Abschnitt 111.3.2.
205 Eine Inflation ist für die Zeit des 15. und beginnenden 16. Jahrhunderts noch nicht in den Aus-
maßen in Rechnung zu stellen, wie wir es für das spätere 16. Jahrhundert und die nachfolgenden
Zeiten kennen. Freundliche Email-Auskunft von Dr. Torsten Fried, Landesmuseum Schwerin,
vom 27. Juni 2007. Vgl. dazu auch TRAPp/FRiED 2006, S. 213f., wo zwar von einer Preisrevolution
schon für die Zeitspanne von 1470 bis 1618 die Rede ist, aber die genannten Gründe erst für das
16. Jahrhundert voll greifen. Für METZ 1995, S. 169 ist die Inflation ein Phänomen des 16. Jahr-
hunderts, ebenso für NORTH 2000, S. 29ff.; siehe auch das Fazit bei DEMS. 1990, S. 224ff.: »Allein
von den Prägezahlen des 14. Jahrhunderts und dem Münzgewinn zu schließen, muß sich die
Geldmenge bis zum Ende des 15. Jahrhunderts um 50 % und mehr verringert haben. Hinzu kam
ein regelmäßiger Edelmetallabfluß nach Livland, Schweden, Dänemark, England und zeitwei-
lig auch in die Niederlande, weil sich die Handelsbilanz mit diesen Ländern negativ gestaltete.
(S. 224) [...] Wenn wir an dieser Stelle trotzdem eine Aussage zur Entwicklung der Geldmenge
wagen, dann scheinen die Neuprägungen einerseits und der Zufluß auswärtiger Münzen ande-
rerseits dazu ausgereicht zu haben, die jährlichen Gewichts- und Geprägeverluste auszuglei-
chen, ohne daß sie aber zu einem größeren Wachstum der Geldmenge beitrugen.« (S. 226). -
Siehe auch die eindrückliche Regionalstudie von HAUSCHILD 1973, die z.B. auf S. 10 zeigt, daß
der Silbergehalt der Rostocker Münze seit etwa 1430 relativ konstant blieb. - Siehe jetzt allge-
mein auch NoRTH 200/ S. 365.
206 Vgl. dazu die Ausführungen in Abschnitt IV.7.
II. Die fürstlichen Finanzen
Pommern Bogislaws X. dürften sich die Dinge kaum anders verhalten haben, wenn auch
freilich Bogislaw immer wieder Schulden machte und von seinen Schuldnern wegen
ausstehender Rückzahlungen angemahnt wurde.'"' Allein das 1523/24 erstellte, vier-
zehn Seiten umfassende Inventar der von Bogislaw hinterlassenen Kleinodien zeugt
eindrücklich, gerade im Vergleich zur Anfangszeit seiner Regierung, von dem in den
1520er Jahren am pommerschen Fürstenhof erlangten Wohlstand/"" Auch die nun als
Mitgiften gezahlten Summen zeigen eine deutlich steigende Tendenz, welche die unter
Magnus bzw. Bogislaw veränderten wirtschaftlich-finanziellen Voraussetzungen in
diesem Ausmaß vielleicht überhaupt erst ermöglichten/"^ Im Schnitt wurden jetzt näm-
lich statt der bisher vorherrschenden 6.000 bis 8.000 Gulden 15.000 bis 20.000 Gulden
gezahlt, wobei die damals augenscheinlich nur geringe inflationäre Entwicklung die
These stützt, daß es sich um einen realen Betragsanstieg gehandelt hat/"" Die nun weit
höheren Beträge können als Ausdruck und Voraussetzung für ein jetzt höheres Sozial-
prestige der beiden Dynastien bei den anderen, auch mächtigeren und entfernter sitzen-
den Fürstenhäusern des Reichs gewertet werden. Die mehr oder minder erfolgreiche
Finanzpolitik sowohl von Magnus als auch Bogislaw, die ihnen das verstärkte reichspo-
litische Engagement mit ermöglichte, das wir gegen Ende des 15. Jahrhunderts konsta-
tieren können""", gestattete ihnen sozusagen auch, ihre Reichspolitik dynastisch durch
Heiraten mit diesen Fürstenhäusern entsprechend zu untermauern. So konnten sie an
den Vorgängen teilhaben, die wir mit dem Begriff der Reichsverdichtung umschreiben.
Die von Bogislaw wie Magnus durchgeführten Reformen hatten indes einen Ha-
ken. Sie hatten dem fürstlichen Geldbeutel alte, bereits versiegte Geldquellen wieder er-
schlossen und auch neue, bislang ungenutzte aufgetan. Der Geldstrom, der sich durch
die verschiedenen Mobilisierungs- und Zentralisierungsmaßnahmen geradezu plötz-
lich ergab, diente der Stärkung der eigenen Finanzkraft und gewiß auch der zeitweili-
gen Konsolidierung der fürstlichen Finanzen. Doch konnte diese Konsolidierung kaum
202 Siehe z.B. APS, AKS/Rep. 4, Pars I, Nr. 951 zu 1515: Die Brüder Erich VI., Bischof von Münster,
Johann V., Bischof von Hildesheim, Bernd, Dompropst zu Köln, und Magnus I., Herzoge von
Sachsen-Lauenburg, mahnen Herzog Bogislaw X. wegen einer alten Schuld um 4.000 Gulden.
203 APS, AKS/Rep. 4, Pars I, Nr. 2004. - Ähnliche Inventare zum höfischen Silbergeschirr sind für
Mecklenburg etwa aus Anlaß der Landesteilung zwischen Heinrich V. und Albrecht VII. erhal-
ten (z. B. LAS, Bestand 2.12-1/16 Landesteilungen, Nr. 44) und geben ein ähnliches Bild wieder.
204 Siehe dazu die ausführliche Analyse in Abschnitt 111.3.2.
205 Eine Inflation ist für die Zeit des 15. und beginnenden 16. Jahrhunderts noch nicht in den Aus-
maßen in Rechnung zu stellen, wie wir es für das spätere 16. Jahrhundert und die nachfolgenden
Zeiten kennen. Freundliche Email-Auskunft von Dr. Torsten Fried, Landesmuseum Schwerin,
vom 27. Juni 2007. Vgl. dazu auch TRAPp/FRiED 2006, S. 213f., wo zwar von einer Preisrevolution
schon für die Zeitspanne von 1470 bis 1618 die Rede ist, aber die genannten Gründe erst für das
16. Jahrhundert voll greifen. Für METZ 1995, S. 169 ist die Inflation ein Phänomen des 16. Jahr-
hunderts, ebenso für NORTH 2000, S. 29ff.; siehe auch das Fazit bei DEMS. 1990, S. 224ff.: »Allein
von den Prägezahlen des 14. Jahrhunderts und dem Münzgewinn zu schließen, muß sich die
Geldmenge bis zum Ende des 15. Jahrhunderts um 50 % und mehr verringert haben. Hinzu kam
ein regelmäßiger Edelmetallabfluß nach Livland, Schweden, Dänemark, England und zeitwei-
lig auch in die Niederlande, weil sich die Handelsbilanz mit diesen Ländern negativ gestaltete.
(S. 224) [...] Wenn wir an dieser Stelle trotzdem eine Aussage zur Entwicklung der Geldmenge
wagen, dann scheinen die Neuprägungen einerseits und der Zufluß auswärtiger Münzen ande-
rerseits dazu ausgereicht zu haben, die jährlichen Gewichts- und Geprägeverluste auszuglei-
chen, ohne daß sie aber zu einem größeren Wachstum der Geldmenge beitrugen.« (S. 226). -
Siehe auch die eindrückliche Regionalstudie von HAUSCHILD 1973, die z.B. auf S. 10 zeigt, daß
der Silbergehalt der Rostocker Münze seit etwa 1430 relativ konstant blieb. - Siehe jetzt allge-
mein auch NoRTH 200/ S. 365.
206 Vgl. dazu die Ausführungen in Abschnitt IV.7.