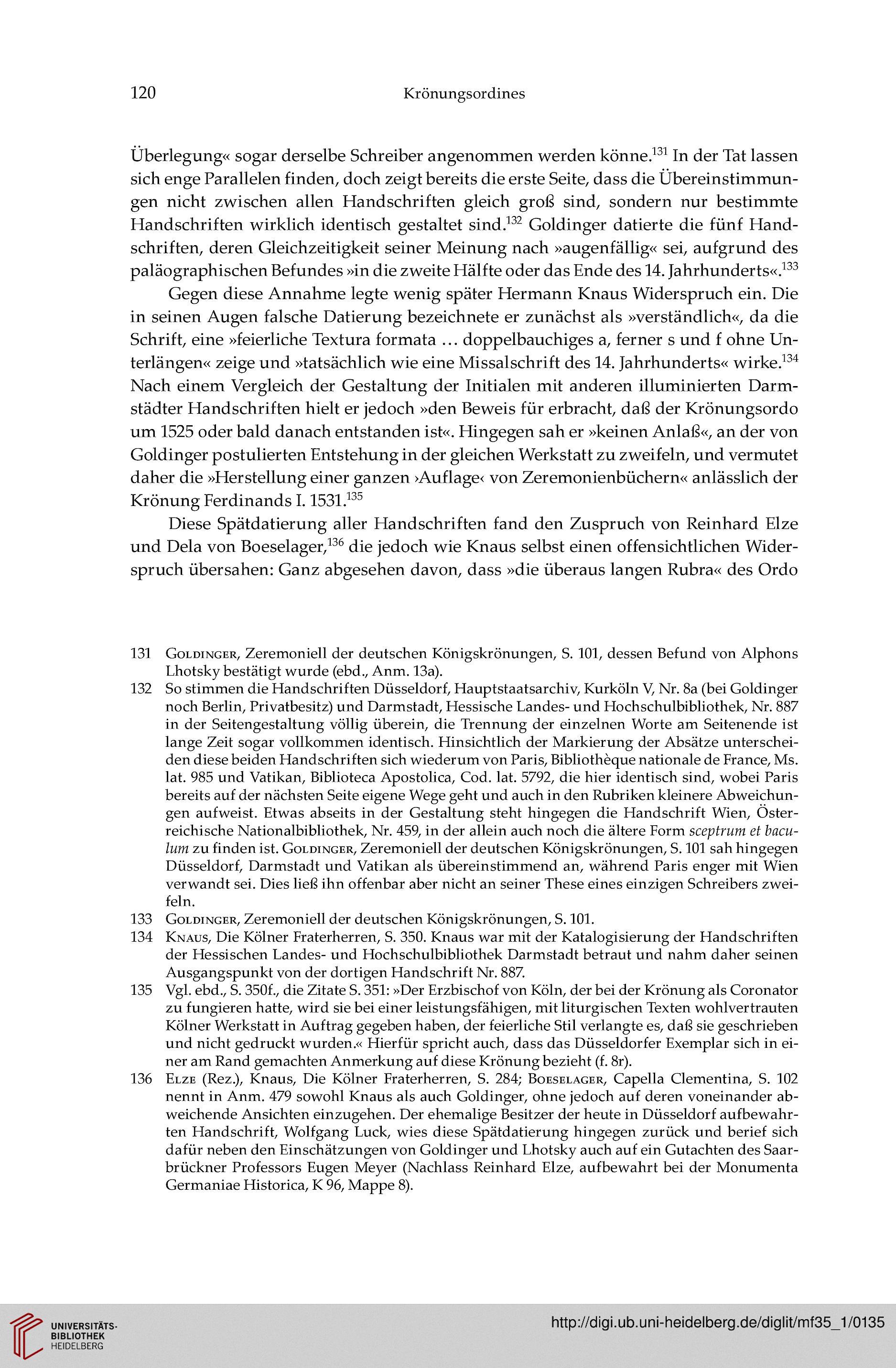120
Krönungsordines
Überlegung« sogar derselbe Schreiber angenommen werden könneV In der Tat lassen
sich enge Parallelen finden, doch zeigt bereits die erste Seite, dass die Übereinstimmun-
gen nicht zwischen allen Handschriften gleich groß sind, sondern nur bestimmte
Handschriften wirklich identisch gestaltet sind.'^ Goldinger datierte die fünf Hand-
schriften, deren Gleichzeitigkeit seiner Meinung nach »augenfällig« sei, aufgrund des
paläographischen Befundes »in die zweite Hälfte oder das Ende des 14. Jahrhunderts«.^
Gegen diese Annahme legte wenig später Hermann Knaus Widerspruch ein. Die
in seinen Augen falsche Datierung bezeichnete er zunächst als »verständlich«, da die
Schrift, eine »feierliche Textura formata ... doppelbauchiges a, ferner s und f ohne Un-
terlängen« zeige und »tatsächlich wie eine Missalschrift des 14. Jahrhunderts« wirke V
Nach einem Vergleich der Gestaltung der Initialen mit anderen illuminierten Darm-
städter Handschriften hielt er jedoch »den Beweis für erbracht, daß der Krönungsordo
um 1525 oder bald danach entstanden ist«. Hingegen sah er »keinen Anlaß«, an der von
Goldinger postulierten Entstehung in der gleichen Werkstatt zu zweifeln, und vermutet
daher die »Herstellung einer ganzen >Auflage< von Zeremonienbüchern« anlässlich der
Krönung Ferdinands 1.1531.^
Diese Spätdatierung aller Handschriften fand den Zuspruch von Reinhard Elze
und Dela von Boeselager,'^' die jedoch wie Knaus selbst einen offensichtlichen Wider-
spruch übersahen: Ganz abgesehen davon, dass »die überaus langen Rubra« des Ordo
131 GoLDiNGER, Zeremoniell der deutschen Königskrönungen, S. 101, dessen Befund von Alphons
Lhotsky bestätigt wurde (ebd., Anm. 13a).
132 So stimmen die Handschriften Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, Kurköln V, Nr. 8a (bei Goldinger
noch Berlin, Privatbesitz) und Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek, Nr. 887
in der Seitengestaltung völlig überein, die Trennung der einzelnen Worte am Seitenende ist
lange Zeit sogar vollkommen identisch. Hinsichtlich der Markierung der Absätze unterschei-
den diese beiden Handschriften sich wiederum von Paris, Bibliotheque nationale de France, Ms.
lat. 985 und Vatikan, Biblioteca Apostolica, Cod. lat. 5792, die hier identisch sind, wobei Paris
bereits auf der nächsten Seite eigene Wege geht und auch in den Rubriken kleinere Abweichun-
gen aufweist. Etwas abseits in der Gestaltung steht hingegen die Handschrift Wien, Öster-
reichische Nationalbibliothek, Nr. 459, in der allein auch noch die ältere Form scepÜMw: A Facu-
zu finden ist. GoLDiNGER, Zeremoniell der deutschen Königskrönungen, S. 101 sah hingegen
Düsseldorf, Darmstadt und Vatikan als übereinstimmend an, während Paris enger mit Wien
verwandt sei. Dies ließ ihn offenbar aber nicht an seiner These eines einzigen Schreibers zwei-
feln.
133 GoLDiNGER, Zeremoniell der deutschen Königskrönungen, S. 101.
134 KNAus, Die Kölner Fraterherren, S. 350. Knaus war mit der Katalogisierung der Handschriften
der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt betraut und nahm daher seinen
Ausgangspunkt von der dortigen Handschrift Nr. 887.
135 Vgl. ebd., S. 350f., die Zitate S. 351: »Der Erzbischof von Köln, der bei der Krönung als Coronator
zu fungieren hatte, wird sie bei einer leistungsfähigen, mit liturgischen Texten wohlvertrauten
Kölner Werkstatt in Auftrag gegeben haben, der feierliche Stil verlangte es, daß sie geschrieben
und nicht gedruckt wurden.« Hierfür spricht auch, dass das Düsseldorfer Exemplar sich in ei-
ner am Rand gemachten Anmerkung auf diese Krönung bezieht (f. 8r).
136 ELZE (Rez.), Knaus, Die Kölner Fraterherren, S. 284; BoESELAGER, Capella Clementina, S. 102
nennt in Anm. 479 sowohl Knaus als auch Goldinger, ohne jedoch auf deren voneinander ab-
weichende Ansichten einzugehen. Der ehemalige Besitzer der heute in Düsseldorf aufbewahr-
ten Handschrift, Wolfgang Luck, wies diese Spätdatierung hingegen zurück und berief sich
dafür neben den Einschätzungen von Goldinger und Lhotsky auch auf ein Gutachten des Saar-
brückner Professors Eugen Meyer (Nachlass Reinhard Elze, aufbewahrt bei der Monumenta
Germaniae Historica, K 96, Mappe 8).
Krönungsordines
Überlegung« sogar derselbe Schreiber angenommen werden könneV In der Tat lassen
sich enge Parallelen finden, doch zeigt bereits die erste Seite, dass die Übereinstimmun-
gen nicht zwischen allen Handschriften gleich groß sind, sondern nur bestimmte
Handschriften wirklich identisch gestaltet sind.'^ Goldinger datierte die fünf Hand-
schriften, deren Gleichzeitigkeit seiner Meinung nach »augenfällig« sei, aufgrund des
paläographischen Befundes »in die zweite Hälfte oder das Ende des 14. Jahrhunderts«.^
Gegen diese Annahme legte wenig später Hermann Knaus Widerspruch ein. Die
in seinen Augen falsche Datierung bezeichnete er zunächst als »verständlich«, da die
Schrift, eine »feierliche Textura formata ... doppelbauchiges a, ferner s und f ohne Un-
terlängen« zeige und »tatsächlich wie eine Missalschrift des 14. Jahrhunderts« wirke V
Nach einem Vergleich der Gestaltung der Initialen mit anderen illuminierten Darm-
städter Handschriften hielt er jedoch »den Beweis für erbracht, daß der Krönungsordo
um 1525 oder bald danach entstanden ist«. Hingegen sah er »keinen Anlaß«, an der von
Goldinger postulierten Entstehung in der gleichen Werkstatt zu zweifeln, und vermutet
daher die »Herstellung einer ganzen >Auflage< von Zeremonienbüchern« anlässlich der
Krönung Ferdinands 1.1531.^
Diese Spätdatierung aller Handschriften fand den Zuspruch von Reinhard Elze
und Dela von Boeselager,'^' die jedoch wie Knaus selbst einen offensichtlichen Wider-
spruch übersahen: Ganz abgesehen davon, dass »die überaus langen Rubra« des Ordo
131 GoLDiNGER, Zeremoniell der deutschen Königskrönungen, S. 101, dessen Befund von Alphons
Lhotsky bestätigt wurde (ebd., Anm. 13a).
132 So stimmen die Handschriften Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, Kurköln V, Nr. 8a (bei Goldinger
noch Berlin, Privatbesitz) und Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek, Nr. 887
in der Seitengestaltung völlig überein, die Trennung der einzelnen Worte am Seitenende ist
lange Zeit sogar vollkommen identisch. Hinsichtlich der Markierung der Absätze unterschei-
den diese beiden Handschriften sich wiederum von Paris, Bibliotheque nationale de France, Ms.
lat. 985 und Vatikan, Biblioteca Apostolica, Cod. lat. 5792, die hier identisch sind, wobei Paris
bereits auf der nächsten Seite eigene Wege geht und auch in den Rubriken kleinere Abweichun-
gen aufweist. Etwas abseits in der Gestaltung steht hingegen die Handschrift Wien, Öster-
reichische Nationalbibliothek, Nr. 459, in der allein auch noch die ältere Form scepÜMw: A Facu-
zu finden ist. GoLDiNGER, Zeremoniell der deutschen Königskrönungen, S. 101 sah hingegen
Düsseldorf, Darmstadt und Vatikan als übereinstimmend an, während Paris enger mit Wien
verwandt sei. Dies ließ ihn offenbar aber nicht an seiner These eines einzigen Schreibers zwei-
feln.
133 GoLDiNGER, Zeremoniell der deutschen Königskrönungen, S. 101.
134 KNAus, Die Kölner Fraterherren, S. 350. Knaus war mit der Katalogisierung der Handschriften
der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt betraut und nahm daher seinen
Ausgangspunkt von der dortigen Handschrift Nr. 887.
135 Vgl. ebd., S. 350f., die Zitate S. 351: »Der Erzbischof von Köln, der bei der Krönung als Coronator
zu fungieren hatte, wird sie bei einer leistungsfähigen, mit liturgischen Texten wohlvertrauten
Kölner Werkstatt in Auftrag gegeben haben, der feierliche Stil verlangte es, daß sie geschrieben
und nicht gedruckt wurden.« Hierfür spricht auch, dass das Düsseldorfer Exemplar sich in ei-
ner am Rand gemachten Anmerkung auf diese Krönung bezieht (f. 8r).
136 ELZE (Rez.), Knaus, Die Kölner Fraterherren, S. 284; BoESELAGER, Capella Clementina, S. 102
nennt in Anm. 479 sowohl Knaus als auch Goldinger, ohne jedoch auf deren voneinander ab-
weichende Ansichten einzugehen. Der ehemalige Besitzer der heute in Düsseldorf aufbewahr-
ten Handschrift, Wolfgang Luck, wies diese Spätdatierung hingegen zurück und berief sich
dafür neben den Einschätzungen von Goldinger und Lhotsky auch auf ein Gutachten des Saar-
brückner Professors Eugen Meyer (Nachlass Reinhard Elze, aufbewahrt bei der Monumenta
Germaniae Historica, K 96, Mappe 8).