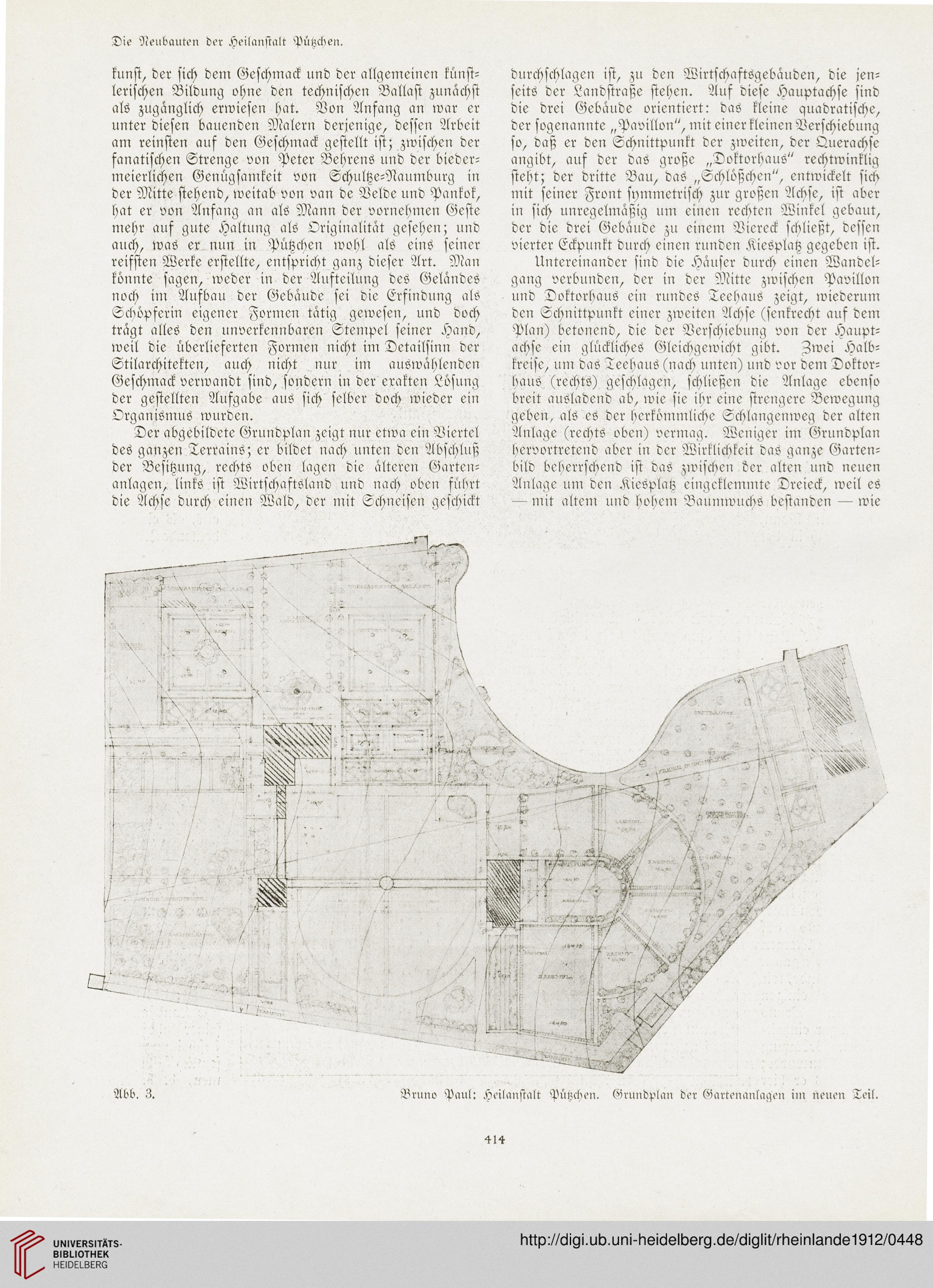Verband der Kunstfreunde in den Ländern am Rhein [Hrsg.]
Die Rheinlande: Vierteljahrsschr. d. Verbandes der Kunstfreunde in den Ländern am Rhein
— 22.1912
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.26494#0448
DOI Heft:
Heft 12
DOI Artikel:Gischler, W.: Die Neubauten der Heilanstalt Pützchen: erstellt von Bruno Paul
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26494#0448
Die Neubauten der Heilanstalt Pühchen.
kunst, der sich dem Geschmack und der allgemeinen künst-
lerischen Bildung ohne den technischen Ballast zunächst
als zugänglich erwiesen hat. Von Ansang an war er
unter diesen bauenden Malern derjenige, dessen Arbeit
am reinsten auf den Geschmack gestellt ist; zwischen der
fanatischen Strenge von Peter Behrens und der bieder-
meierlichen Genügsamkeit von Schultze-Naumburg in
der Mitte stehend, weitab von van de Velde und Pankok,
hat er von Anfang an als Mann der vornehmen Geste
mehr auf gute Haltung als Originalität gesehen; und
auch, was er nun in Pützchen wohl als eins seiner
reifsten Werke erstellte, entspricht ganz dieser Art. Man
könnte sagen, weder in der Aufteilung des Geländes
noch im Aufbau der Gebätlde sei die Erfindtlng als
Schöpferin eigener Formen tätig gewesen, und doch
tragt alles den unverkennbaren Stempel seiner Hand,
weil die überlieferten Formen nicht im Detailsinn der
Stilarchitekten, auch nicht nur im auswählenden
Geschmack verwandt sind, sondern in der erakten Lösung
der gestellten Aufgabe aus sich selber doch wieder ein
Organismus wurden.
Der abgebildete Grundplan zeigt nur etwa ein Viertel
des ganzen Terrains; er bildet nach unten den Abschluß
der Besitzung, rechts oben lagen die älteren Garten-
anlagen, links ist Wirtschaftsland und nach oben fübrt
die Achse durch einen Wald, der mit Schneisen geschickt
durchschlagen ist, zu den Wirtschaftsgebäuden, die jen-
seits der Landstraße stehen. Auf diese Hauptachse sind
die drei Gebaude orientiert: das kleine quadratische,
der sogenannte „Pavillon", mit einer kleinen Verschiebung
so, daß er den Schnittpunkt der zweiten, der Querachse
angibt, auf der das große „Doktorhaus" rechtwinklig
steht; der dritte Bau, das „Schlößchen", entwickelt sich
mit seiner Front symmetrisch zur großen Achse, ist aber
in sich unregelmäßig um einen rechten Winkel gebaut,
der die drei Gebäude zu einem Viereck schließt, dessen
vierter Eckpunkt durch einen runden Kiesplatz gegeben ist.
Untereinander sind die Häuser durch einen Wandel-
gang verbunden, der in der Mitte zwischen Pavillon
und Doktorhaus ein rundes Teehaus zeigt, wiederum
den Schnittpunkt einer zweiten Achse (senkrecht auf dem
Plan) betonend, die der Verschiebung von der Haupt-
achse ein glückliches Gleichgewicht gibt. Awei Halb-
kreise, um das Teehaus (nach unten) und vor dem Doktor-
haus (rechts) geschlagen, schließen die Anlage ebenso
breit ausladend ab, wie sie ihr eine strengere Bewegung
geben, als es der herkönnnliche Schlangenweg der alten
Anlage (rechts oben) vermag. Weniger im Grundplan
hervortretend aber in der Wirklichkeit das ganze Garten-
bild beherrschend ist das zwischen der alten und neuen
Anlage um den Kiesplatz eingeklemmte Dreieck, weil es
— mit altem und hohem Baumwuchs bestanden — wie
Abb. 3.
Bruno Paul: Heilanstalt Pühchen. Grundplan der Gartenanlagen im neuen Teil.
kunst, der sich dem Geschmack und der allgemeinen künst-
lerischen Bildung ohne den technischen Ballast zunächst
als zugänglich erwiesen hat. Von Ansang an war er
unter diesen bauenden Malern derjenige, dessen Arbeit
am reinsten auf den Geschmack gestellt ist; zwischen der
fanatischen Strenge von Peter Behrens und der bieder-
meierlichen Genügsamkeit von Schultze-Naumburg in
der Mitte stehend, weitab von van de Velde und Pankok,
hat er von Anfang an als Mann der vornehmen Geste
mehr auf gute Haltung als Originalität gesehen; und
auch, was er nun in Pützchen wohl als eins seiner
reifsten Werke erstellte, entspricht ganz dieser Art. Man
könnte sagen, weder in der Aufteilung des Geländes
noch im Aufbau der Gebätlde sei die Erfindtlng als
Schöpferin eigener Formen tätig gewesen, und doch
tragt alles den unverkennbaren Stempel seiner Hand,
weil die überlieferten Formen nicht im Detailsinn der
Stilarchitekten, auch nicht nur im auswählenden
Geschmack verwandt sind, sondern in der erakten Lösung
der gestellten Aufgabe aus sich selber doch wieder ein
Organismus wurden.
Der abgebildete Grundplan zeigt nur etwa ein Viertel
des ganzen Terrains; er bildet nach unten den Abschluß
der Besitzung, rechts oben lagen die älteren Garten-
anlagen, links ist Wirtschaftsland und nach oben fübrt
die Achse durch einen Wald, der mit Schneisen geschickt
durchschlagen ist, zu den Wirtschaftsgebäuden, die jen-
seits der Landstraße stehen. Auf diese Hauptachse sind
die drei Gebaude orientiert: das kleine quadratische,
der sogenannte „Pavillon", mit einer kleinen Verschiebung
so, daß er den Schnittpunkt der zweiten, der Querachse
angibt, auf der das große „Doktorhaus" rechtwinklig
steht; der dritte Bau, das „Schlößchen", entwickelt sich
mit seiner Front symmetrisch zur großen Achse, ist aber
in sich unregelmäßig um einen rechten Winkel gebaut,
der die drei Gebäude zu einem Viereck schließt, dessen
vierter Eckpunkt durch einen runden Kiesplatz gegeben ist.
Untereinander sind die Häuser durch einen Wandel-
gang verbunden, der in der Mitte zwischen Pavillon
und Doktorhaus ein rundes Teehaus zeigt, wiederum
den Schnittpunkt einer zweiten Achse (senkrecht auf dem
Plan) betonend, die der Verschiebung von der Haupt-
achse ein glückliches Gleichgewicht gibt. Awei Halb-
kreise, um das Teehaus (nach unten) und vor dem Doktor-
haus (rechts) geschlagen, schließen die Anlage ebenso
breit ausladend ab, wie sie ihr eine strengere Bewegung
geben, als es der herkönnnliche Schlangenweg der alten
Anlage (rechts oben) vermag. Weniger im Grundplan
hervortretend aber in der Wirklichkeit das ganze Garten-
bild beherrschend ist das zwischen der alten und neuen
Anlage um den Kiesplatz eingeklemmte Dreieck, weil es
— mit altem und hohem Baumwuchs bestanden — wie
Abb. 3.
Bruno Paul: Heilanstalt Pühchen. Grundplan der Gartenanlagen im neuen Teil.