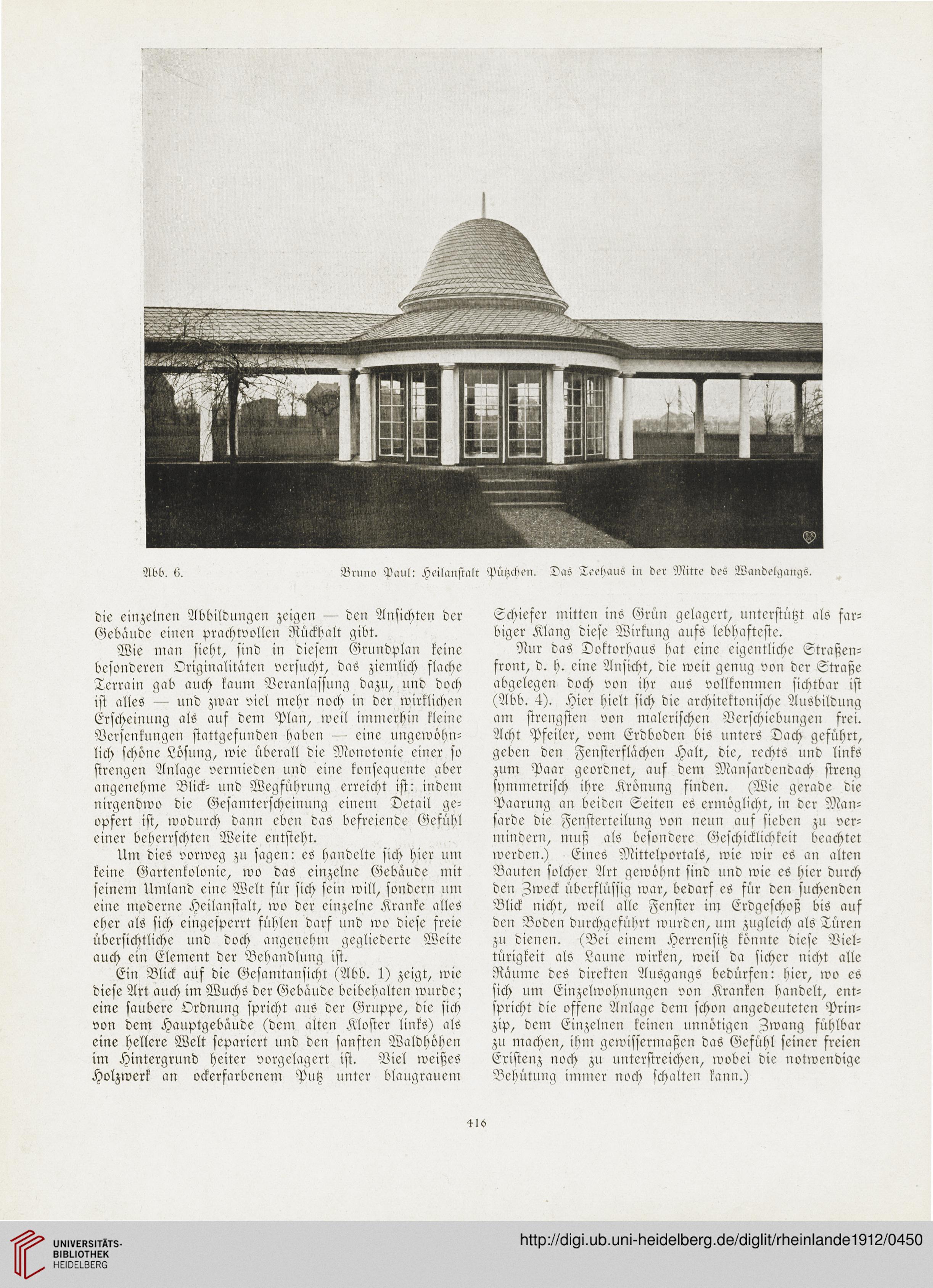Verband der Kunstfreunde in den Ländern am Rhein [Hrsg.]
Die Rheinlande: Vierteljahrsschr. d. Verbandes der Kunstfreunde in den Ländern am Rhein
— 22.1912
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.26494#0450
DOI Heft:
Heft 12
DOI Artikel:Gischler, W.: Die Neubauten der Heilanstalt Pützchen: erstellt von Bruno Paul
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26494#0450
Abb. 6.
Bruno Paul: Heilanstalt Pützchen. Das Teehaus in der Mitte des Wandelgangs.
die einzelnen Abbildungen zeigen — den Ansichten der
Gebaude einen prachwollen Rückhalt gibt.
Wie man sieht, sind in diesem Grundplan keine
besonderen Originalitaten versucht, das ziemlich flache
Terrain gab auch kaum Veranlassung dazu, und doch
ist alles — und zwar viel mehr noch in der wirklichen
Erscheinung als auf dem Plan, weil immerhin kleine
Versenkungen stattgefunden haben — eine ungewöhn-
lich schöne Lösung, wie überall die Monvtonie ciner sv
strengen Anlage vermieden und eine konsequente aber
angenehme Blick- und Wegführung erreicht ist: indem
nirgendwo die Gesamterscheinung einem Detail ge-
opfert ist, wodurch dann eben das befreiende Gefühl
einer beherrschten Weite entstcht.
Um dies vorweg zu sagen: es handelte sich hier um
keine Gartenkolonie, wo das einzelne Gebäude mit
seinem Umland eine Welt für sich sein will, sondern um
eine moderne Heilanstalt, wo der einzelne Kranke alles
eher als sich eingesperrt fühlen darf und wo diesc freie
übersichtliche und doch angenehni gegliederte Weite
auch ein Element der Behandlung ist.
Ein Blick auf die Gesamtansicht (Abb. 1) zeigt, wie
diese Art auch im Wuchs der Gebäude beibehalten wurde;
eine saubere Ordnung spricht aus der Gruppe, die sich
von dem Hauptgebäude (dem altcn Kloster links) als
eine hellere Welt separiert und den sanften Waldhöhen
im Hintergrund heiter vorgelagert ist. Viel weißes
Holzwerk an ockerfarbenem Putz unter blaugrauem
Schiefer mitten ins Grün gelagert, unterstützt als far-
biger Klang diese Wirkung aufs lebhafteste.
Nur das Doktorhaus hat eine eigentliche Straßen-
front, d. h. eine Ansicht, die weit genug von der Straße
abgelegen doch von ihr aus vollkommen sichtbar ist
(Abb. 4). Hier hielt sich die architektonische Ausbildung
am strengsten von malerischen Verschiebungen frei.
Acht Pfeiler, vom Erdboden bis unters Dach geführt,
geben den Fensterflächen Halt, die, rcchts und links
zum Paar gcordnct, auf dem Mansardendach streng
fymmetrisch ihre Krönung finden. (Wie gerade die
Paarung an beiden Seiten es ermöglicht, in der Man-
sarde die Fensterteilung von neun auf sieben zu ver-
mindern, muß als besondere Geschicklichkeit beachtet
werden.) Eines Mittelportals, wie wir es an alten
Bauten solcher Art gewöhnt sind und wie es hier durch
den Aweck überflüssig war, bedarf es für den suchenden
Blick nicht, weil alle Fenster im Erdgeschoß bis auf
den Boden durchgeführt wurden, um zugleich als Türen
zu dienen. (Bei einem Herrensitz könnte diese Viel-
türigkeit als Laune wirken, weil da sicher nicht alle
Räume des direkten Ausgangs bedürfen: hier, wo es
sich um Einzelwohnungen von Kranken handelt, ent-
spricht die offene Anlage dem schon angedeuteten Prin-
zip, dem Einzelnen keinen unnötigen Awang fühlbar
zu machen, ihm gewissermaßen das Gefühl seiner freien
Eristenz noch zu unterstreichen, wobei die notwendige
Behütung immer noch schalten kann.)
Bruno Paul: Heilanstalt Pützchen. Das Teehaus in der Mitte des Wandelgangs.
die einzelnen Abbildungen zeigen — den Ansichten der
Gebaude einen prachwollen Rückhalt gibt.
Wie man sieht, sind in diesem Grundplan keine
besonderen Originalitaten versucht, das ziemlich flache
Terrain gab auch kaum Veranlassung dazu, und doch
ist alles — und zwar viel mehr noch in der wirklichen
Erscheinung als auf dem Plan, weil immerhin kleine
Versenkungen stattgefunden haben — eine ungewöhn-
lich schöne Lösung, wie überall die Monvtonie ciner sv
strengen Anlage vermieden und eine konsequente aber
angenehme Blick- und Wegführung erreicht ist: indem
nirgendwo die Gesamterscheinung einem Detail ge-
opfert ist, wodurch dann eben das befreiende Gefühl
einer beherrschten Weite entstcht.
Um dies vorweg zu sagen: es handelte sich hier um
keine Gartenkolonie, wo das einzelne Gebäude mit
seinem Umland eine Welt für sich sein will, sondern um
eine moderne Heilanstalt, wo der einzelne Kranke alles
eher als sich eingesperrt fühlen darf und wo diesc freie
übersichtliche und doch angenehni gegliederte Weite
auch ein Element der Behandlung ist.
Ein Blick auf die Gesamtansicht (Abb. 1) zeigt, wie
diese Art auch im Wuchs der Gebäude beibehalten wurde;
eine saubere Ordnung spricht aus der Gruppe, die sich
von dem Hauptgebäude (dem altcn Kloster links) als
eine hellere Welt separiert und den sanften Waldhöhen
im Hintergrund heiter vorgelagert ist. Viel weißes
Holzwerk an ockerfarbenem Putz unter blaugrauem
Schiefer mitten ins Grün gelagert, unterstützt als far-
biger Klang diese Wirkung aufs lebhafteste.
Nur das Doktorhaus hat eine eigentliche Straßen-
front, d. h. eine Ansicht, die weit genug von der Straße
abgelegen doch von ihr aus vollkommen sichtbar ist
(Abb. 4). Hier hielt sich die architektonische Ausbildung
am strengsten von malerischen Verschiebungen frei.
Acht Pfeiler, vom Erdboden bis unters Dach geführt,
geben den Fensterflächen Halt, die, rcchts und links
zum Paar gcordnct, auf dem Mansardendach streng
fymmetrisch ihre Krönung finden. (Wie gerade die
Paarung an beiden Seiten es ermöglicht, in der Man-
sarde die Fensterteilung von neun auf sieben zu ver-
mindern, muß als besondere Geschicklichkeit beachtet
werden.) Eines Mittelportals, wie wir es an alten
Bauten solcher Art gewöhnt sind und wie es hier durch
den Aweck überflüssig war, bedarf es für den suchenden
Blick nicht, weil alle Fenster im Erdgeschoß bis auf
den Boden durchgeführt wurden, um zugleich als Türen
zu dienen. (Bei einem Herrensitz könnte diese Viel-
türigkeit als Laune wirken, weil da sicher nicht alle
Räume des direkten Ausgangs bedürfen: hier, wo es
sich um Einzelwohnungen von Kranken handelt, ent-
spricht die offene Anlage dem schon angedeuteten Prin-
zip, dem Einzelnen keinen unnötigen Awang fühlbar
zu machen, ihm gewissermaßen das Gefühl seiner freien
Eristenz noch zu unterstreichen, wobei die notwendige
Behütung immer noch schalten kann.)