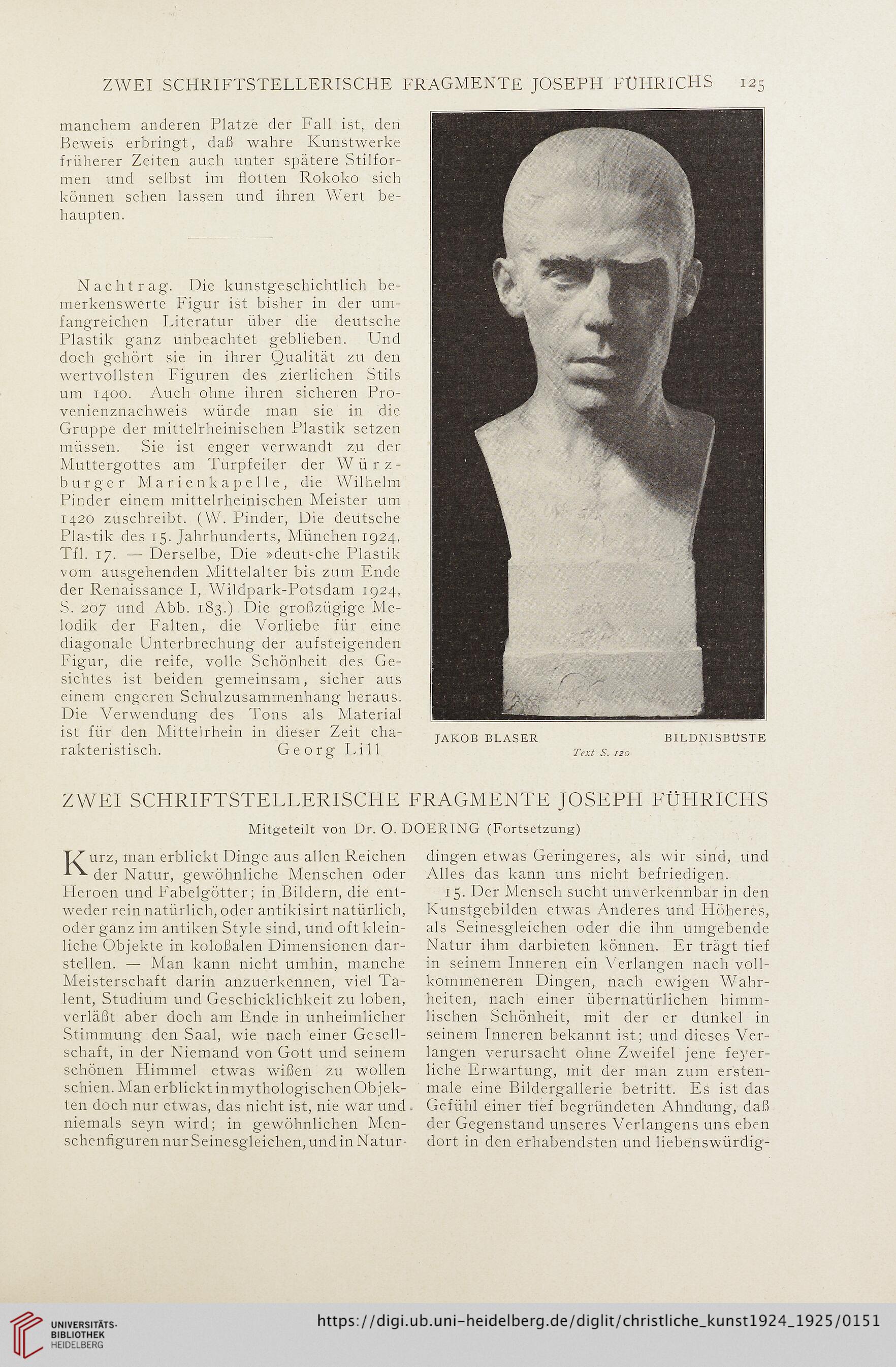ZWEI SCHRIFTSTELLERISCHE FRAGMENTE JOSEPH FÜHRICHS
125
manchem anderen Platze der Fall ist, den
Beweis erbringt, daß wahre Kunstwerke
früherer Zeiten auch unter spätere Stilfor-
men und selbst im flotten Rokoko sich
können sehen lassen und ihren Wert be-
haupten.
Nachtrag. Die kunstgeschichtlich be-
merkenswerte Figur ist bisher in der um-
fangreichen Literatur über die deutsche
Plastik ganz unbeachtet geblieben. Und
doch gehört sie in ihrer Qualität zu den
wertvollsten Figuren des zierlichen Stils
um 1400. Auch ohne ihren sicheren Pro-
venienznachweis würde man sie in die
Gruppe der mittelrheinischen Plastik setzen
müssen. Sie ist enger verwandt zu der
Muttergottes am Turpfeiler der Würz-
burger M a r i e n k a p e 11 e , die Wilhelm
Pinder einem mittelrheinischen Meister um
1420 zuschreibt. (W. Pinder, Die deutsche
Plastik des 15. Jahrhunderts, München 1924,
Tfl. 17. —• Derselbe, Die »deutsche Plastik
vom ausgehenden Mittelalter bis zum Ende
der Renaissance I, Wildpark-Potsdam 1924,
S. 207 und Abb. 183.) Die großzügige Me-
lodik der Falten, die Vorliebe für eine
diagonale Unterbrechung der aufsteigenden
Figur, die reife, volle Schönheit des Ge-
sichtes ist beiden gemeinsam, sicher aus
einem engeren Schulzusammenhang heraus.
Die Verwendung des Tons als Material
ist für den Mittelrhein in dieser Zeit cha-
rakteristisch. Georg Lill
JAKOB BLASER BILDNISBUSTE
Text S. 120
ZWEI SCHRIFTSTELLERISCHE FRAGMENTE JOSEPH FÜHRICHS
Mitgeteilt von Dr. O. DOERING (Fortsetzung)
TU urz, man erblickt Dinge aus allen Reichen
der Natur, gewöhnliche Menschen oder
Heroen und Fabelgötter; in Bildern, die ent-
weder rein natürlich, oder antikisirt natürlich,
oder ganz im antiken Style sind, und oft klein-
liche Objekte in koloßalen Dimensionen dar-
stellen. — Man kann nicht umhin, manche
Meisterschaft darin anzuerkennen, viel Ta-
lent, Studium und Geschicklichkeit zu loben,
verläßt aber doch am Ende in unheimlicher
Stimmung den Saal, wie nach einer Gesell-
schaft, in der Niemand von Gott und seinem
schönen Himmel etwas wißen zu wollen
schien. Man erblickt in mythologischen Objek-
ten doch nur etwas, das nicht ist, nie war und
niemals seyn wird; in gewöhnlichen Men-
schenfiguren nur Seinesgleichen, und in Natur-
dingen etwas Geringeres, als wir sind, und
Alles das kann uns nicht befriedigen.
15. Der Mensch sucht unverkennbar in den
Kunstgebilden etwas Anderes und Höheres,
als Seinesgleichen oder die ihn umgebende
Natur ihm darbieten können. Er trägt tief
in seinem Inneren ein Verlangen nach voll-
kommeneren Dingen, nach ewigen Wahr-
heiten, nach einer übernatürlichen himm-
lischen Schönheit, mit der er dunkel in
seinem Inneren bekannt ist; und dieses Ver-
langen verursacht ohne Zweifel jene feyer-
liche Erwartung, mit der man zum ersten-
male eine Bildergallerie betritt. Es ist das
Gefühl einer tief begründeten Ahndung, daß
der Gegenstand unseres Verlangens uns eben
dort in den erhabendsten und liebenswürdig-
125
manchem anderen Platze der Fall ist, den
Beweis erbringt, daß wahre Kunstwerke
früherer Zeiten auch unter spätere Stilfor-
men und selbst im flotten Rokoko sich
können sehen lassen und ihren Wert be-
haupten.
Nachtrag. Die kunstgeschichtlich be-
merkenswerte Figur ist bisher in der um-
fangreichen Literatur über die deutsche
Plastik ganz unbeachtet geblieben. Und
doch gehört sie in ihrer Qualität zu den
wertvollsten Figuren des zierlichen Stils
um 1400. Auch ohne ihren sicheren Pro-
venienznachweis würde man sie in die
Gruppe der mittelrheinischen Plastik setzen
müssen. Sie ist enger verwandt zu der
Muttergottes am Turpfeiler der Würz-
burger M a r i e n k a p e 11 e , die Wilhelm
Pinder einem mittelrheinischen Meister um
1420 zuschreibt. (W. Pinder, Die deutsche
Plastik des 15. Jahrhunderts, München 1924,
Tfl. 17. —• Derselbe, Die »deutsche Plastik
vom ausgehenden Mittelalter bis zum Ende
der Renaissance I, Wildpark-Potsdam 1924,
S. 207 und Abb. 183.) Die großzügige Me-
lodik der Falten, die Vorliebe für eine
diagonale Unterbrechung der aufsteigenden
Figur, die reife, volle Schönheit des Ge-
sichtes ist beiden gemeinsam, sicher aus
einem engeren Schulzusammenhang heraus.
Die Verwendung des Tons als Material
ist für den Mittelrhein in dieser Zeit cha-
rakteristisch. Georg Lill
JAKOB BLASER BILDNISBUSTE
Text S. 120
ZWEI SCHRIFTSTELLERISCHE FRAGMENTE JOSEPH FÜHRICHS
Mitgeteilt von Dr. O. DOERING (Fortsetzung)
TU urz, man erblickt Dinge aus allen Reichen
der Natur, gewöhnliche Menschen oder
Heroen und Fabelgötter; in Bildern, die ent-
weder rein natürlich, oder antikisirt natürlich,
oder ganz im antiken Style sind, und oft klein-
liche Objekte in koloßalen Dimensionen dar-
stellen. — Man kann nicht umhin, manche
Meisterschaft darin anzuerkennen, viel Ta-
lent, Studium und Geschicklichkeit zu loben,
verläßt aber doch am Ende in unheimlicher
Stimmung den Saal, wie nach einer Gesell-
schaft, in der Niemand von Gott und seinem
schönen Himmel etwas wißen zu wollen
schien. Man erblickt in mythologischen Objek-
ten doch nur etwas, das nicht ist, nie war und
niemals seyn wird; in gewöhnlichen Men-
schenfiguren nur Seinesgleichen, und in Natur-
dingen etwas Geringeres, als wir sind, und
Alles das kann uns nicht befriedigen.
15. Der Mensch sucht unverkennbar in den
Kunstgebilden etwas Anderes und Höheres,
als Seinesgleichen oder die ihn umgebende
Natur ihm darbieten können. Er trägt tief
in seinem Inneren ein Verlangen nach voll-
kommeneren Dingen, nach ewigen Wahr-
heiten, nach einer übernatürlichen himm-
lischen Schönheit, mit der er dunkel in
seinem Inneren bekannt ist; und dieses Ver-
langen verursacht ohne Zweifel jene feyer-
liche Erwartung, mit der man zum ersten-
male eine Bildergallerie betritt. Es ist das
Gefühl einer tief begründeten Ahndung, daß
der Gegenstand unseres Verlangens uns eben
dort in den erhabendsten und liebenswürdig-