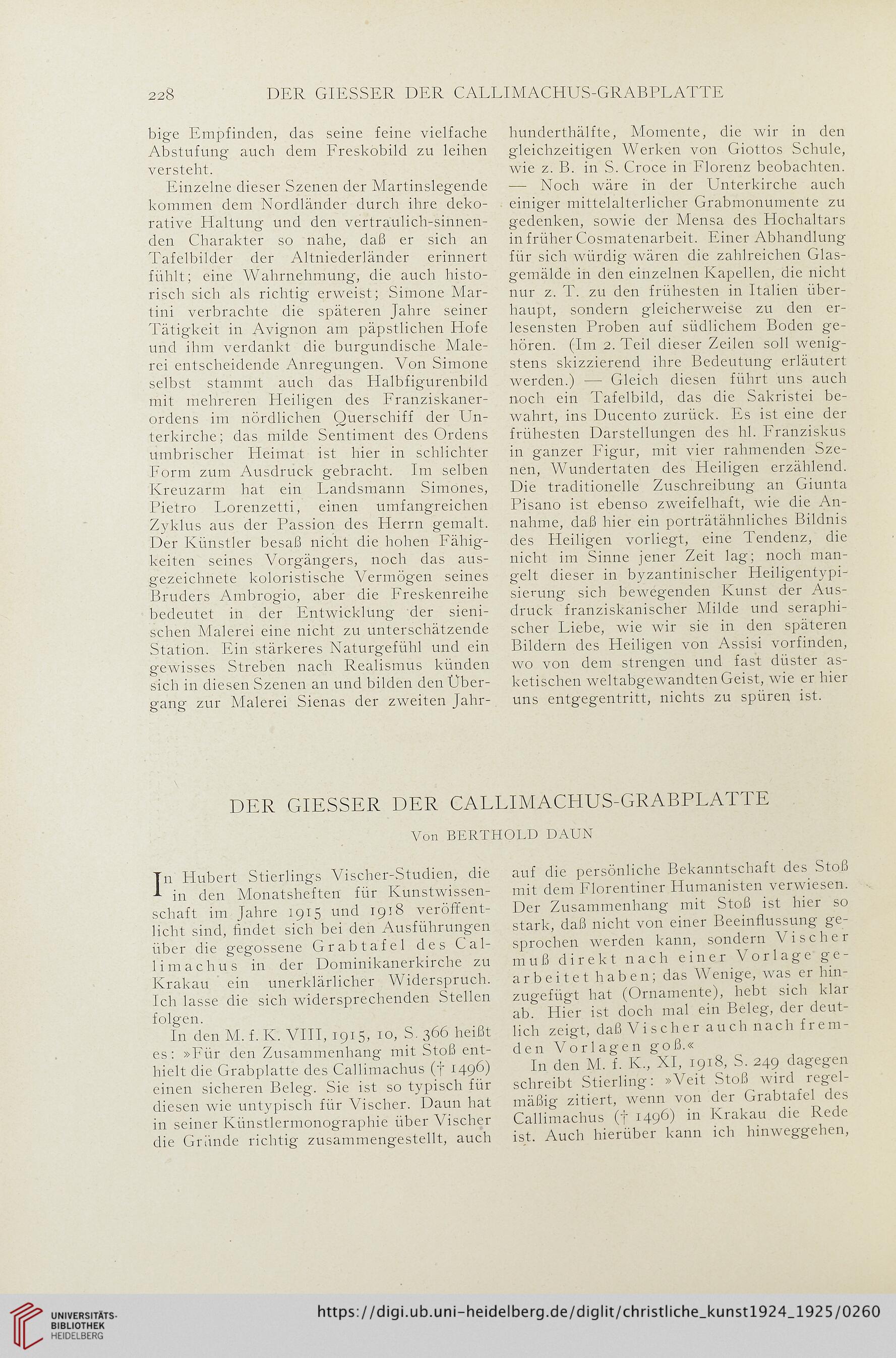228
DER GIESSER DER CALLIMACHUS-GRABPLATTE
bige Empfinden, das seine feine vielfache
Abstufung auch dem Fresköbild zu leihen
versteht.
Einzelne dieser Szenen der Martinslegende
kommen dem Nordländer durch ihre deko-
rative Haltung und den vertraulich-sinnen-
den Charakter so nahe, daß er sich an
Tafelbilder der Altniederländer erinnert
fühlt; eine Wahrnehmung, die auch histo-
risch sich als richtig erweist; Simone Mar-
tini verbrachte die späteren Jahre seiner
Tätigkeit in Avignon am päpstlichen Hofe
und ihm verdankt die burgundische Male-
rei entscheidende Anregungen. Von Simone
selbst stammt auch das Halbfigurenbild
mit mehreren Heiligen des Franziskaner-
ordens im nördlichen Querschiff der Un-
terkirche; das milde Sentiment des Ordens
umbrischer Heimat ist hier in schlichter
Form zum Ausdruck gebracht. Im selben
Kreuzarm hat ein Landsmann Simones,
Pietro Lorenzetti, einen umfangreichen
Zyklus aus der Passion des Herrn gemalt.
Der Künstler besaß nicht die hohen Fähig-
keiten seines Vorgängers, noch das aus-
gezeichnete koloristische Vermögen seines
Bruders Ambrogio, aber die Freskenreihe
bedeutet in der Entwicklung der sieni-
schen Malerei eine nicht zu unterschätzende
Station. Ein stärkeres Naturgefühl und ein
gewisses Streben nach Realismus künden
sich in diesen Szenen an und bilden den Über-
gang zur Malerei Sienas der zweiten Jahr-
hunderthälfte, Momente, die wir in den
gleichzeitigen Werken von Giottos Schule,
wie z. B. in S. Croce in Florenz beobachten.
— Noch wäre in der Unterkirche auch
einiger mittelalterlicher Grabmonumente zu
gedenken, sowie der Mensa des Hochaltars
in früher Cosmatenarbeit. Einer Abhandlung
für sich würdig wären die zahlreichen Glas-
gemälde in den einzelnen Kapellen, die nicht
nur z. T. zu den frühesten in Italien über-
haupt, sondern gleicherweise zu den er-
lesensten Proben auf südlichem Boden ge-
hören. (Im 2. Teil dieser Zeilen soll wenig-
stens skizzierend ihre Bedeutung erläutert
werden.) — Gleich diesen führt uns auch
noch ein Tafelbild, das die Sakristei be-
wahrt, ins Ducento zurück. Es ist eine der
frühesten Darstellungen des hl. Franziskus
in ganzer Figur, mit vier rahmenden Sze-
nen, Wundertaten des Heiligen erzählend.
Die traditionelle Zuschreibung an Giunta
Pisano ist ebenso zweifelhaft, wie die An-
nahme, daß hier ein porträtähnliches Bildnis
des Heiligen vorliegt, eine Tendenz, die
nicht im Sinne jener Zeit lag; noch man-
gelt dieser in byzantinischer Heiligentypi-
sierung sich bewegenden Kunst der Aus-
druck franziskanischer Milde und seraphi-
scher Liebe, wie wir sie in den späteren
Bildern des Heiligen von Assisi vorfinden,
wo von dem strengen und fast düster as-
ketischen weltabgewandten Geist, wie er hier
uns entgegentritt, nichts zu spüren ist.
DER GIESSER DER CALLIMACHUS-GRABPLATTE
Von BERTHOLD DAUN
In Hubert Stierlings Vischer-Studien, die
in den Monatsheften für Kunstwissen-
schaft im Jahre 1915 und 1918 veröffent-
licht sind, findet sich bei den Ausführungen
über die gegossene Grabtafel des Gal-
li machus in der Dominikanerkirche zu
Krakau ein unerklärlicher Widerspruch.
Ich lasse die sich widersprechenden Stellen
folgen.
In denM. f.K. VIII, 1915, 10, S. 366 heißt
es: »Für den Zusammenhang mit Stoß ent-
hielt die Grabplatte des Callimachus (f 1496)
einen sicheren Beleg. Sie ist so typisch für
diesen wie untypisch für Vischer. Daun hat
in seiner Künstlermonographie über Vischer
die Gründe richtig zusammengestellt, auch
auf die persönliche Bekanntschaft des Stoß
mit dem Florentiner Humanisten verwiesen.
Der Zusammenhang mit Stoß ist hier so
stark, daß nicht von einer Beeinflussung ge-
sprochen werden kann, sondern Vi scher
muß direkt nach einer Vorlage ge-
arbeitethaben; das Wenige, was er hin-
zugefügt hat (Ornamente), hebt sich klar
ab. Hier ist doch mal ein Beleg, der deut-
lich zeigt, daß Vischer auch nach frem-
den Vorlagen goß.«
In den M. f. K., XI, 1918, S. 249 dagegen
schreibt Stierling: »Veit Stoß wird regel-
mäßig zitiert, wenn von der Grabtafel des
Callimachus (f 1496) in Krakau die Rede
ist. Auch hierüber kann ich hinweggehen,
DER GIESSER DER CALLIMACHUS-GRABPLATTE
bige Empfinden, das seine feine vielfache
Abstufung auch dem Fresköbild zu leihen
versteht.
Einzelne dieser Szenen der Martinslegende
kommen dem Nordländer durch ihre deko-
rative Haltung und den vertraulich-sinnen-
den Charakter so nahe, daß er sich an
Tafelbilder der Altniederländer erinnert
fühlt; eine Wahrnehmung, die auch histo-
risch sich als richtig erweist; Simone Mar-
tini verbrachte die späteren Jahre seiner
Tätigkeit in Avignon am päpstlichen Hofe
und ihm verdankt die burgundische Male-
rei entscheidende Anregungen. Von Simone
selbst stammt auch das Halbfigurenbild
mit mehreren Heiligen des Franziskaner-
ordens im nördlichen Querschiff der Un-
terkirche; das milde Sentiment des Ordens
umbrischer Heimat ist hier in schlichter
Form zum Ausdruck gebracht. Im selben
Kreuzarm hat ein Landsmann Simones,
Pietro Lorenzetti, einen umfangreichen
Zyklus aus der Passion des Herrn gemalt.
Der Künstler besaß nicht die hohen Fähig-
keiten seines Vorgängers, noch das aus-
gezeichnete koloristische Vermögen seines
Bruders Ambrogio, aber die Freskenreihe
bedeutet in der Entwicklung der sieni-
schen Malerei eine nicht zu unterschätzende
Station. Ein stärkeres Naturgefühl und ein
gewisses Streben nach Realismus künden
sich in diesen Szenen an und bilden den Über-
gang zur Malerei Sienas der zweiten Jahr-
hunderthälfte, Momente, die wir in den
gleichzeitigen Werken von Giottos Schule,
wie z. B. in S. Croce in Florenz beobachten.
— Noch wäre in der Unterkirche auch
einiger mittelalterlicher Grabmonumente zu
gedenken, sowie der Mensa des Hochaltars
in früher Cosmatenarbeit. Einer Abhandlung
für sich würdig wären die zahlreichen Glas-
gemälde in den einzelnen Kapellen, die nicht
nur z. T. zu den frühesten in Italien über-
haupt, sondern gleicherweise zu den er-
lesensten Proben auf südlichem Boden ge-
hören. (Im 2. Teil dieser Zeilen soll wenig-
stens skizzierend ihre Bedeutung erläutert
werden.) — Gleich diesen führt uns auch
noch ein Tafelbild, das die Sakristei be-
wahrt, ins Ducento zurück. Es ist eine der
frühesten Darstellungen des hl. Franziskus
in ganzer Figur, mit vier rahmenden Sze-
nen, Wundertaten des Heiligen erzählend.
Die traditionelle Zuschreibung an Giunta
Pisano ist ebenso zweifelhaft, wie die An-
nahme, daß hier ein porträtähnliches Bildnis
des Heiligen vorliegt, eine Tendenz, die
nicht im Sinne jener Zeit lag; noch man-
gelt dieser in byzantinischer Heiligentypi-
sierung sich bewegenden Kunst der Aus-
druck franziskanischer Milde und seraphi-
scher Liebe, wie wir sie in den späteren
Bildern des Heiligen von Assisi vorfinden,
wo von dem strengen und fast düster as-
ketischen weltabgewandten Geist, wie er hier
uns entgegentritt, nichts zu spüren ist.
DER GIESSER DER CALLIMACHUS-GRABPLATTE
Von BERTHOLD DAUN
In Hubert Stierlings Vischer-Studien, die
in den Monatsheften für Kunstwissen-
schaft im Jahre 1915 und 1918 veröffent-
licht sind, findet sich bei den Ausführungen
über die gegossene Grabtafel des Gal-
li machus in der Dominikanerkirche zu
Krakau ein unerklärlicher Widerspruch.
Ich lasse die sich widersprechenden Stellen
folgen.
In denM. f.K. VIII, 1915, 10, S. 366 heißt
es: »Für den Zusammenhang mit Stoß ent-
hielt die Grabplatte des Callimachus (f 1496)
einen sicheren Beleg. Sie ist so typisch für
diesen wie untypisch für Vischer. Daun hat
in seiner Künstlermonographie über Vischer
die Gründe richtig zusammengestellt, auch
auf die persönliche Bekanntschaft des Stoß
mit dem Florentiner Humanisten verwiesen.
Der Zusammenhang mit Stoß ist hier so
stark, daß nicht von einer Beeinflussung ge-
sprochen werden kann, sondern Vi scher
muß direkt nach einer Vorlage ge-
arbeitethaben; das Wenige, was er hin-
zugefügt hat (Ornamente), hebt sich klar
ab. Hier ist doch mal ein Beleg, der deut-
lich zeigt, daß Vischer auch nach frem-
den Vorlagen goß.«
In den M. f. K., XI, 1918, S. 249 dagegen
schreibt Stierling: »Veit Stoß wird regel-
mäßig zitiert, wenn von der Grabtafel des
Callimachus (f 1496) in Krakau die Rede
ist. Auch hierüber kann ich hinweggehen,