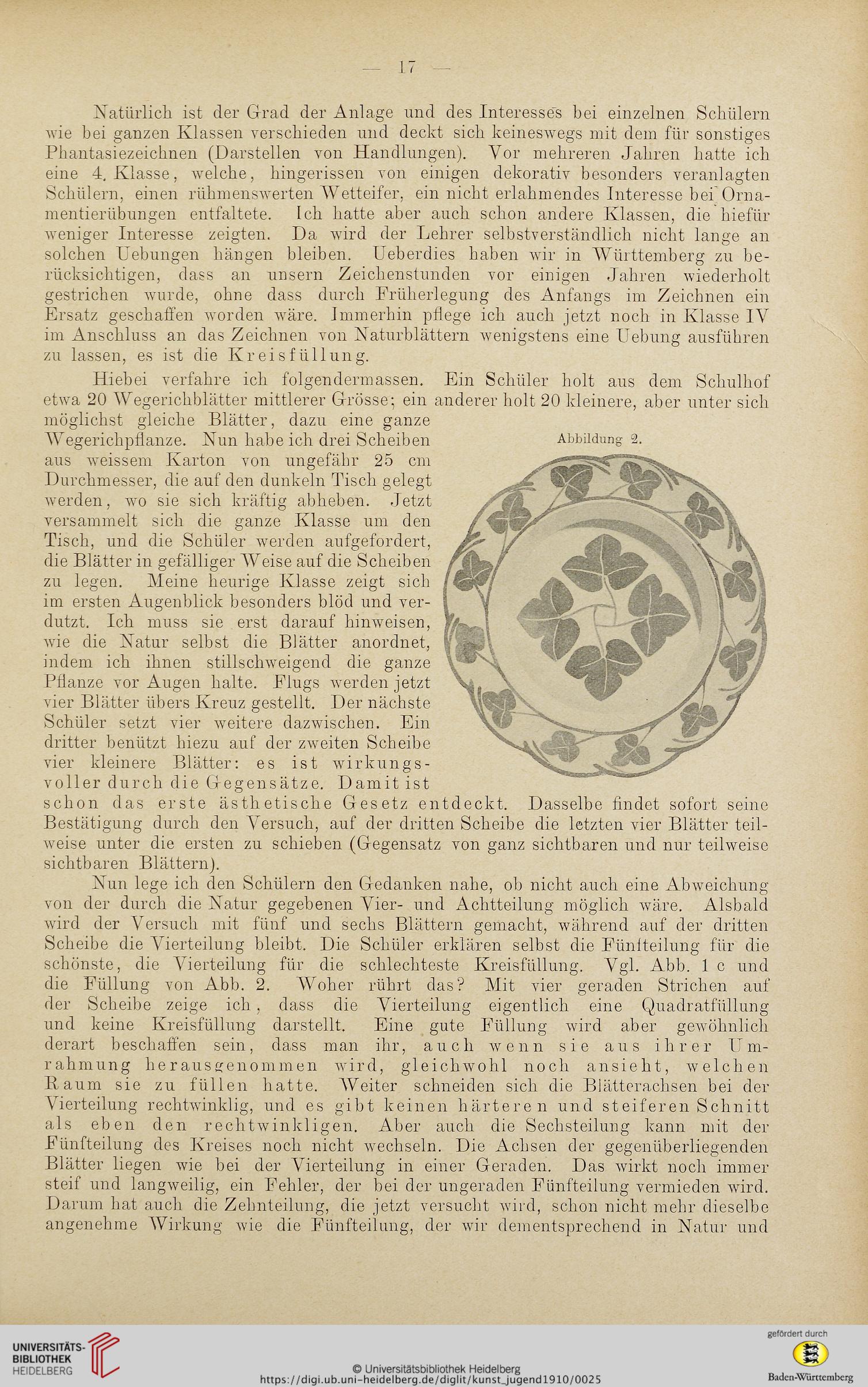Natürlich ist der Grad der Anlage und des Interesse’s bei einzelnen Schülern
wie bei ganzen Klassen verschieden und deckt sich keineswegs mit dem für sonstiges
Phantasiezeichnen (Darstellen von Handlungen). Vor mehreren Jahren hatte ich
eine 4. Klasse, welche, hingerissen von einigen dekorativ besonders veranlagten
Schülern, einen rühmenswerten Wetteifer, ein nicht erlahmendes Interesse bei Orna-
mentierübungen entfaltete. Ich hatte aber auch schon andere Klassen, die hiefür
weniger Interesse zeigten. Da wird der Lehrer selbstverständlich nicht lange an
solchen Hebungen hängen bleiben. Ueberdies haben wir in Württemberg zu be-
rücksichtigen, dass an unsern Zeichenstunden vor einigen Jahren wiederholt
gestrichen wurde, ohne dass durch Früherlegung des Anfangs im Zeichnen ein
Ersatz geschaffen worden wäre. Immerhin pflege ich auch jetzt noch in Klasse IV
im Anschluss an das Zeichnen von Naturblättern wenigstens eine Uebung ausführen
zu lassen, es ist die Kreisfüllung.
Hiebei verfahre ich folgendermassen. Ein Schüler holt aus dem Schulhof
etwa 20 Wegerichblätter mittlerer Grösse; ein anderer holt 20 kleinere, aber unter sich
möglichst gleiche Blätter, dazu eine ganze
Wegerichpflanze. Nun habe ich drei Scheiben
aus weissem Karton von ungefähr 25 cm
Durchmesser, die auf den dunkeln Tisch gelegt
werden, wo sie sich kräftig abheben. Jetzt
versammelt sich die ganze Klasse um den
Tisch, und die Schüler werden aufgefordert,
die Blätter in gefälliger Weise auf die Scheiben
zu legen. Meine heurige Klasse zeigt sich
im ersten Augenblick besonders blöd und ver¬
dutzt. Ich muss sie erst darauf hinweisen,
wie die Natur selbst die Blätter anordnet,
indem ich ihnen stillschweigend die ganze
Pflanze vor Augen halte. Flugs werden jetzt
vier Blätter übers Kreuz gestellt. Der nächste
Schüler setzt vier weitere dazwischen. Ein
dritter benützt hiezu auf der zweiten Scheibe
vier kleinere Blätter: es ist wirkungs¬
voller durch die Gegensätze. Damit ist
schon das erste ästhetische Gesetz entdeckt. Dasselbe findet sofort seine
Bestätigung durch den Versuch, auf der dritten Scheibe die letzten vier Blätter teil-
weise unter die ersten zu schieben (Gegensatz von ganz sichtbaren und nur teilweise
sichtbaren Blättern).
Nun lege ich den Schülern den Gedanken nahe, ob nicht auch eine Abweichung
von der durch die Natur gegebenen Vier- und Achtteilung möglich wäre. Alsbald
wird der Versuch mit fünf und sechs Blättern gemacht, während auf der dritten
Scheibe die Vierteilung bleibt. Die Schüler erklären selbst die Fünfteilung für die
schönste, die Vierteilung für die schlechteste Kreisfüllung. Vgl. Abb. 1 c und
die Füllung von Abb. 2. Woher rührt das? Mit vier geraden Strichen auf
der Scheibe zeige ich , dass die Vierteilung eigentlich eine Quadratfüllung
und keine Kreisfüllung darstellt. Eine gute Füllung wird aber gewöhnlich
derart beschaffen sein, dass man ihr, auch wenn sie aus ihrer Um-
rahmung he raus genommen wird, gleichwohl noch ansieht, welchen
Kaum sie zu füllen hatte. Weiter schneiden sich die Blätterachsen bei der
Vierteilung rechtwinklig, und es gibt keinen härteren und steiferen Schnitt
als eben den rechtwinkligen. Aber auch die Sechsteilung kann mit der
Fünfteilung des Kreises noch nicht wechseln. Die Achsen der gegenüberliegenden
Blätter liegen wie bei der Vierteilung in einer Geraden. Das wirkt noch immer
steif und langweilig, ein Fehler, der bei der ungeraden Fünfteilung vermieden wird.
Darum hat auch die Zehnteilung, die jetzt versucht wird, schon nicht mehr dieselbe
angenehme Wirkung wie die Fünfteilung, der wir dementsprechend in Natur und
Abbildung 2.
wie bei ganzen Klassen verschieden und deckt sich keineswegs mit dem für sonstiges
Phantasiezeichnen (Darstellen von Handlungen). Vor mehreren Jahren hatte ich
eine 4. Klasse, welche, hingerissen von einigen dekorativ besonders veranlagten
Schülern, einen rühmenswerten Wetteifer, ein nicht erlahmendes Interesse bei Orna-
mentierübungen entfaltete. Ich hatte aber auch schon andere Klassen, die hiefür
weniger Interesse zeigten. Da wird der Lehrer selbstverständlich nicht lange an
solchen Hebungen hängen bleiben. Ueberdies haben wir in Württemberg zu be-
rücksichtigen, dass an unsern Zeichenstunden vor einigen Jahren wiederholt
gestrichen wurde, ohne dass durch Früherlegung des Anfangs im Zeichnen ein
Ersatz geschaffen worden wäre. Immerhin pflege ich auch jetzt noch in Klasse IV
im Anschluss an das Zeichnen von Naturblättern wenigstens eine Uebung ausführen
zu lassen, es ist die Kreisfüllung.
Hiebei verfahre ich folgendermassen. Ein Schüler holt aus dem Schulhof
etwa 20 Wegerichblätter mittlerer Grösse; ein anderer holt 20 kleinere, aber unter sich
möglichst gleiche Blätter, dazu eine ganze
Wegerichpflanze. Nun habe ich drei Scheiben
aus weissem Karton von ungefähr 25 cm
Durchmesser, die auf den dunkeln Tisch gelegt
werden, wo sie sich kräftig abheben. Jetzt
versammelt sich die ganze Klasse um den
Tisch, und die Schüler werden aufgefordert,
die Blätter in gefälliger Weise auf die Scheiben
zu legen. Meine heurige Klasse zeigt sich
im ersten Augenblick besonders blöd und ver¬
dutzt. Ich muss sie erst darauf hinweisen,
wie die Natur selbst die Blätter anordnet,
indem ich ihnen stillschweigend die ganze
Pflanze vor Augen halte. Flugs werden jetzt
vier Blätter übers Kreuz gestellt. Der nächste
Schüler setzt vier weitere dazwischen. Ein
dritter benützt hiezu auf der zweiten Scheibe
vier kleinere Blätter: es ist wirkungs¬
voller durch die Gegensätze. Damit ist
schon das erste ästhetische Gesetz entdeckt. Dasselbe findet sofort seine
Bestätigung durch den Versuch, auf der dritten Scheibe die letzten vier Blätter teil-
weise unter die ersten zu schieben (Gegensatz von ganz sichtbaren und nur teilweise
sichtbaren Blättern).
Nun lege ich den Schülern den Gedanken nahe, ob nicht auch eine Abweichung
von der durch die Natur gegebenen Vier- und Achtteilung möglich wäre. Alsbald
wird der Versuch mit fünf und sechs Blättern gemacht, während auf der dritten
Scheibe die Vierteilung bleibt. Die Schüler erklären selbst die Fünfteilung für die
schönste, die Vierteilung für die schlechteste Kreisfüllung. Vgl. Abb. 1 c und
die Füllung von Abb. 2. Woher rührt das? Mit vier geraden Strichen auf
der Scheibe zeige ich , dass die Vierteilung eigentlich eine Quadratfüllung
und keine Kreisfüllung darstellt. Eine gute Füllung wird aber gewöhnlich
derart beschaffen sein, dass man ihr, auch wenn sie aus ihrer Um-
rahmung he raus genommen wird, gleichwohl noch ansieht, welchen
Kaum sie zu füllen hatte. Weiter schneiden sich die Blätterachsen bei der
Vierteilung rechtwinklig, und es gibt keinen härteren und steiferen Schnitt
als eben den rechtwinkligen. Aber auch die Sechsteilung kann mit der
Fünfteilung des Kreises noch nicht wechseln. Die Achsen der gegenüberliegenden
Blätter liegen wie bei der Vierteilung in einer Geraden. Das wirkt noch immer
steif und langweilig, ein Fehler, der bei der ungeraden Fünfteilung vermieden wird.
Darum hat auch die Zehnteilung, die jetzt versucht wird, schon nicht mehr dieselbe
angenehme Wirkung wie die Fünfteilung, der wir dementsprechend in Natur und
Abbildung 2.