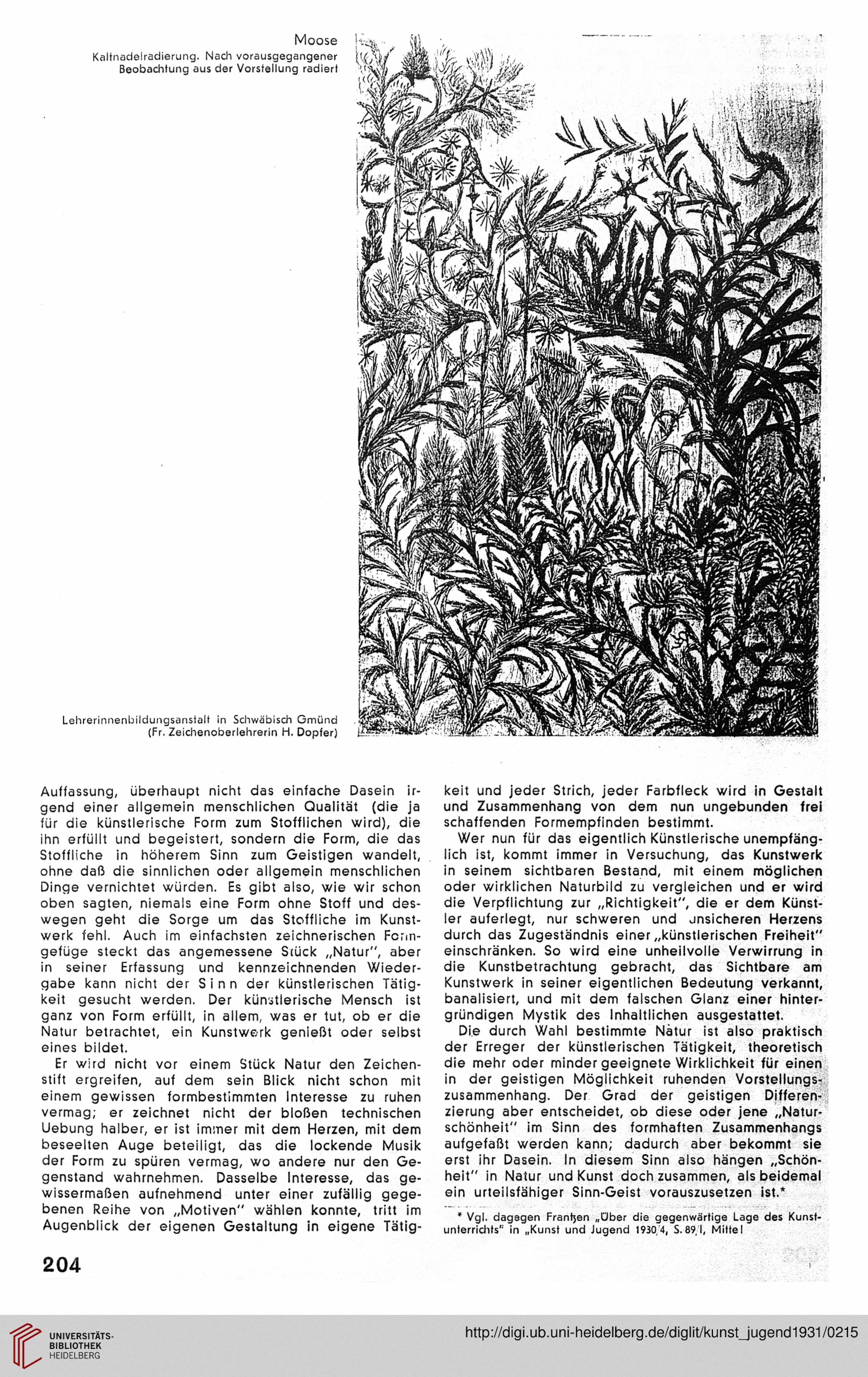Moose
Kaltnadelradierung. Nach vorausgegangener
Beobachtung aus der Vorstellung radiert
Lehrerinnenbildungsanstalt in Schwäbisch Gmünd
(Fr. Zeichenoberlehrerin H. Dopfer)
Auffassung, überhaupt nicht das einfache Dasein ir-
gend einer allgemein menschlichen Qualität (die ja
für die künstlerische Form zum Stofflichen wird), die
ihn erfüllt und begeistert, sondern die Form, die das
Stoffliche in höherem Sinn zum Geistigen wandelt,
ohne daß die sinnlichen oder allgemein menschlichen
Dinge vernichtet würden. Es gibt also, wie wir schon
oben sagten, niemals eine Form ohne Stoff und des-
wegen geht die Sorge um das Stoffliche im Kunst-
werk fehl. Auch im einfachsten zeichnerischen Form-
gefüge steckt das angemessene Stück „Natur", aber
in seiner Erfassung und kennzeichnenden Wieder-
gabe kann nicht der Sinn der künstlerischen Tätig-
keit gesucht werden. Der künstlerische Mensch ist
ganz von Form erfüllt, in allem, was er tut, ob er die
Natur betrachtet, ein Kunstwerk genießt oder selbst
eines bildet.
Er wird nicht vor einem Stück Natur den Zeichen-
stift ergreifen, auf dem sein Blick nicht schon mit
einem gewissen formbestimmten Interesse zu ruhen
vermag; er zeichnet nicht der bloßen technischen
Uebung halber, er ist immer mit dem Herzen, mit dem
beseelten Auge beteiligt, das die lockende Musik
der Form zu spüren vermag, wo andere nur den Ge-
genstand wahrnehmen. Dasselbe Interesse, das ge-
wissermaßen aufnehmend unter einer zufällig gege-
benen Reihe von „Motiven" wählen konnte, tritt im
Augenblick der eigenen Gestaltung in eigene Tätig-
keit und jeder Strich, jeder Farbfleck wird in Gestalt
und Zusammenhang von dem nun ungebunden frei
schaffenden Formempfinden bestimmt.
Wer nun für das eigentlich Künstlerische unempfäng-
lich ist, kommt immer in Versuchung, das Kunstwerk
in seinem sichtbaren Bestand, mit einem möglichen
oder wirklichen Naturbild zu vergleichen und er wird
die Verpflichtung zur „Richtigkeit", die er dem Künst-
ler auferlegt, nur schweren und unsicheren Herzens
durch das Zugeständnis einer „künstlerischen Freiheit"
einschränken. So wird eine unheilvolle Verwirrung in
die Kunstbetrachtung gebracht, das Sichtbare am
Kunstwerk in seiner eigentlichen Bedeutung verkannt,
banalisiert, und mit dem falschen Glanz einer hinter-
gründigen Mystik des Inhaltlichen ausgestattet.
Die durch Wahl bestimmte Natur ist also praktisch
der Erreger der künstlerischen Tätigkeit, theoretisch
die mehr oder minder geeignete Wirklichkeit für einen
in der geistigen Möglichkeit ruhenden Vorstellungs-
zusammenhang. Der Grad der geistigen Differen-
zierung aber entscheidet, ob diese oder jene „Natur-
schönheit" im Sinn des formhaften Zusammenhangs
aufgefaßt werden kann; dadurch aber bekommt sie
erst ihr Dasein. In diesem Sinn also hängen „Schön-
heit" in Natur und Kunst doch zusammen, als beidemal
ein urteilsfähiger Sinn-Geist vorauszusetzen ist.*
* Vgl. dagegen Franken „über die gegenwärtige Lage des Kunst-
unterridits'J in „Kunst und Jugend 1930,4( S.89,1, Mittel
204
Kaltnadelradierung. Nach vorausgegangener
Beobachtung aus der Vorstellung radiert
Lehrerinnenbildungsanstalt in Schwäbisch Gmünd
(Fr. Zeichenoberlehrerin H. Dopfer)
Auffassung, überhaupt nicht das einfache Dasein ir-
gend einer allgemein menschlichen Qualität (die ja
für die künstlerische Form zum Stofflichen wird), die
ihn erfüllt und begeistert, sondern die Form, die das
Stoffliche in höherem Sinn zum Geistigen wandelt,
ohne daß die sinnlichen oder allgemein menschlichen
Dinge vernichtet würden. Es gibt also, wie wir schon
oben sagten, niemals eine Form ohne Stoff und des-
wegen geht die Sorge um das Stoffliche im Kunst-
werk fehl. Auch im einfachsten zeichnerischen Form-
gefüge steckt das angemessene Stück „Natur", aber
in seiner Erfassung und kennzeichnenden Wieder-
gabe kann nicht der Sinn der künstlerischen Tätig-
keit gesucht werden. Der künstlerische Mensch ist
ganz von Form erfüllt, in allem, was er tut, ob er die
Natur betrachtet, ein Kunstwerk genießt oder selbst
eines bildet.
Er wird nicht vor einem Stück Natur den Zeichen-
stift ergreifen, auf dem sein Blick nicht schon mit
einem gewissen formbestimmten Interesse zu ruhen
vermag; er zeichnet nicht der bloßen technischen
Uebung halber, er ist immer mit dem Herzen, mit dem
beseelten Auge beteiligt, das die lockende Musik
der Form zu spüren vermag, wo andere nur den Ge-
genstand wahrnehmen. Dasselbe Interesse, das ge-
wissermaßen aufnehmend unter einer zufällig gege-
benen Reihe von „Motiven" wählen konnte, tritt im
Augenblick der eigenen Gestaltung in eigene Tätig-
keit und jeder Strich, jeder Farbfleck wird in Gestalt
und Zusammenhang von dem nun ungebunden frei
schaffenden Formempfinden bestimmt.
Wer nun für das eigentlich Künstlerische unempfäng-
lich ist, kommt immer in Versuchung, das Kunstwerk
in seinem sichtbaren Bestand, mit einem möglichen
oder wirklichen Naturbild zu vergleichen und er wird
die Verpflichtung zur „Richtigkeit", die er dem Künst-
ler auferlegt, nur schweren und unsicheren Herzens
durch das Zugeständnis einer „künstlerischen Freiheit"
einschränken. So wird eine unheilvolle Verwirrung in
die Kunstbetrachtung gebracht, das Sichtbare am
Kunstwerk in seiner eigentlichen Bedeutung verkannt,
banalisiert, und mit dem falschen Glanz einer hinter-
gründigen Mystik des Inhaltlichen ausgestattet.
Die durch Wahl bestimmte Natur ist also praktisch
der Erreger der künstlerischen Tätigkeit, theoretisch
die mehr oder minder geeignete Wirklichkeit für einen
in der geistigen Möglichkeit ruhenden Vorstellungs-
zusammenhang. Der Grad der geistigen Differen-
zierung aber entscheidet, ob diese oder jene „Natur-
schönheit" im Sinn des formhaften Zusammenhangs
aufgefaßt werden kann; dadurch aber bekommt sie
erst ihr Dasein. In diesem Sinn also hängen „Schön-
heit" in Natur und Kunst doch zusammen, als beidemal
ein urteilsfähiger Sinn-Geist vorauszusetzen ist.*
* Vgl. dagegen Franken „über die gegenwärtige Lage des Kunst-
unterridits'J in „Kunst und Jugend 1930,4( S.89,1, Mittel
204