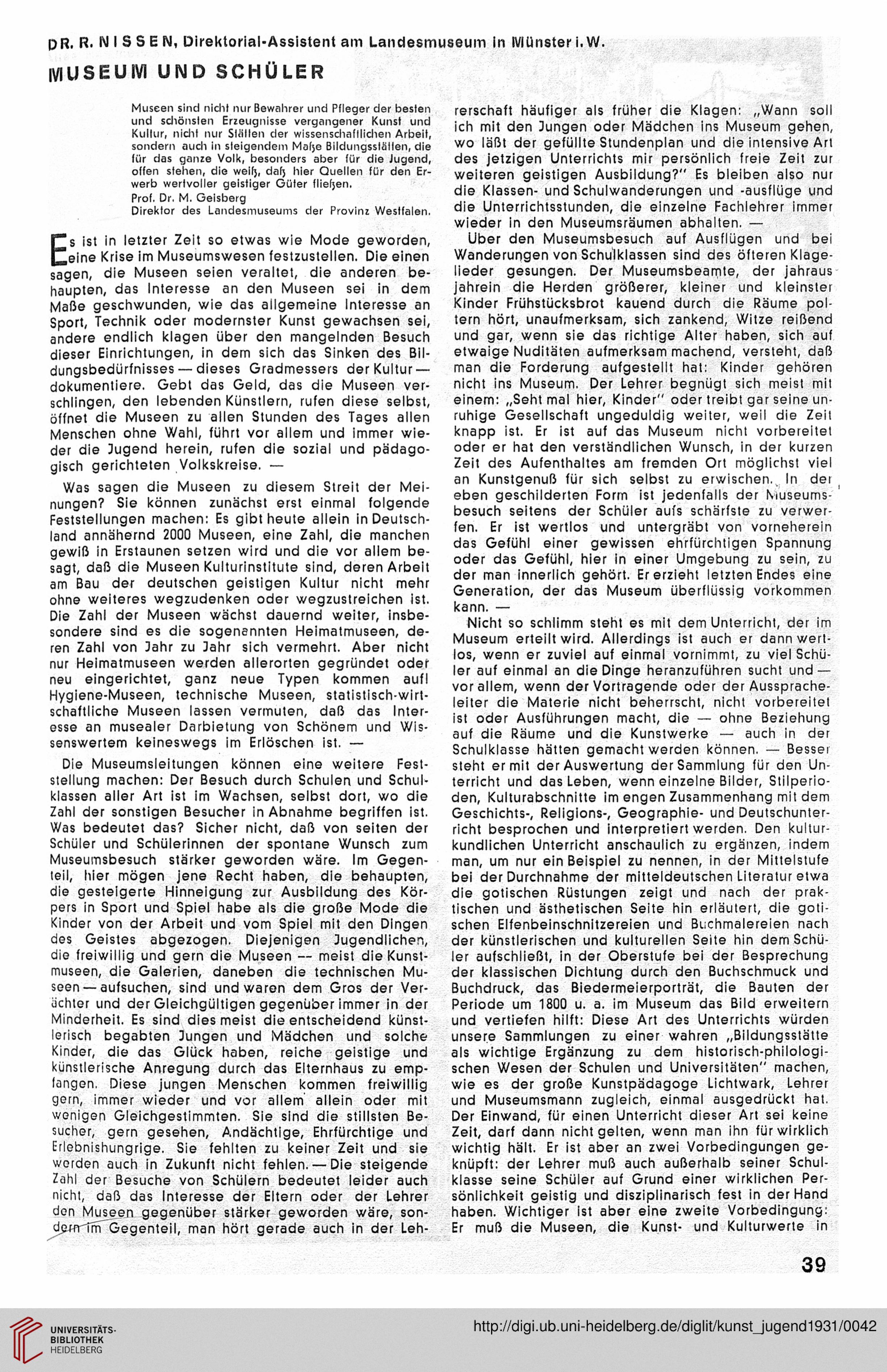DR, R. N I S S E N, Direktorial-Assistent am Landesmuseum in Münster i. W.
MUSEUM UND SCHÜLER
Museen sind nicht nur Bewahrer und Pfleger der besten
und sdiönslen Erzeugnisse vergangener Kunst und
Kultur, nicht nur Ställen der wissenschafllidren Arbeit,
sondern auch in steigendem Malje Bildungsstätten, die
für das ganze Volk, besonders aber für die Jugend,
offen stehen, die weif), daf; hier Quellen für den Er-
werb wertvoller geistiger Güter fliefjen.
Prof, Dr. M. Geisberg
Direktor des Landesmuseums der Provinz Westfalen.
Es ist in letzter Zeit so etwas wie Mode geworden,
eine Krise im Museumswesen festzustellen. Die einen
sagen, die Museen seien veraltet, die anderen be-
haupten, das Interesse an den Museen sei in dem
Maße geschwunden, wie das allgemeine Interesse an
Sport, Technik oder modernster Kunst gewachsen sei,
andere endlich klagen über den mangelnden Besuch
dieser Einrichtungen, in dem sich das Sinken des Bil-
dungsbedürfnisses— dieses Gradmessers der Kultur —
dokumentiere. Gebt das Geld, das die Museen ver-
schlingen, den lebenden Künstlern, rufen diese selbst,
öffnet die Museen zu allen Stunden des Tages allen
Menschen ohne Wahl, führt vor allem und immer wie-
der die Jugend herein, rufen die sozial und pädago-
gisch gerichteten Volkskreise. —
Was sagen die Museen zu diesem Streit der Mei-
nungen? Sie können zunächst erst einmal folgende
Feststellungen machen: Es gibt heute allein in Deutsch-
land annähernd 2000 Museen, eine Zahl, die manchen
gewiß in Erstaunen setzen wird und die vor allem be-
sagt, daß die Museen Kulturinstitute sind, deren Arbeit
am Bau der deutschen geistigen Kultur nicht mehr
ohne weiteres wegzudenken oder wegzustreichen ist.
Die Zahl der Museen wächst dauernd weiter, insbe-
sondere sind es die sogenannten Heimatmuseen, de-
ren Zahl von Jahr zu Jahr sich vermehrt. Aber nicht
nur Heimatmuseen werden allerorten gegründet oder
neu eingerichtet, ganz neue Typen kommen aufl
Hygiene-Museen, technische Museen, statistisch-wirt-
schaftliche Museen lassen vermuten, daß das Inter-
esse an musealer Darbietung von Schönem und Wis-
senswertem keineswegs im Erlöschen ist. —
Die Museumsleitungen können eine weitere Fest-
stellung machen: Der Besuch durch Schulen und Schul-
klassen aller Art ist im Wachsen, selbst dort, wo die
Zahl der sonstigen Besucher in Abnahme begriffen ist.
Was bedeutet das? Sicher nicht, daß von Seiten der
Schüler und Schülerinnen der spontane Wunsch zum
Museuinsbesuch stärker geworden wäre. Im Gegen-
teil, hier mögen jene Recht haben, die behaupten,
die gesteigerte Hinneigung zur Ausbildung des Kör-
pers in Sport und Spiel habe als die große Mode die
Kinder von der Arbeit und vom Spiel mit den Dingen
des Geistes abgezogen. Diejenigen Jugendlichen,
die freiwillig und gern die Museen —- meist die Kunst-
museen, die Galerien, daneben die technischen Mu-
seen—aufsuchen, sind und waren dem Gros der Ver-
ächter und der Gleichgültigen gegenüber immer in der
Minderheit. Es sind dies meist die entscheidend künst-
lerisch begabten Jungen und Mädchen und solche
Kinder, die das Glück haben, reiche geistige und
künstlerische Anregung durch das Elternhaus zu emp-
fangen. Diese jungen Menschen kommen freiwillig
gern, immer wieder und vor allem allein oder mit
wenigen Gleichgestimmten. Sie sind die stillsten Be-
sucher, gern gesehen, Andächtige, Ehrfürchtige und
Erlebnishungrige. Sie fehlten zu keiner Zeit und sie
werden auch in Zukunft nicht fehlen.— Die steigende
Zahl der Besuche von Schülern bedeutet leider auch
nicht, daß das Interesse der Eitern oder der Lehrer
den Museen gegenüber stärker geworden wäre, son-
dpflrlfnGegenteil, man hört gerade auch in der Leh-
rerschaft häufiger als früher die Klagen: „Wann soll
ich mit den Jungen oder Mädchen ins Museum gehen,
wo läßt der gefüllte Stundenplan und die intensive Art
des jetzigen Unterrichts mir persönlich freie Zeit zur
weiteren geistigen Ausbildung?" Es bleiben also nur
die Klassen- und Schulwanderungen und -ausflüge und
die Unterrichtsstunden, die einzelne Fachlehrer immer
wieder in den Museumsräumen abhalten. —
Uber den Museumsbesuch auf Ausflügen und bei
Wanderungen von Schulklassen sind des öfteren Klage-
lieder gesungen. Der Museumsbeamte, der jahraus
jahrein die Herden größerer, kleiner und kleinster
Kinder Frühstücksbrot kauend durch die Räume pol-
tern hört, unaufmerksam, sich zankend, Witze reißend
und gar, wenn sie das richtige Alter haben, sich auf
etwaige Nuditäten aufmerksam machend, versteht, daß
man die Forderung aufgestellt hat: Kinder gehören
nicht ins Museum. Der Lehrer begnügt sich meist mit
einem: „Seht mal hier, Kinder" oder treibt gar seine un-
ruhige Gesellschaft ungeduldig weiter, weil die Zeit
knapp ist. Er ist auf das Museum nicht vorbereitet
oder er hat den verständlichen Wunsch, in der kurzen
Zeit des Aufenthaltes am fremden Ort möglichst viel
an Kunstgenuß für sich selbst zu erwischen. In dei (
eben geschilderten Form ist jedenfalls der Museums-
besuch seitens der Schüler aufs schärfste zu verwer-
fen. Er ist wertlos und untergräbt von vorneherein
das Gefühl einer gewissen ehrfürchtigen Spannung
oder das Gefühl, hier in einer Umgebung zu sein, zu
der man innerlich gehört. Er erzieht letzten Endes eine
Generation, der das Museum überflüssig vorkommen
kann. —
Nicht so schlimm steht es mit dem Unterricht, der im
Museum erteilt wird. Allerdings ist auch er dann wert-
los, wenn er zuviel auf einmal vornimmt, zu viel Schü-
ler auf einmal an die Dinge heranzuführen sucht und-
vor allem, wenn der Vortragende oder der Aussprache-
leiter die Materie nicht beherrscht, nicht vorbereitet
ist oder Ausführungen macht, die — ohne Beziehung
auf die Räume und die Kunstwerke — auch in der
Schulklasse hätten gemacht werden können. — Besser
steht er mit der Auswertung der Sammlung für den Un-
terricht und das Leben, wenn einzelne Bilder, Stilperio-
den, Kulturabschnitte im engen Zusammenhang mildem
Geschichts-, Religions-, Geographie- und Deutschunter-
richt besprochen und interpretiert werden. Den kultur-
kundlichen Unterricht anschaulich zu ergänzen, indem
man, um nur ein Beispiel zu nennen, in der Mittelstufe
bei der Durchnahme der mitteldeutschen Literatur etwa
die gotischen Rüstungen zeigt und nach der prak-
tischen und ästhetischen Seite hin erläutert, die goti-
schen Elfenbeinschnitzereien und Buchmalereien nach
der künstlerischen und kulturellen Seite hin dem Schü-
ler aufschließt, in der Oberstufe bei der Besprechung
der klassischen Dichtung durch den Buchschmuck und
Buchdruck, das Biedermeierporträt, die Bauten der
Periode um 1800 u. a. im Museum das Bild erweitern
und vertiefen hilft: Diese Art des Unterrichts würden
unsere Sammlungen zu einer wahren „Bildungsstätte
als wichtige Ergänzung zu dem historisch-philologi-
schen Wesen der Schulen und Universitäten" machen,
wie es der große Kunstpädagoge Lichtwark, Lehrer
und Museumsmann zugleich, einmal ausgedrückt hat.
Der Einwand, für einen Unterricht dieser Art sei keine
Zeit, darf dann nicht gelten, wenn man ihn für wirklich
wichtig hält. Er ist aber an zwei Vorbedingungen ge-
knüpft: der Lehrer muß auch außerhalb seiner Schul-
klasse seine Schüler auf Grund einer wirklichen Per-
sönlichkeit geistig und disziplinarisch fest in der Hand
haben. Wichtiger ist aber eine zweite Vorbedingung:
Er muß die Museen, die Kunst- und Kulturwerte in
39
MUSEUM UND SCHÜLER
Museen sind nicht nur Bewahrer und Pfleger der besten
und sdiönslen Erzeugnisse vergangener Kunst und
Kultur, nicht nur Ställen der wissenschafllidren Arbeit,
sondern auch in steigendem Malje Bildungsstätten, die
für das ganze Volk, besonders aber für die Jugend,
offen stehen, die weif), daf; hier Quellen für den Er-
werb wertvoller geistiger Güter fliefjen.
Prof, Dr. M. Geisberg
Direktor des Landesmuseums der Provinz Westfalen.
Es ist in letzter Zeit so etwas wie Mode geworden,
eine Krise im Museumswesen festzustellen. Die einen
sagen, die Museen seien veraltet, die anderen be-
haupten, das Interesse an den Museen sei in dem
Maße geschwunden, wie das allgemeine Interesse an
Sport, Technik oder modernster Kunst gewachsen sei,
andere endlich klagen über den mangelnden Besuch
dieser Einrichtungen, in dem sich das Sinken des Bil-
dungsbedürfnisses— dieses Gradmessers der Kultur —
dokumentiere. Gebt das Geld, das die Museen ver-
schlingen, den lebenden Künstlern, rufen diese selbst,
öffnet die Museen zu allen Stunden des Tages allen
Menschen ohne Wahl, führt vor allem und immer wie-
der die Jugend herein, rufen die sozial und pädago-
gisch gerichteten Volkskreise. —
Was sagen die Museen zu diesem Streit der Mei-
nungen? Sie können zunächst erst einmal folgende
Feststellungen machen: Es gibt heute allein in Deutsch-
land annähernd 2000 Museen, eine Zahl, die manchen
gewiß in Erstaunen setzen wird und die vor allem be-
sagt, daß die Museen Kulturinstitute sind, deren Arbeit
am Bau der deutschen geistigen Kultur nicht mehr
ohne weiteres wegzudenken oder wegzustreichen ist.
Die Zahl der Museen wächst dauernd weiter, insbe-
sondere sind es die sogenannten Heimatmuseen, de-
ren Zahl von Jahr zu Jahr sich vermehrt. Aber nicht
nur Heimatmuseen werden allerorten gegründet oder
neu eingerichtet, ganz neue Typen kommen aufl
Hygiene-Museen, technische Museen, statistisch-wirt-
schaftliche Museen lassen vermuten, daß das Inter-
esse an musealer Darbietung von Schönem und Wis-
senswertem keineswegs im Erlöschen ist. —
Die Museumsleitungen können eine weitere Fest-
stellung machen: Der Besuch durch Schulen und Schul-
klassen aller Art ist im Wachsen, selbst dort, wo die
Zahl der sonstigen Besucher in Abnahme begriffen ist.
Was bedeutet das? Sicher nicht, daß von Seiten der
Schüler und Schülerinnen der spontane Wunsch zum
Museuinsbesuch stärker geworden wäre. Im Gegen-
teil, hier mögen jene Recht haben, die behaupten,
die gesteigerte Hinneigung zur Ausbildung des Kör-
pers in Sport und Spiel habe als die große Mode die
Kinder von der Arbeit und vom Spiel mit den Dingen
des Geistes abgezogen. Diejenigen Jugendlichen,
die freiwillig und gern die Museen —- meist die Kunst-
museen, die Galerien, daneben die technischen Mu-
seen—aufsuchen, sind und waren dem Gros der Ver-
ächter und der Gleichgültigen gegenüber immer in der
Minderheit. Es sind dies meist die entscheidend künst-
lerisch begabten Jungen und Mädchen und solche
Kinder, die das Glück haben, reiche geistige und
künstlerische Anregung durch das Elternhaus zu emp-
fangen. Diese jungen Menschen kommen freiwillig
gern, immer wieder und vor allem allein oder mit
wenigen Gleichgestimmten. Sie sind die stillsten Be-
sucher, gern gesehen, Andächtige, Ehrfürchtige und
Erlebnishungrige. Sie fehlten zu keiner Zeit und sie
werden auch in Zukunft nicht fehlen.— Die steigende
Zahl der Besuche von Schülern bedeutet leider auch
nicht, daß das Interesse der Eitern oder der Lehrer
den Museen gegenüber stärker geworden wäre, son-
dpflrlfnGegenteil, man hört gerade auch in der Leh-
rerschaft häufiger als früher die Klagen: „Wann soll
ich mit den Jungen oder Mädchen ins Museum gehen,
wo läßt der gefüllte Stundenplan und die intensive Art
des jetzigen Unterrichts mir persönlich freie Zeit zur
weiteren geistigen Ausbildung?" Es bleiben also nur
die Klassen- und Schulwanderungen und -ausflüge und
die Unterrichtsstunden, die einzelne Fachlehrer immer
wieder in den Museumsräumen abhalten. —
Uber den Museumsbesuch auf Ausflügen und bei
Wanderungen von Schulklassen sind des öfteren Klage-
lieder gesungen. Der Museumsbeamte, der jahraus
jahrein die Herden größerer, kleiner und kleinster
Kinder Frühstücksbrot kauend durch die Räume pol-
tern hört, unaufmerksam, sich zankend, Witze reißend
und gar, wenn sie das richtige Alter haben, sich auf
etwaige Nuditäten aufmerksam machend, versteht, daß
man die Forderung aufgestellt hat: Kinder gehören
nicht ins Museum. Der Lehrer begnügt sich meist mit
einem: „Seht mal hier, Kinder" oder treibt gar seine un-
ruhige Gesellschaft ungeduldig weiter, weil die Zeit
knapp ist. Er ist auf das Museum nicht vorbereitet
oder er hat den verständlichen Wunsch, in der kurzen
Zeit des Aufenthaltes am fremden Ort möglichst viel
an Kunstgenuß für sich selbst zu erwischen. In dei (
eben geschilderten Form ist jedenfalls der Museums-
besuch seitens der Schüler aufs schärfste zu verwer-
fen. Er ist wertlos und untergräbt von vorneherein
das Gefühl einer gewissen ehrfürchtigen Spannung
oder das Gefühl, hier in einer Umgebung zu sein, zu
der man innerlich gehört. Er erzieht letzten Endes eine
Generation, der das Museum überflüssig vorkommen
kann. —
Nicht so schlimm steht es mit dem Unterricht, der im
Museum erteilt wird. Allerdings ist auch er dann wert-
los, wenn er zuviel auf einmal vornimmt, zu viel Schü-
ler auf einmal an die Dinge heranzuführen sucht und-
vor allem, wenn der Vortragende oder der Aussprache-
leiter die Materie nicht beherrscht, nicht vorbereitet
ist oder Ausführungen macht, die — ohne Beziehung
auf die Räume und die Kunstwerke — auch in der
Schulklasse hätten gemacht werden können. — Besser
steht er mit der Auswertung der Sammlung für den Un-
terricht und das Leben, wenn einzelne Bilder, Stilperio-
den, Kulturabschnitte im engen Zusammenhang mildem
Geschichts-, Religions-, Geographie- und Deutschunter-
richt besprochen und interpretiert werden. Den kultur-
kundlichen Unterricht anschaulich zu ergänzen, indem
man, um nur ein Beispiel zu nennen, in der Mittelstufe
bei der Durchnahme der mitteldeutschen Literatur etwa
die gotischen Rüstungen zeigt und nach der prak-
tischen und ästhetischen Seite hin erläutert, die goti-
schen Elfenbeinschnitzereien und Buchmalereien nach
der künstlerischen und kulturellen Seite hin dem Schü-
ler aufschließt, in der Oberstufe bei der Besprechung
der klassischen Dichtung durch den Buchschmuck und
Buchdruck, das Biedermeierporträt, die Bauten der
Periode um 1800 u. a. im Museum das Bild erweitern
und vertiefen hilft: Diese Art des Unterrichts würden
unsere Sammlungen zu einer wahren „Bildungsstätte
als wichtige Ergänzung zu dem historisch-philologi-
schen Wesen der Schulen und Universitäten" machen,
wie es der große Kunstpädagoge Lichtwark, Lehrer
und Museumsmann zugleich, einmal ausgedrückt hat.
Der Einwand, für einen Unterricht dieser Art sei keine
Zeit, darf dann nicht gelten, wenn man ihn für wirklich
wichtig hält. Er ist aber an zwei Vorbedingungen ge-
knüpft: der Lehrer muß auch außerhalb seiner Schul-
klasse seine Schüler auf Grund einer wirklichen Per-
sönlichkeit geistig und disziplinarisch fest in der Hand
haben. Wichtiger ist aber eine zweite Vorbedingung:
Er muß die Museen, die Kunst- und Kulturwerte in
39