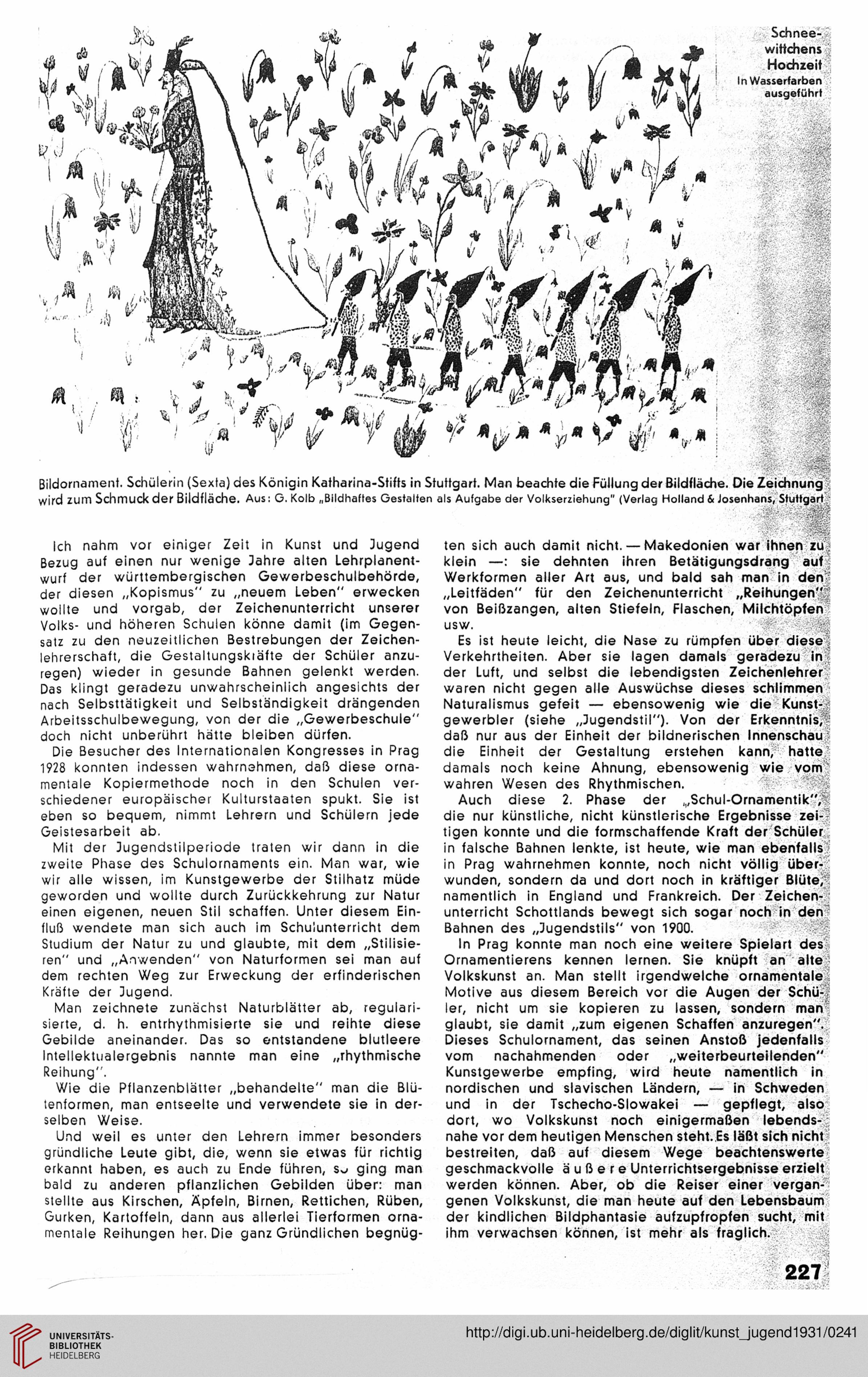$ ®
*
Schnee-
wittchens
Hochzeit
In Wasserfarben
ausgeführt
Bildornament. Schülerin (Sexta) des Königin Katharina-Stifts in Stuttgart. Man beachte die Füllung der Bildfläche. Die Zeichnung
wird zum Schmuck der Bildfläche. Aus: G. Kolb „Bildhaftes Gestalten als Aufgabe der Volkserziehung" (Verlag Holland & Josenhans, Stuttgart;
1
'9^.
»fr» *:/>• 1*^'- «, «
v '
Ich nahm vor einiger Zeit in Kunst und Jugend
Bezug auf einen nur wenige Jahre alten Lehrplanent-
wurf der württembergischen Gewerbeschulbehörde,
der diesen „Kopismus" zu „neuem Leben" erwecken
wollte und vorgab, der Zeichenunterricht unserer
Volks- und höheren Schulen könne damit (im Gegen-
satz zu den neuzeitlichen Bestrebungen der Zeichen-
lehrerschaft, die Gestaltungskiäfte der Schüler anzu-
regen) wieder in gesunde Bahnen gelenkt werden.
Das klingt geradezu unwahrscheinlich angesichts der
nach Selbsttätigkeit und Selbständigkeit drängenden
Arbeitsschulbewegung, von der die „Gewerbeschule"
doch nicht unberührt hätte bleiben dürfen.
Die Besucher des Internationalen Kongresses in Prag
1928 konnten indessen wahrnehmen, daß diese orna-
mentale Kopiermethode noch in den Schulen ver-
schiedener europäischer Kulturstaaten spukt. Sie ist
eben so bequem, nimmt Lehrern und Schülern jede
Geistesarbeit ab.
Mit der Jugendstilperiode traten wir dann in die
zweite Phase des Schulornaments ein. Man war, wie
wir alle wissen, im Kunstgewerbe der Stilhatz müde
geworden und wollte durch Zurückkehrung zur Natur
einen eigenen, neuen Stil schaffen. Unter diesem Ein-
fluß wendete man sich auch im Schulunterricht dem
Studium der Natur zu und glaubte, mit dem „Stilisie-
ren" und „Anwenden" von Naturformen sei man auf
dem rechten Weg zur Erweckung der erfinderischen
Kräfte der Jugend.
Man zeichnete zunächst Naturblätter ab, regulari-
sierte, d. h. entrhythmisierte sie und reihte diese
Gebilde aneinander. Das so entstandene blutleere
Intellektualergebnis nannte man eine „rhythmische
Reihung".
Wie die Pflanzenblätter „behandelte" man die Blü-
tenformen, man entseelte und verwendete sie in der-
selben Weise.
Und weil es unter den Lehrern immer besonders
gründliche Leute gibt, die, wenn sie etwas für richtig
erkannt haben, es auch zu Ende führen, Su ging man
bald zu anderen pflanzlichen Gebilden über: man
stellte aus Kirschen, Äpfeln, Birnen, Rettichen, Rüben,
Gurken, Kartoffeln, dann aus allerlei Tierformen orna-
mentale Reihungen her. Die ganz Gründlichen begnüg-
ten sich auch damit nicht. — Makedonien war ihnen zu
klein —: sie dehnten ihren Betätigungsdrang auf:
Werkformen aller Art aus, und bald sah man in den
„Leitfäden" für den Zeichenunterricht „Reihungen^
von Beißzangen, alten Stiefeln, Flaschen, Milchtöpfen
USW.
Es ist heute leicht, die Nase zu rümpfen über diese
Verkehrtheiten. Aber sie lagen damals geradezu in
der Luft, und selbst die lebendigsten Zeichenlehrer;;
waren nicht gegen alle Auswüchse dieses schlimmen
Naturalismus gefeit — ebensowenig wie die Kunst-:?
gewerbler (siehe „Jugendstil"). Von der Erkenntnis,
daß nur aus der Einheit der bildnerischen Innenschau/
die Einheit der Gestaltung erstehen kann, hatte
damals noch keine Ahnung, ebensowenig wie vom
wahren Wesen des Rhythmischen.
Auch diese 2. Phase der .„Schul-Ornamentik"^
die nur künstliche, nicht künstlerische Ergebnisse zei-
tigen konnte und die formschaffende Kraft der Schüler :
in falsche Bahnen lenkte, ist heute, wie man ebenfalls
in Prag wahrnehmen konnte, noch nicht völlig über-
wunden, sondern da und dort noch in kräftiger Blüte,
namentlich in England und Frankreich. Der Zeichen-
unterricht Schottlands bewegt sich sogar noch in den
Bahnen des „Jugendstils" von 1900.
In Prag konnte man noch eine weitere Spielart des
Ornamentierens kennen lernen. Sie knüpft an alte
Volkskunst an. Man stellt irgendwelche ornamentale
Motive aus diesem Bereich vor die Augen der Schü-
ler, nicht um sie kopieren zu lassen, sondern man
glaubt, sie damit „zum eigenen Schaffen anzuregen".
Dieses Schulornament, das seinen Anstoß jedenfalls
vom nachahmenden oder „weiterbeurteilenden"
Kunstgewerbe empfing, wird heute namentlich in
nordischen und slavischen Ländern, — in Schweden
und in der Tschecho-Slowakei — gepflegt, also
dort, wo Volkskunst noch einigermaßen lebends-
nahe vor dem heutigen Menschen steht. Es läßt sich nicht
bestreiten, daß auf diesem Wege beachtenswerte
geschmackvolle äußere Unterrichtsergebnisse erzielt
werden können. Aber, ob die Reiser einer vergan-
genen Volkskunst, die man heute auf den Lebensbaum
der kindlichen Bildphantasie aufzupfropfen sucht, mit
ihm verwachsen können, ist mehr als fraglich.
227