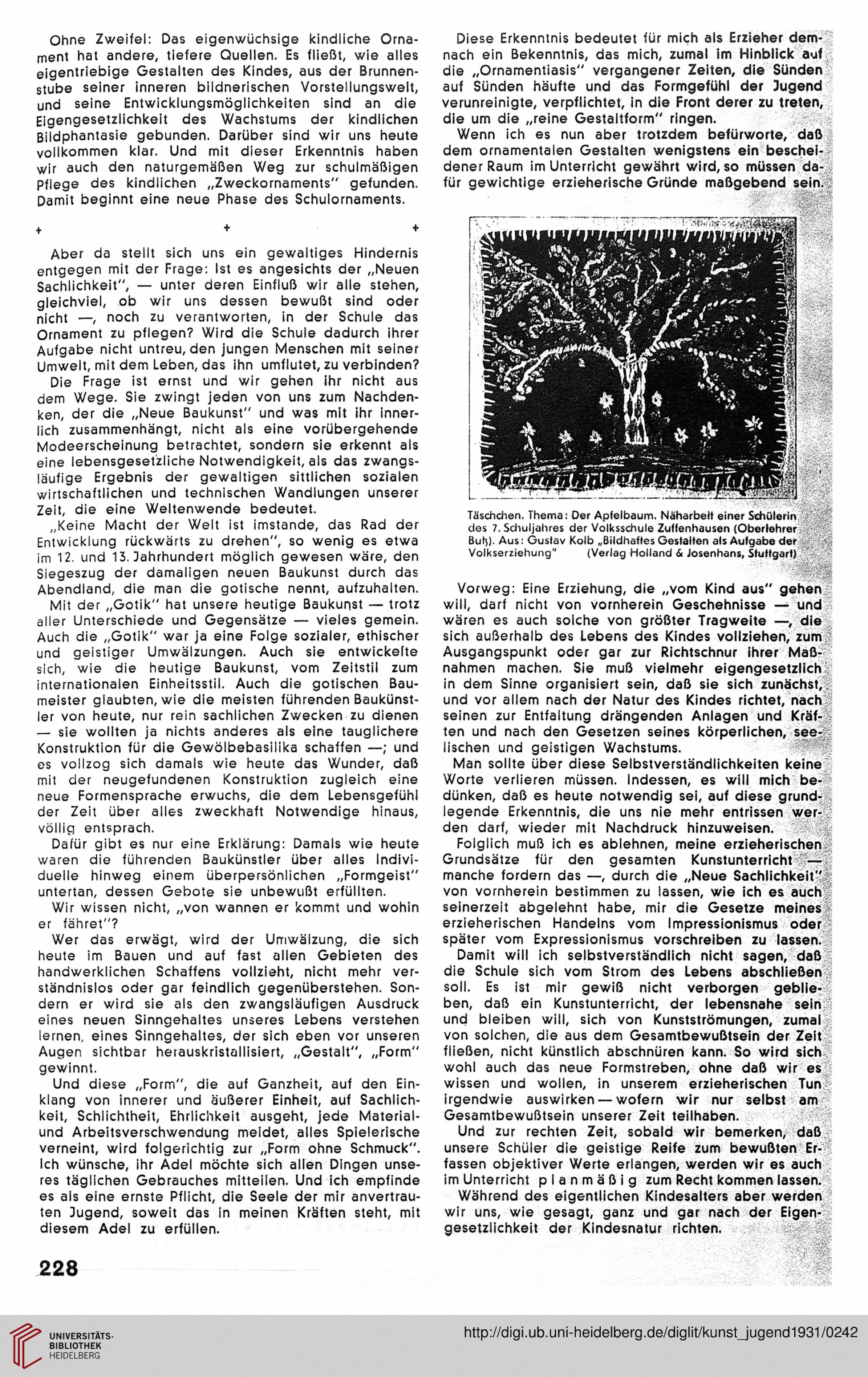Ohne Zweifel: Das eigenwüchsige kindliche Orna-
ment hat andere, tiefere Quellen. Es fließt, wie alles
eigentriebige Gestalten des Kindes, aus der Brunnen-
stube seiner inneren bildnerischen Vorstellungswelt,
und seine Entwicklungsmöglichkeiten sind an die
Eigengesetzlichkeit des Wachstums der kindlichen
Bildphantasie gebunden. Darüber sind wir uns heute
vollkommen klar. Und mit dieser Erkenntnis haben
wir auch den naturgemäßen Weg zur schulmäßigen
pflege des kindlichen „Zweckornaments'' gefunden.
Damit beginnt eine neue Phase des Schulornaments.
+ + +
Aber da stellt sich uns ein gewaltiges Hindernis
entgegen mit der Frage: Ist es angesichts der „Neuen
Sachlichkeit", — unter deren Einfluß wir alle stehen,
gleichviel, ob wir uns dessen bewußt sind oder
nicht —, noch zu verantworten, in der Schule das
Ornament zu pflegen? Wird die Schule dadurch ihrer
Aufgabe nicht untreu, den jungen Menschen mit seiner
Umwelt, mit dem Leben, das ihn umflutet, zu verbinden?
Die Frage ist ernst und wir gehen ihr nicht aus
dem Wege. Sie zwingt jeden von uns zum Nachden-
ken, der die „Neue Baukunst" und was mit ihr inner-
lich zusammenhängt, nicht als eine vorübergehende
Modeerscheinung betrachtet, sondern sie erkennt als
eine lebensgesetzliche Notwendigkeit, als das zwangs-
läufige Ergebnis der gewaltigen sittlichen sozialen
wirtschaftlichen und technischen Wandlungen unserer
Zeit, die eine Weltenwende bedeutet.
„Keine Macht der Welt ist imstande, das Rad der
Entwicklung rückwärts zu drehen", so wenig es etwa
im 12. und 13. Jahrhundert möglich gewesen wäre, den
Siegeszug der damaligen neuen Baukunst durch das
Abendland, die man die gotische nennt, aufzuhalten.
Mit der „Gotik" hat unsere heutige Baukunst — trotz
aller Unterschiede und Gegensätze — vieles gemein.
Auch die „Gotik" war ja eine Folge sozialer, ethischer
und geistiger Umwälzungen. Auch sie entwickelte
sich, wie die heutige Baukunst, vom Zeitstil zum
internationalen Einheitsstil. Auch die gotischen Bau-
meister glaubten, wie die meisten führenden Baukünst-
ler von heute, nur rein sachlichen Zwecken zu dienen
— sie wollten ja nichts anderes als eine tauglichere
Konstruktion für die Gewölbebasilika schaffen —; und
es vollzog sich damals wie heute das Wunder, daß
mit der neugefundenen Konstruktion zugleich eine
neue Formensprache erwuchs, die dem Lebensgefühl
der Zeit über alles zweckhaft Notwendige hinaus,
völlig entsprach.
Dafür gibt es nur eine Erklärung: Damals wie heute
waren die führenden Baukünstler über alles Indivi-
duelle hinweg einem überpersönlichen „Formgeist"
untertan, dessen Gebote sie unbewußt erfüllten.
Wir wissen nicht, „von wannen er kommt und wohin
er fähret"?
Wer das erwägt, wird der Umwälzung, die sich
heute im Bauen und auf fast allen Gebieten des
handwerklichen Schaffens vollzieht, nicht mehr ver-
ständnislos oder gar feindlich gegenüberstehen. Son-
dern er wird sie als den zwangsläufigen Ausdruck
eines neuen Sinngehaltes unseres Lebens verstehen
lernen, eines Sinngehaltes, der sich eben vor unseren
Augen sichtbar herauskristallisiert, „Gestalt", „Form"
gewinnt.
Und diese „Form", die auf Ganzheit, auf den Ein-
klang von innerer und äußerer Einheit, auf Sachlich-
keit, Schlichtheit, Ehrlichkeit ausgeht, jede Material-
und Arbeitsverschwendung meidet, alles Spielerische
verneint, wird folgerichtig zur „Form ohne Schmuck".
Ich wünsche, ihr Adel möchte sich allen Dingen unse-
res täglichen Gebrauches mitteilen. Und Ich empfinde
es als eine ernste Pflicht, die Seele der mir anvertrau-
ten Jugend, soweit das in meinen Kräften steht, mit
diesem Adel zu erfüllen.
228
Iw
Es ist mir gewiß nicht verborgen geblle'
Täschchen. Thema: Der Apfelbaum. Näharbeit einer Schülerin
des 7. Schuljahres der Volksschule Zuffenhausen (Oberlehrer
8utj). Aus: Gustav Kolb „Bildhaftes Gestalten als Aufgabe der
Volkserziehung" (Verlag Holland & Josenhans, Stuttgart)
Diese Erkenntnis bedeutet für mich als Erzieher dem-
nach ein Bekenntnis, das mich, zumal im Hinblick auf
die „Ornamentiasis" vergangener Zeiten, die Sünden
auf Sünden häufte und das Formgefühl der Jugend
verunreinigte, verpflichtet, in die Front derer zu treten,
die um die „reine Gestaltform" ringen.
Wenn ich es nun aber trotzdem befürworte, daß
dem ornamentalen Gestalten wenigstens ein besehe!-■
denerRaum im Unterricht gewährt wird, so müssen da-
für gewichtige erzieherische Gründe maßgebend sein.
Vorweg: Eine Erziehung, die „vom Kind aus" gehen
will, darf nicht von vornherein Geschehnisse — und
wären es auch solche von größter Tragweite —, die
sich außerhalb des Lebens des Kindes vollziehen, zum
Ausgangspunkt oder gar zur Richtschnur ihrer Maß-
nahmen machen. Sie muß vielmehr eigengesetzlich?
in dem Sinne organisiert sein, daß sie sich zunächst,,
und vor allem nach der Natur des Kindes richtet, nachj
seinen zur Entfaltung drängenden Anlagen und Kräf-
ten und nach den Gesetzen seines körperlichen, see-
lischen und geistigen Wachstums.
Man sollte über diese Selbstverständlichkeiten keine
Worte verlieren müssen. Indessen, es will mich be-
dünken, daß es heute notwendig sei, auf diese grund-
legende Erkenntnis, die uns nie mehr entrissen wer-
den darf, wieder mit Nachdruck hinzuweisen.
Folglich muß ich es ablehnen, meine erzieherischer,^
Grundsätze für den gesamten Kunstunterricht
manche fordern das —, durch die „Neue Sachlichkeit":
von vornherein bestimmen zu lassen, wie ich es auch
seinerzeit abgelehnt habe, mir die Gesetze meines
erzieherischen Handelns vom Impressionismus oder
später vom Expressionismus vorschreiben zu lassen.
Damit will ich selbstverständlich nicht sagen, daß
die Schule sich vom Strom des Lebens abschließen
soll.
ben, daß ein Kunstunterricht, der lebensnahe seiriil
und bleiben will, sich von Kunstströmungen, zumal
von solchen, die aus dem Gesamtbewußtsein der Zelt
fließen, nicht künstlich abschnüren kann. So wird sich
wohl auch das neue Formstreben, ohne daß wir es
wissen und wollen, in unserem erzieherischen Tun
irgendwie auswirken — wofern wir nur selbst am
Gesamtbewußtsein unserer Zeit teilhaben.
Und zur rechten Zeit, sobald wir bemerken, daß
unsere Schüler die geistige Reife zum bewußten Er-
fassen objektiver Werte erlangen, werden wir es auch
im Unterricht planmäßig zum Recht kommen lassen.
Während des eigentlichen Kindesalters aber werden
wir uns, wie gesagt, ganz und gar nach der Eigen-
gesetzlichkeit der Kindesnatur richten.
ment hat andere, tiefere Quellen. Es fließt, wie alles
eigentriebige Gestalten des Kindes, aus der Brunnen-
stube seiner inneren bildnerischen Vorstellungswelt,
und seine Entwicklungsmöglichkeiten sind an die
Eigengesetzlichkeit des Wachstums der kindlichen
Bildphantasie gebunden. Darüber sind wir uns heute
vollkommen klar. Und mit dieser Erkenntnis haben
wir auch den naturgemäßen Weg zur schulmäßigen
pflege des kindlichen „Zweckornaments'' gefunden.
Damit beginnt eine neue Phase des Schulornaments.
+ + +
Aber da stellt sich uns ein gewaltiges Hindernis
entgegen mit der Frage: Ist es angesichts der „Neuen
Sachlichkeit", — unter deren Einfluß wir alle stehen,
gleichviel, ob wir uns dessen bewußt sind oder
nicht —, noch zu verantworten, in der Schule das
Ornament zu pflegen? Wird die Schule dadurch ihrer
Aufgabe nicht untreu, den jungen Menschen mit seiner
Umwelt, mit dem Leben, das ihn umflutet, zu verbinden?
Die Frage ist ernst und wir gehen ihr nicht aus
dem Wege. Sie zwingt jeden von uns zum Nachden-
ken, der die „Neue Baukunst" und was mit ihr inner-
lich zusammenhängt, nicht als eine vorübergehende
Modeerscheinung betrachtet, sondern sie erkennt als
eine lebensgesetzliche Notwendigkeit, als das zwangs-
läufige Ergebnis der gewaltigen sittlichen sozialen
wirtschaftlichen und technischen Wandlungen unserer
Zeit, die eine Weltenwende bedeutet.
„Keine Macht der Welt ist imstande, das Rad der
Entwicklung rückwärts zu drehen", so wenig es etwa
im 12. und 13. Jahrhundert möglich gewesen wäre, den
Siegeszug der damaligen neuen Baukunst durch das
Abendland, die man die gotische nennt, aufzuhalten.
Mit der „Gotik" hat unsere heutige Baukunst — trotz
aller Unterschiede und Gegensätze — vieles gemein.
Auch die „Gotik" war ja eine Folge sozialer, ethischer
und geistiger Umwälzungen. Auch sie entwickelte
sich, wie die heutige Baukunst, vom Zeitstil zum
internationalen Einheitsstil. Auch die gotischen Bau-
meister glaubten, wie die meisten führenden Baukünst-
ler von heute, nur rein sachlichen Zwecken zu dienen
— sie wollten ja nichts anderes als eine tauglichere
Konstruktion für die Gewölbebasilika schaffen —; und
es vollzog sich damals wie heute das Wunder, daß
mit der neugefundenen Konstruktion zugleich eine
neue Formensprache erwuchs, die dem Lebensgefühl
der Zeit über alles zweckhaft Notwendige hinaus,
völlig entsprach.
Dafür gibt es nur eine Erklärung: Damals wie heute
waren die führenden Baukünstler über alles Indivi-
duelle hinweg einem überpersönlichen „Formgeist"
untertan, dessen Gebote sie unbewußt erfüllten.
Wir wissen nicht, „von wannen er kommt und wohin
er fähret"?
Wer das erwägt, wird der Umwälzung, die sich
heute im Bauen und auf fast allen Gebieten des
handwerklichen Schaffens vollzieht, nicht mehr ver-
ständnislos oder gar feindlich gegenüberstehen. Son-
dern er wird sie als den zwangsläufigen Ausdruck
eines neuen Sinngehaltes unseres Lebens verstehen
lernen, eines Sinngehaltes, der sich eben vor unseren
Augen sichtbar herauskristallisiert, „Gestalt", „Form"
gewinnt.
Und diese „Form", die auf Ganzheit, auf den Ein-
klang von innerer und äußerer Einheit, auf Sachlich-
keit, Schlichtheit, Ehrlichkeit ausgeht, jede Material-
und Arbeitsverschwendung meidet, alles Spielerische
verneint, wird folgerichtig zur „Form ohne Schmuck".
Ich wünsche, ihr Adel möchte sich allen Dingen unse-
res täglichen Gebrauches mitteilen. Und Ich empfinde
es als eine ernste Pflicht, die Seele der mir anvertrau-
ten Jugend, soweit das in meinen Kräften steht, mit
diesem Adel zu erfüllen.
228
Iw
Es ist mir gewiß nicht verborgen geblle'
Täschchen. Thema: Der Apfelbaum. Näharbeit einer Schülerin
des 7. Schuljahres der Volksschule Zuffenhausen (Oberlehrer
8utj). Aus: Gustav Kolb „Bildhaftes Gestalten als Aufgabe der
Volkserziehung" (Verlag Holland & Josenhans, Stuttgart)
Diese Erkenntnis bedeutet für mich als Erzieher dem-
nach ein Bekenntnis, das mich, zumal im Hinblick auf
die „Ornamentiasis" vergangener Zeiten, die Sünden
auf Sünden häufte und das Formgefühl der Jugend
verunreinigte, verpflichtet, in die Front derer zu treten,
die um die „reine Gestaltform" ringen.
Wenn ich es nun aber trotzdem befürworte, daß
dem ornamentalen Gestalten wenigstens ein besehe!-■
denerRaum im Unterricht gewährt wird, so müssen da-
für gewichtige erzieherische Gründe maßgebend sein.
Vorweg: Eine Erziehung, die „vom Kind aus" gehen
will, darf nicht von vornherein Geschehnisse — und
wären es auch solche von größter Tragweite —, die
sich außerhalb des Lebens des Kindes vollziehen, zum
Ausgangspunkt oder gar zur Richtschnur ihrer Maß-
nahmen machen. Sie muß vielmehr eigengesetzlich?
in dem Sinne organisiert sein, daß sie sich zunächst,,
und vor allem nach der Natur des Kindes richtet, nachj
seinen zur Entfaltung drängenden Anlagen und Kräf-
ten und nach den Gesetzen seines körperlichen, see-
lischen und geistigen Wachstums.
Man sollte über diese Selbstverständlichkeiten keine
Worte verlieren müssen. Indessen, es will mich be-
dünken, daß es heute notwendig sei, auf diese grund-
legende Erkenntnis, die uns nie mehr entrissen wer-
den darf, wieder mit Nachdruck hinzuweisen.
Folglich muß ich es ablehnen, meine erzieherischer,^
Grundsätze für den gesamten Kunstunterricht
manche fordern das —, durch die „Neue Sachlichkeit":
von vornherein bestimmen zu lassen, wie ich es auch
seinerzeit abgelehnt habe, mir die Gesetze meines
erzieherischen Handelns vom Impressionismus oder
später vom Expressionismus vorschreiben zu lassen.
Damit will ich selbstverständlich nicht sagen, daß
die Schule sich vom Strom des Lebens abschließen
soll.
ben, daß ein Kunstunterricht, der lebensnahe seiriil
und bleiben will, sich von Kunstströmungen, zumal
von solchen, die aus dem Gesamtbewußtsein der Zelt
fließen, nicht künstlich abschnüren kann. So wird sich
wohl auch das neue Formstreben, ohne daß wir es
wissen und wollen, in unserem erzieherischen Tun
irgendwie auswirken — wofern wir nur selbst am
Gesamtbewußtsein unserer Zeit teilhaben.
Und zur rechten Zeit, sobald wir bemerken, daß
unsere Schüler die geistige Reife zum bewußten Er-
fassen objektiver Werte erlangen, werden wir es auch
im Unterricht planmäßig zum Recht kommen lassen.
Während des eigentlichen Kindesalters aber werden
wir uns, wie gesagt, ganz und gar nach der Eigen-
gesetzlichkeit der Kindesnatur richten.