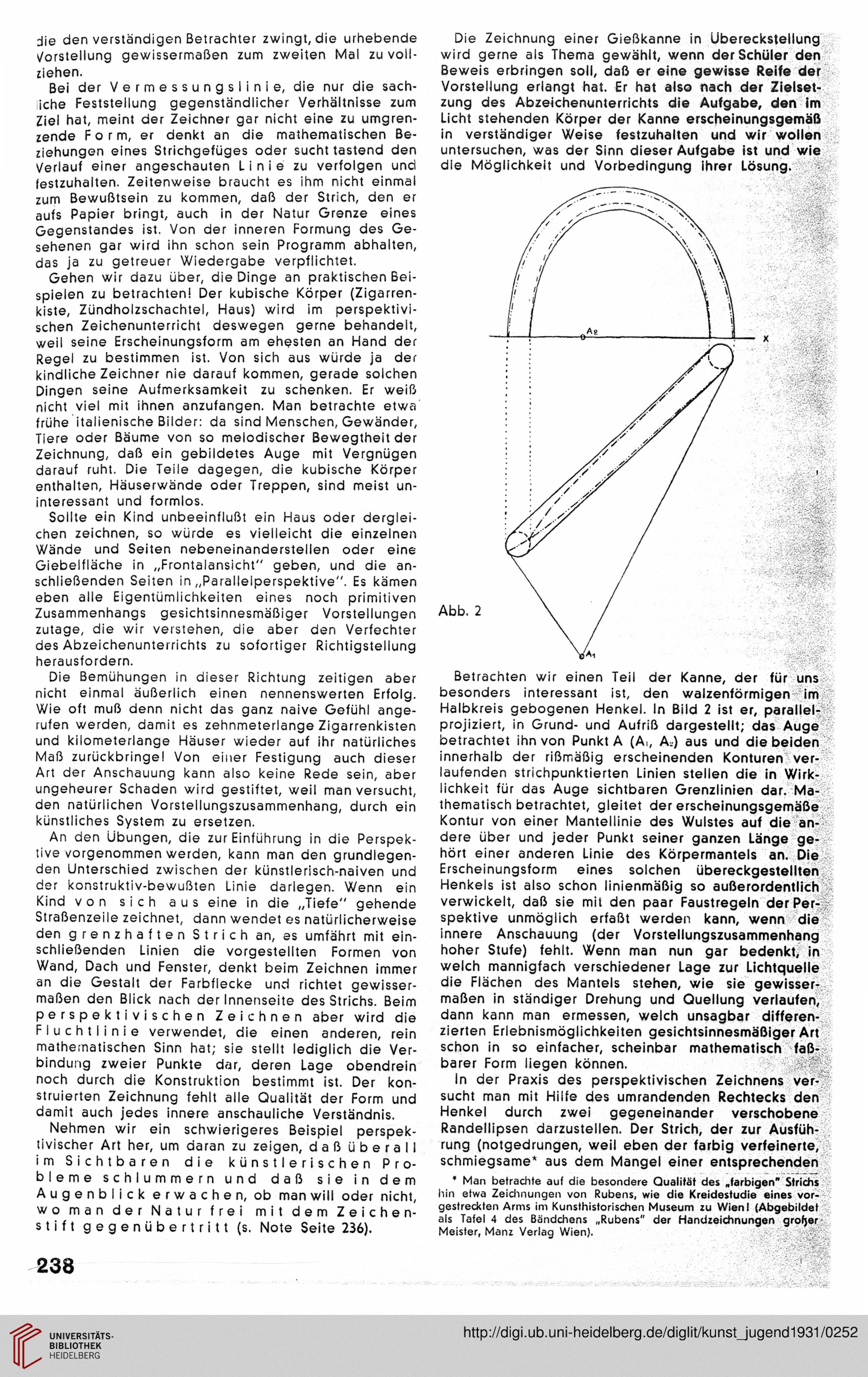die den verständigen Betrachter zwingt, die urhebende
Vorstellung gewissermaßen zum zweiten Mal zu voll-
ziehen.
Bei der Vermessungslinie, die nur die sach-
iiche Feststellung gegenständlicher Verhältnisse zum
Ziel hat, meint der Zeichner gar nicht eine zu umgren-
zende Form, er denkt an die mathematischen Be-
ziehungen eines Strichgefüges oder sucht tastend den
Verlauf einer angeschauten Linie zu verfolgen und
festzuhalten. Zeitenweise braucht es ihm nicht einmal
zum Bewußtsein zu kommen, daß der Strich, den er
aufs Papier bringt, auch in der Natur Grenze eines
Gegenstandes ist. Von der inneren Formung des Ge-
sehenen gar wird ihn schon sein Programm abhalten,
das ja zu getreuer Wiedergabe verpflichtet.
Gehen wir dazu über, die Dinge an praktischen Bei-
spielen zu betrachten! Der kubische Körper (Zigarren-
kiste, Zündholzschachtel, Haus) wird im perspektivi-
schen Zeichenunterricht deswegen gerne behandelt,
weil seine Erscheinungsform am ehesten an Hand der
Regel zu bestimmen ist. Von sich aus würde ja der
kindliche Zeichner nie darauf kommen, gerade solchen
Dingen seine Aufmerksamkeit zu schenken. Er weiß
nicht viel mit ihnen anzufangen. Man betrachte etwa
frühe italienische Bilder: da sind Menschen, Gewänder,
Tiere oder Bäume von so melodischer Bewegtheit der
Zeichnung, daß ein gebildetes Auge mit Vergnügen
darauf ruht. Die Teile dagegen, die kubische Körper
enthalten, Häuserwände oder Treppen, sind meist un-
interessant und formlos.
Sollte ein Kind unbeeinflußt ein Haus oder derglei-
chen zeichnen, so würde es vielleicht die einzelnen
Wände und Seiten nebeneinanderstellen oder eine
Giebelfläche in „Frontalansicht" geben, und die an-
schließenden Seiten in „Parallelperspektive". Es kämen
eben alle Eigentümlichkeiten eines noch primitiven
Zusammenhangs gesichtsinnesmäßiger Vorstellungen
zutage, die wir verstehen, die aber den Verfechter
des Abzeichenunterrichts zu sofortiger Richtigstellung
herausfordern.
Die Bemühungen in dieser Richtung zeitigen aber
nicht einmal äußerlich einen nennenswerten Erfolg.
Wie oft muß denn nicht das ganz naive Gefühl ange-
rufen werden, damit es zehnmeterlange Zigarrenkisten
und kilometerlange Häuser wieder auf ihr natürliches
Maß zurückbringel Von einer Festigung auch dieser
Art der Anschauung kann also keine Rede sein, aber
ungeheurer Schaden wird gestiftet, weil man versucht,
den natürlichen Vorstellungszusammenhang, durch ein
künstliches System zu ersetzen.
An den Übungen, die zur Einführung in die Perspek-
tive vorgenommen werden, kann man den grundlegen-
den Unterschied zwischen der künstlerisch-naiven und
der konstruktiv-bewußten Linie darlegen. Wenn ein
Kind von sich aus eine in die „Tiefe" gehende
Straßenzeile zeichnet, dann wendet es natürlicherweise
den grenzhaften Strich an, es umfährt mit ein-
schließenden Linien die vorgestellten Formen von
Wand, Dach und Fenster, denkt beim Zeichnen immer
an die Gestalt der Farbflecke und richtet gewisser-
maßen den Blick nach der Innenseite des Strichs. Beim
perspektivischen Zeichnen aber wird die
Fluchtlinie verwendet, die einen anderen, rein
mathematischen Sinn hat; sie stellt lediglich die Ver-
bindung zweier Punkte dar, deren Lage obendrein
noch durch die Konstruktion bestimmt ist. Der kon-
struierten Zeichnung fehlt alle Qualität der Form und
damit auch jedes innere anschauliche Verständnis.
Nehmen wir ein schwierigeres Beispiel perspek-
tivischer Art her, um daran zu zeigen, daß überall
im Sichtbaren die künstlerischen Pro-
bleme schlummern und daß sie in dem
Augenblick erwachen, ob man will oder nicht,
wo man der Natur frei mit dem Zeichen-
stift gegenübertritt (s. Note Seite 236).
Die Zeichnung einer Gießkanne in Ubereckstellung
wird gerne als Thema gewählt, wenn der Schüler den
Beweis erbringen soll, daß er eine gewisse Reife der
Vorstellung erlangt hat. Er hat also nach der Zielset-
zung des Abzeichenunterrichts die Aufgabe, den im
Licht stehenden Körper der Kanne erscheinungsgemäß
in verständiger Weise festzuhalten und wir wollen
untersuchen, was der Sinn dieser Aufgabe ist und wie
die Möglichkeit und Vorbedingung ihrer Lösung.
Betrachten wir einen Teil der Kanne, der für uns
besonders interessant ist, den walzenförmigen im
Halbkreis gebogenen Henkel. In Bild 2 ist er, parallel-
projiziert, in Grund- und Aufriß dargestellt; das Auge
betrachtet ihn von Punkt A (A>, A-) aus und die beiden
innerhalb der rißmäßig erscheinenden Konturen ver-
laufenden strichpunktierten Linien stellen die in Wirk-
lichkeit für das Auge sichtbaren Grenzlinien dar. Ma-
thematisch betrachtet, gleitet der erscheinungsgemäße
Kontur von einer Mantellinie des Wulstes auf die an-
dere über und jeder Punkt seiner ganzen Länge ge-
hört einer anderen Linie des Körpermantels an. Die
Erscheinungsform eines solchen übereckgestellten
Henkels ist also schon linienmäßig so außerordentlich
verwickelt, daß sie mit den paar Faustregeln der Per-;
spektive unmöglich erfaßt werden kann, wenn die
innere Anschauung (der Vorstellungszusammenhang
hoher Stufe) fehlt. Wenn man nun gar bedenkt, in
welch mannigfach verschiedener Lage zur Lichtquelle
die Flächen des Mantels stehen, wie sie gewisser-
maßen in ständiger Drehung und Quellung verlaufen,
dann kann man ermessen, welch unsagbar differen-
zierten Erlebnismöglichkeiten gesichtsinnesmäßiger Art
schon in so einfacher, scheinbar mathematisch
barer Form liegen können.
In der Praxis des perspektivischen Zeichnens
sucht man mit Hilfe des umrandenden Rechtecks
faß-
ver-
den
Henkel durch zwei gegeneinander verschobene
Randellipsen darzustellen. Der Strich, der zur Ausfüh-
rung (notgedrungen, weil eben der farbig verfeinerte,
schmiegsame* aus dem Mangel einer entsprechenden
* Man betrachte auf die besondere Qualität des „farbigen" Strichs
hin etwa Zeichnungen von Rubens, wie die Kreidestudie eines vor-
gestreckten Arms im Kunsthistorischen Museum zu Wien! (Abgebildet
als Tafel 4 des Bändchens „Rubens" der Handzeichnungen großer
Meister, Manz Verlag Wien).
238
Vorstellung gewissermaßen zum zweiten Mal zu voll-
ziehen.
Bei der Vermessungslinie, die nur die sach-
iiche Feststellung gegenständlicher Verhältnisse zum
Ziel hat, meint der Zeichner gar nicht eine zu umgren-
zende Form, er denkt an die mathematischen Be-
ziehungen eines Strichgefüges oder sucht tastend den
Verlauf einer angeschauten Linie zu verfolgen und
festzuhalten. Zeitenweise braucht es ihm nicht einmal
zum Bewußtsein zu kommen, daß der Strich, den er
aufs Papier bringt, auch in der Natur Grenze eines
Gegenstandes ist. Von der inneren Formung des Ge-
sehenen gar wird ihn schon sein Programm abhalten,
das ja zu getreuer Wiedergabe verpflichtet.
Gehen wir dazu über, die Dinge an praktischen Bei-
spielen zu betrachten! Der kubische Körper (Zigarren-
kiste, Zündholzschachtel, Haus) wird im perspektivi-
schen Zeichenunterricht deswegen gerne behandelt,
weil seine Erscheinungsform am ehesten an Hand der
Regel zu bestimmen ist. Von sich aus würde ja der
kindliche Zeichner nie darauf kommen, gerade solchen
Dingen seine Aufmerksamkeit zu schenken. Er weiß
nicht viel mit ihnen anzufangen. Man betrachte etwa
frühe italienische Bilder: da sind Menschen, Gewänder,
Tiere oder Bäume von so melodischer Bewegtheit der
Zeichnung, daß ein gebildetes Auge mit Vergnügen
darauf ruht. Die Teile dagegen, die kubische Körper
enthalten, Häuserwände oder Treppen, sind meist un-
interessant und formlos.
Sollte ein Kind unbeeinflußt ein Haus oder derglei-
chen zeichnen, so würde es vielleicht die einzelnen
Wände und Seiten nebeneinanderstellen oder eine
Giebelfläche in „Frontalansicht" geben, und die an-
schließenden Seiten in „Parallelperspektive". Es kämen
eben alle Eigentümlichkeiten eines noch primitiven
Zusammenhangs gesichtsinnesmäßiger Vorstellungen
zutage, die wir verstehen, die aber den Verfechter
des Abzeichenunterrichts zu sofortiger Richtigstellung
herausfordern.
Die Bemühungen in dieser Richtung zeitigen aber
nicht einmal äußerlich einen nennenswerten Erfolg.
Wie oft muß denn nicht das ganz naive Gefühl ange-
rufen werden, damit es zehnmeterlange Zigarrenkisten
und kilometerlange Häuser wieder auf ihr natürliches
Maß zurückbringel Von einer Festigung auch dieser
Art der Anschauung kann also keine Rede sein, aber
ungeheurer Schaden wird gestiftet, weil man versucht,
den natürlichen Vorstellungszusammenhang, durch ein
künstliches System zu ersetzen.
An den Übungen, die zur Einführung in die Perspek-
tive vorgenommen werden, kann man den grundlegen-
den Unterschied zwischen der künstlerisch-naiven und
der konstruktiv-bewußten Linie darlegen. Wenn ein
Kind von sich aus eine in die „Tiefe" gehende
Straßenzeile zeichnet, dann wendet es natürlicherweise
den grenzhaften Strich an, es umfährt mit ein-
schließenden Linien die vorgestellten Formen von
Wand, Dach und Fenster, denkt beim Zeichnen immer
an die Gestalt der Farbflecke und richtet gewisser-
maßen den Blick nach der Innenseite des Strichs. Beim
perspektivischen Zeichnen aber wird die
Fluchtlinie verwendet, die einen anderen, rein
mathematischen Sinn hat; sie stellt lediglich die Ver-
bindung zweier Punkte dar, deren Lage obendrein
noch durch die Konstruktion bestimmt ist. Der kon-
struierten Zeichnung fehlt alle Qualität der Form und
damit auch jedes innere anschauliche Verständnis.
Nehmen wir ein schwierigeres Beispiel perspek-
tivischer Art her, um daran zu zeigen, daß überall
im Sichtbaren die künstlerischen Pro-
bleme schlummern und daß sie in dem
Augenblick erwachen, ob man will oder nicht,
wo man der Natur frei mit dem Zeichen-
stift gegenübertritt (s. Note Seite 236).
Die Zeichnung einer Gießkanne in Ubereckstellung
wird gerne als Thema gewählt, wenn der Schüler den
Beweis erbringen soll, daß er eine gewisse Reife der
Vorstellung erlangt hat. Er hat also nach der Zielset-
zung des Abzeichenunterrichts die Aufgabe, den im
Licht stehenden Körper der Kanne erscheinungsgemäß
in verständiger Weise festzuhalten und wir wollen
untersuchen, was der Sinn dieser Aufgabe ist und wie
die Möglichkeit und Vorbedingung ihrer Lösung.
Betrachten wir einen Teil der Kanne, der für uns
besonders interessant ist, den walzenförmigen im
Halbkreis gebogenen Henkel. In Bild 2 ist er, parallel-
projiziert, in Grund- und Aufriß dargestellt; das Auge
betrachtet ihn von Punkt A (A>, A-) aus und die beiden
innerhalb der rißmäßig erscheinenden Konturen ver-
laufenden strichpunktierten Linien stellen die in Wirk-
lichkeit für das Auge sichtbaren Grenzlinien dar. Ma-
thematisch betrachtet, gleitet der erscheinungsgemäße
Kontur von einer Mantellinie des Wulstes auf die an-
dere über und jeder Punkt seiner ganzen Länge ge-
hört einer anderen Linie des Körpermantels an. Die
Erscheinungsform eines solchen übereckgestellten
Henkels ist also schon linienmäßig so außerordentlich
verwickelt, daß sie mit den paar Faustregeln der Per-;
spektive unmöglich erfaßt werden kann, wenn die
innere Anschauung (der Vorstellungszusammenhang
hoher Stufe) fehlt. Wenn man nun gar bedenkt, in
welch mannigfach verschiedener Lage zur Lichtquelle
die Flächen des Mantels stehen, wie sie gewisser-
maßen in ständiger Drehung und Quellung verlaufen,
dann kann man ermessen, welch unsagbar differen-
zierten Erlebnismöglichkeiten gesichtsinnesmäßiger Art
schon in so einfacher, scheinbar mathematisch
barer Form liegen können.
In der Praxis des perspektivischen Zeichnens
sucht man mit Hilfe des umrandenden Rechtecks
faß-
ver-
den
Henkel durch zwei gegeneinander verschobene
Randellipsen darzustellen. Der Strich, der zur Ausfüh-
rung (notgedrungen, weil eben der farbig verfeinerte,
schmiegsame* aus dem Mangel einer entsprechenden
* Man betrachte auf die besondere Qualität des „farbigen" Strichs
hin etwa Zeichnungen von Rubens, wie die Kreidestudie eines vor-
gestreckten Arms im Kunsthistorischen Museum zu Wien! (Abgebildet
als Tafel 4 des Bändchens „Rubens" der Handzeichnungen großer
Meister, Manz Verlag Wien).
238