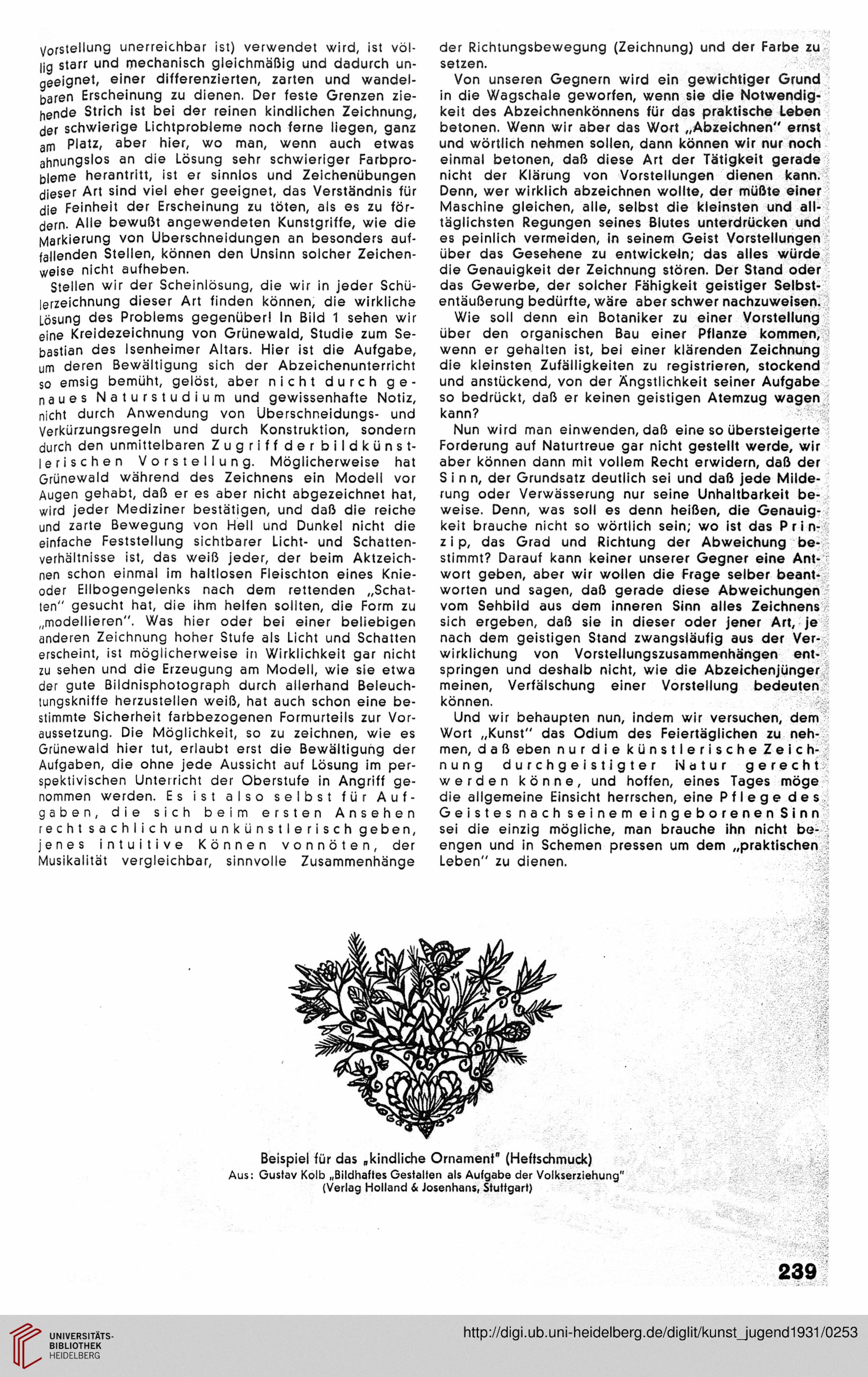Vorstellung unerreichbar ist) verwendet wird, ist völ-
lig starr und mechanisch gleichmäßig und dadurch un-
geeignet, einer differenzierten, zarten und wandel-
baren Erscheinung zu dienen. Der feste Grenzen zie-
hende Strich ist bei der reinen kindlichen Zeichnung,
jer schwierige Lichtprobleme noch ferne liegen, ganz
am Platz, aber hier, wo man, wenn auch etwas
ahnungslos an die Lösung sehr schwieriger Farbpro-
bleme herantritt, ist er sinnlos und Zeichenübungen
dieser Art sind viel eher geeignet, das Verständnis für
die Feinheit der Erscheinung zu töten, als es zu för-
dern. Alle bewußt angewendeten Kunstgriffe, wie die
Markierung von Überschneidungen an besonders auf-
fallenden Stellen, können den Unsinn solcher Zeichen-
weise nicht aufheben.
Stellen wir der Scheinlösung, die wir in jeder Schü-
lerzeichnung dieser Art finden können, die wirkliche
Lösung des Problems gegenüber! In Bild 1 sehen wir
eine Kreidezeichnung von Grünewald, Studie zum Se-
bastian des Isenheimer Altars. Hier ist die Aufgabe,
um deren Bewältigung sich der Abzeichenunterricht
so emsig bemüht, gelöst, aber nicht durch ge-
naues Naturstudium und gewissenhafte Notiz,
nicht durch Anwendung von Uberschneidungs- und
Verkürzungsregeln und durch Konstruktion, sondern
durch den unmittelbaren Zugriffder bildkünst-
lerischen Vorstellung. Möglicherweise hat
Grünewald während des Zeichnens ein Modell vor
Augen gehabt, daß er es aber nicht abgezeichnet hat,
wird jeder Mediziner bestätigen, und daß die reiche
und zarte Bewegung von Hell und Dunkel nicht die
einfache Feststellung sichtbarer Licht- und Schatten-
verhältnisse ist, das weiß jeder, der beim Aktzeich-
nen schon einmal im haltlosen Fleischton eines Knie-
oder Ellbogengelenks nach dem rettenden „Schat-
ten" gesucht hat, die ihm helfen sollten, die Form zu
„modellieren". Was hier oder bei einer beliebigen
anderen Zeichnung hoher Stufe als Licht und Schatten
erscheint, ist möglicherweise in Wirklichkeit gar nicht
zu sehen und die Erzeugung am Modell, wie sie etwa
der gute Bildnisphotograph durch allerhand Beleuch-
tungskniffe herzustelien weiß, hat auch schon eine be-
stimmte Sicherheit farbbezogenen Formurteils zur Vor-
aussetzung. Die Möglichkeit, so zu zeichnen, wie es
Grünewald hier tut, erlaubt erst die Bewältigung der
Aufgaben, die ohne jede Aussicht auf Lösung im per-
spektivischen Unterricht der Oberstufe in Angriff ge-
nommen werden. Es ist also selbst für Auf-
gaben, die sich beim ersten Ansehen
recht sachlich und unkünstlerisch geben,
jenes intuitive Können vonnöten, der
Musikalität vergleichbar, sinnvolle Zusammenhänge
der Richtungsbewegung (Zeichnung) und der Farbe zu
setzen.
Von unseren Gegnern wird ein gewichtiger Grund
in die Wagschale geworfen, wenn sie die Notwendig-
keit des Abzeichnenkönnens für das praktische Leben
betonen. Wenn wir aber das Wort „Abzeichnen" ernst
und wörtlich nehmen sollen, dann können wir nur noch
einmal betonen, daß diese Art der Tätigkeit gerade
nicht der Klärung von Vorstellungen dienen kann.
Denn, wer wirklich abzeichnen wollte, der müßte einer
Maschine gleichen, alle, selbst die kleinsten und all-
täglichsten Regungen seines Blutes unterdrücken und
es peinlich vermeiden, in seinem Geist Vorstellungen
über das Gesehene zu entwickeln; das alles würde
die Genauigkeit der Zeichnung stören. Der Stand oder
das Gewerbe, der solcher Fähigkeit geistiger Selbst-
entäußerung bedürfte, wäre aber schwer nachzuweisen.
Wie soll denn ein Botaniker zu einer Vorstellung
über den organischen Bau einer Pflanze kommen,
wenn er gehalten ist, bei einer klärenden Zeichnung
die kleinsten Zufälligkeiten zu registrieren, stockend
und anstückend, von der Ängstlichkeit seiner Aufgabe
so bedrückt, daß er keinen geistigen Atemzug wagen
kann?
Nun wird man einwenden, daß eine so übersteigerte
Forderung auf Naturtreue gar nicht gestellt werde, wir
aber können dann mit vollem Recht erwidern, daß der
Sinn, der Grundsatz deutlich sei und daß jede Milde-
rung oder Verwässerung nur seine Unhaltbarkeit be-
weise. Denn, was soll es denn heißen, die Genauig-
keit brauche nicht so wörtlich sein; wo ist das P r i n-
z i p, das Grad und Richtung der Abweichung be-
stimmt? Darauf kann keiner unserer Gegner eine Ant-
wort geben, aber wir wollen die Frage selber beant-
worten und sagen, daß gerade diese Abweichungen
vom Sehbild aus dem inneren Sinn alles Zeichnens
sich ergeben, daß sie in dieser oder jener Art, je
nach dem geistigen Stand zwangsläufig aus der Ver-
wirklichung von Vorstellungszusammenhängen ent-
springen und deshalb nicht, wie die Abzeichenjünger
meinen, Verfälschung einer Vorstellung bedeuten
können.
Und wir behaupten nun, indem wir versuchen, dem
Wort „Kunst" das Odium des Feiertäglichen zu neh-
men, daß eben nur die künstlerische Zeich-
nung durchgeistigter Natur gerecht
werden könne, und hoffen, eines Tages möge
die allgemeine Einsicht herrschen, eine Pflege des
Geistes nach seinem eingeborenen Sinn
sei die einzig mögliche, man brauche ihn nicht be-
engen und in Schemen pressen um dem „praktischen
Leben" zu dienen.
Beispiel für das „kindliche Ornament” (Heftschmuck)
Aus; Gustav Kolb „Bildhaftes Gestalten als Aufgabe der Volkserziehung"
(Verlag Holland & Josenhans, Stuttgart)
239
lig starr und mechanisch gleichmäßig und dadurch un-
geeignet, einer differenzierten, zarten und wandel-
baren Erscheinung zu dienen. Der feste Grenzen zie-
hende Strich ist bei der reinen kindlichen Zeichnung,
jer schwierige Lichtprobleme noch ferne liegen, ganz
am Platz, aber hier, wo man, wenn auch etwas
ahnungslos an die Lösung sehr schwieriger Farbpro-
bleme herantritt, ist er sinnlos und Zeichenübungen
dieser Art sind viel eher geeignet, das Verständnis für
die Feinheit der Erscheinung zu töten, als es zu för-
dern. Alle bewußt angewendeten Kunstgriffe, wie die
Markierung von Überschneidungen an besonders auf-
fallenden Stellen, können den Unsinn solcher Zeichen-
weise nicht aufheben.
Stellen wir der Scheinlösung, die wir in jeder Schü-
lerzeichnung dieser Art finden können, die wirkliche
Lösung des Problems gegenüber! In Bild 1 sehen wir
eine Kreidezeichnung von Grünewald, Studie zum Se-
bastian des Isenheimer Altars. Hier ist die Aufgabe,
um deren Bewältigung sich der Abzeichenunterricht
so emsig bemüht, gelöst, aber nicht durch ge-
naues Naturstudium und gewissenhafte Notiz,
nicht durch Anwendung von Uberschneidungs- und
Verkürzungsregeln und durch Konstruktion, sondern
durch den unmittelbaren Zugriffder bildkünst-
lerischen Vorstellung. Möglicherweise hat
Grünewald während des Zeichnens ein Modell vor
Augen gehabt, daß er es aber nicht abgezeichnet hat,
wird jeder Mediziner bestätigen, und daß die reiche
und zarte Bewegung von Hell und Dunkel nicht die
einfache Feststellung sichtbarer Licht- und Schatten-
verhältnisse ist, das weiß jeder, der beim Aktzeich-
nen schon einmal im haltlosen Fleischton eines Knie-
oder Ellbogengelenks nach dem rettenden „Schat-
ten" gesucht hat, die ihm helfen sollten, die Form zu
„modellieren". Was hier oder bei einer beliebigen
anderen Zeichnung hoher Stufe als Licht und Schatten
erscheint, ist möglicherweise in Wirklichkeit gar nicht
zu sehen und die Erzeugung am Modell, wie sie etwa
der gute Bildnisphotograph durch allerhand Beleuch-
tungskniffe herzustelien weiß, hat auch schon eine be-
stimmte Sicherheit farbbezogenen Formurteils zur Vor-
aussetzung. Die Möglichkeit, so zu zeichnen, wie es
Grünewald hier tut, erlaubt erst die Bewältigung der
Aufgaben, die ohne jede Aussicht auf Lösung im per-
spektivischen Unterricht der Oberstufe in Angriff ge-
nommen werden. Es ist also selbst für Auf-
gaben, die sich beim ersten Ansehen
recht sachlich und unkünstlerisch geben,
jenes intuitive Können vonnöten, der
Musikalität vergleichbar, sinnvolle Zusammenhänge
der Richtungsbewegung (Zeichnung) und der Farbe zu
setzen.
Von unseren Gegnern wird ein gewichtiger Grund
in die Wagschale geworfen, wenn sie die Notwendig-
keit des Abzeichnenkönnens für das praktische Leben
betonen. Wenn wir aber das Wort „Abzeichnen" ernst
und wörtlich nehmen sollen, dann können wir nur noch
einmal betonen, daß diese Art der Tätigkeit gerade
nicht der Klärung von Vorstellungen dienen kann.
Denn, wer wirklich abzeichnen wollte, der müßte einer
Maschine gleichen, alle, selbst die kleinsten und all-
täglichsten Regungen seines Blutes unterdrücken und
es peinlich vermeiden, in seinem Geist Vorstellungen
über das Gesehene zu entwickeln; das alles würde
die Genauigkeit der Zeichnung stören. Der Stand oder
das Gewerbe, der solcher Fähigkeit geistiger Selbst-
entäußerung bedürfte, wäre aber schwer nachzuweisen.
Wie soll denn ein Botaniker zu einer Vorstellung
über den organischen Bau einer Pflanze kommen,
wenn er gehalten ist, bei einer klärenden Zeichnung
die kleinsten Zufälligkeiten zu registrieren, stockend
und anstückend, von der Ängstlichkeit seiner Aufgabe
so bedrückt, daß er keinen geistigen Atemzug wagen
kann?
Nun wird man einwenden, daß eine so übersteigerte
Forderung auf Naturtreue gar nicht gestellt werde, wir
aber können dann mit vollem Recht erwidern, daß der
Sinn, der Grundsatz deutlich sei und daß jede Milde-
rung oder Verwässerung nur seine Unhaltbarkeit be-
weise. Denn, was soll es denn heißen, die Genauig-
keit brauche nicht so wörtlich sein; wo ist das P r i n-
z i p, das Grad und Richtung der Abweichung be-
stimmt? Darauf kann keiner unserer Gegner eine Ant-
wort geben, aber wir wollen die Frage selber beant-
worten und sagen, daß gerade diese Abweichungen
vom Sehbild aus dem inneren Sinn alles Zeichnens
sich ergeben, daß sie in dieser oder jener Art, je
nach dem geistigen Stand zwangsläufig aus der Ver-
wirklichung von Vorstellungszusammenhängen ent-
springen und deshalb nicht, wie die Abzeichenjünger
meinen, Verfälschung einer Vorstellung bedeuten
können.
Und wir behaupten nun, indem wir versuchen, dem
Wort „Kunst" das Odium des Feiertäglichen zu neh-
men, daß eben nur die künstlerische Zeich-
nung durchgeistigter Natur gerecht
werden könne, und hoffen, eines Tages möge
die allgemeine Einsicht herrschen, eine Pflege des
Geistes nach seinem eingeborenen Sinn
sei die einzig mögliche, man brauche ihn nicht be-
engen und in Schemen pressen um dem „praktischen
Leben" zu dienen.
Beispiel für das „kindliche Ornament” (Heftschmuck)
Aus; Gustav Kolb „Bildhaftes Gestalten als Aufgabe der Volkserziehung"
(Verlag Holland & Josenhans, Stuttgart)
239