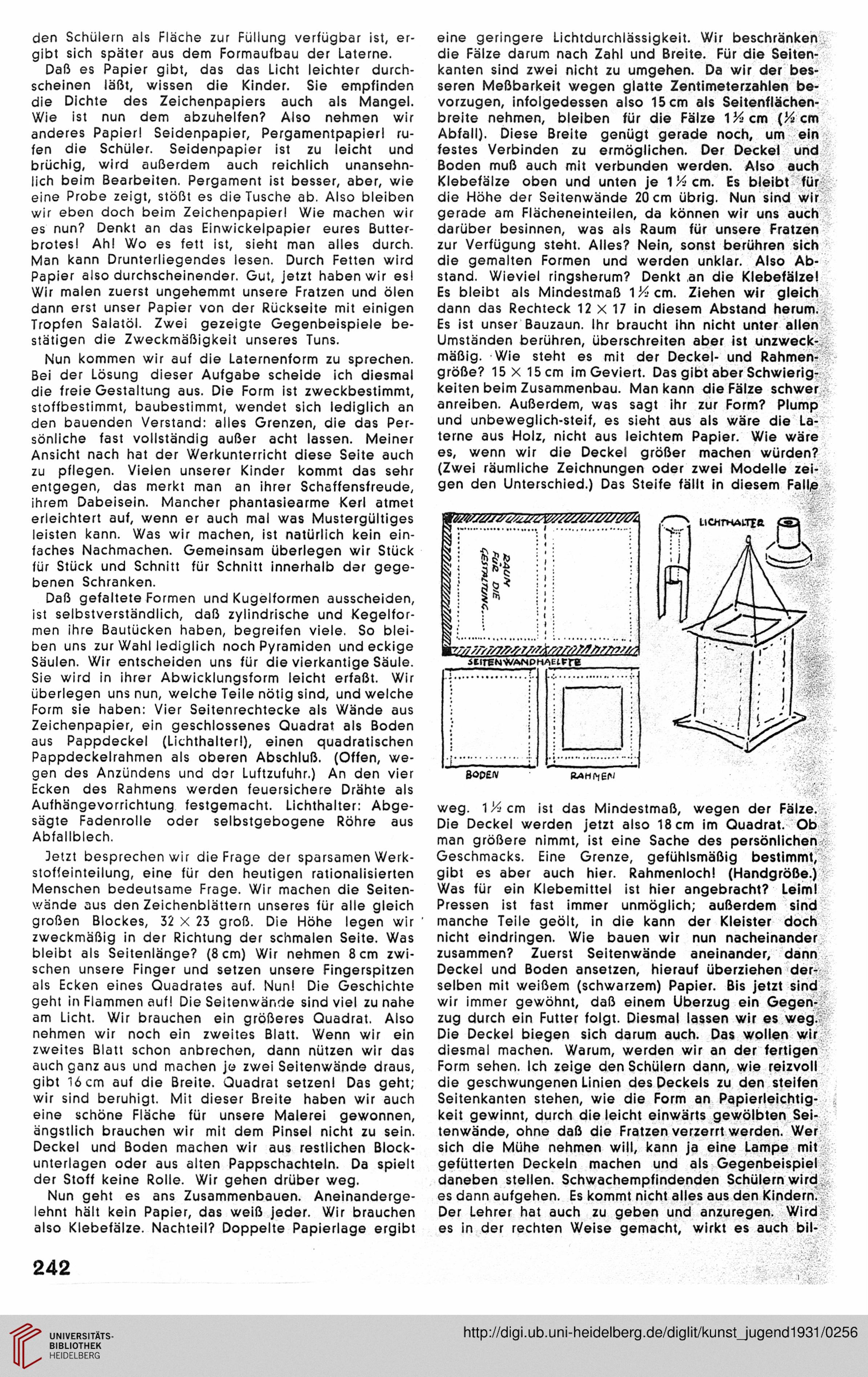den Schülern als Fläche zur Füllung verfügbar ist, er-
gibt sich später aus dem Formaufbau der Laterne.
Daß es Papier gibt, das das Licht leichter durch-
scheinen läßt, wissen die Kinder. Sie empfinden
die Dichte des Zeichenpapiers auch als Mangel.
Wie ist nun dem abzuhelfen? Also nehmen wir
anderes Papierl Seidenpapier, Pergamentpapierl ru-
fen die Schüler. Seidenpapier ist zu leicht und
brüchig, wird außerdem auch reichlich unansehn-
lich beim Bearbeiten. Pergament ist besser, aber, wie
eine Probe zeigt, stößt es die Tusche ab. Also bleiben
wir eben doch beim Zeichenpapierl Wie machen wir
es nun? Denkt an das Einwickelpapier eures Butter-
brotes! Ah! Wo es fett ist, sieht man alles durch.
Man kann Drunterliegendes lesen. Durch Fetten wird
Papier also durchscheinender. Gut, jetzt haben wir esl
Wir malen zuerst ungehemmt unsere Fratzen und ölen
dann erst unser Papier von der Rückseite mit einigen
Tropfen Salatöl. Zwei gezeigte Gegenbeispiele be-
stätigen die Zweckmäßigkeit unseres Tuns.
Nun kommen wir auf die Laternenform zu sprechen.
Bei der Lösung dieser Aufgabe scheide ich diesmal
die freie Gestaltung aus. Die Form ist zweckbestimmt,
stoffbestimmt, baubestimmt, wendet sich lediglich an
den bauenden Verstand: alles Grenzen, die das Per-
sönliche fast vollständig außer acht lassen. Meiner
Ansicht nach hat der Werkunterricht diese Seite auch
zu pflegen. Vielen unserer Kinder kommt das sehr
entgegen, das merkt man an ihrer Schaffensfreude,
ihrem Dabeisein. Mancher phantasiearme Kerl atmet
erleichtert auf, wenn er auch mal was Mustergültiges
leisten kann. Was wir machen, ist natürlich kein ein-
faches Nachmachen. Gemeinsam überlegen wir Stück
für Stück und Schnitt für Schnitt innerhalb der gege-
benen Schranken.
Daß gefaltete Formen und Kugelformen ausscheiden,
ist selbstverständlich, daß zylindrische und Kegelfor-
men ihre Bautücken haben, begreifen viele. So blei-
ben uns zur Wahl lediglich noch Pyramiden und eckige
Säulen. Wir entscheiden uns für die vierkantige Säule.
Sie wird in ihrer Abwicklungsform leicht erfaßt. Wir
überlegen uns nun, welche Teile nötig sind, und welche
Form sie haben: Vier Seitenrechtecke als Wände aus
Zeichenpapier, ein geschlossenes Quadrat als Boden
aus Pappdeckel (Lichthalteri), einen quadratischen
Pappdeckelrahmen als oberen Abschluß. (Offen, we-
gen des Anzündens und der Luftzufuhr.) An den vier
Ecken des Rahmens werden feuersichere Drähte als
Aufhängevorrichtung festgemacht. Lichthalter: Abge-
sägte Fadenrolle oder selbstgebogene Röhre aus
Abfallblech.
Jetzt besprechen wir die Frage der sparsamen Werk-
stoffeinteilung, eine für den heutigen rationalisierten
Menschen bedeutsame Frage. Wir machen die Seiten-
wände aus den Zeichenblättern unseres für alle gleich
großen Blockes, 32 X 23 groß. Die Höhe legen wir
zweckmäßig in der Richtung der schmalen Seite. Was
bleibt als Seitenlange? (8 cm) Wir nehmen 8 cm zwi-
schen unsere Finger und setzen unsere Fingerspitzen
als Ecken eines Quadrates auf. Nun! Die Geschichte
geht in Flammen auf! Die Seitenwände sind viel zu nahe
am Licht. Wir brauchen ein größeres Quadrat. Also
nehmen wir noch ein zweites Blatt. Wenn wir ein
zweites Blatt schon anbrechen, dann nützen wir das
auch ganz aus und machen je zwei Seitenwände draus,
gibt 16 cm auf die Breite. Quadrat setzenl Das geht;
wir sind beruhigt. Mit dieser Breite haben wir auch
eine schöne Fläche für unsere Malerei gewonnen,
ängstlich brauchen wir mit dem Pinsel nicht zu sein.
Deckel und Boden machen wir aus restlichen Block-
unterlagen oder aus alten Pappschachteln. Da spielt
der Stoff keine Rolle. Wir gehen drüber weg.
Nun geht es ans Zusammenbauen. Aneinanderge-
lehnt hält kein Papier, das weiß jeder. Wir brauchen
also Klebefälze. Nachteil? Doppelte Papierlage ergibt
eine geringere Lichtdurchlässigkeit. Wir beschränken
die Fälze darum nach Zahl und Breite. Für die Seiten-
kanten sind zwei nicht zu umgehen. Da wir der bes-
seren Meßbarkeit wegen glatte Zentimeterzahlen be-
vorzugen, infolgedessen also 15 cm als Seitenflächen-
breite nehmen, bleiben für die Fälze 1%cm (Kem
Abfall). Diese Breite genügt gerade noch, um ein
festes Verbinden zu ermöglichen. Der Deckel und
Boden muß auch mit verbunden werden. Also auch
Klebefälze oben und unten je 1%cm. Es bleibt für
die Höhe der Seitenwände 20 cm übrig. Nun sind wir
gerade am Flächeneinteilen, da können wir uns auch
darüber besinnen, was als Raum für unsere Fratzen
zur Verfügung steht. Alles? Nein, sonst berühren sich
die gemalten Formen und werden unklar. Also Ab-
stand. Wieviel ringsherum? Denkt an die Klebefälze!
Es bleibt als Mindestmaß 1%cm. Ziehen wir gleich
dann das Rechteck 12 X 17 in diesem Abstand herum.
Es ist unser Bauzaun. Ihr braucht ihn nicht unter allen
Umständen berühren, überschreiten aber ist unzweck-
mäßig. Wie steht es mit der Deckel- und Rahmen-
größe? 15X15cm im Geviert. Das gibt aber Schwierig-
keiten beim Zusammenbau. Man kann die Fälze schwer
anreiben. Außerdem, was sagt ihr zur Form? Plump
und unbeweglich-steif, es sieht aus als wäre die La-
terne aus Holz, nicht aus leichtem Papier. Wie wäre
es, wenn wir die Deckel größer machen würden?
(Zwei räumliche Zeichnungen oder zwei Modelle zei-
gen den Unterschied.) Das Steife fällt in diesem Falle
weg. 1/4 cm ist das Mindestmaß, wegen der Fälze.
Die Deckel werden jetzt also 18 cm im Quadrat. Ob?
man größere nimmt, ist eine Sache des persönlichen
Geschmacks. Eine Grenze, gefühlsmäßig bestimmt,
gibt es aber auch hier. Rahmenloch! (Handgroße.)
Was für ein Klebemittel ist hier angebracht? Leiml
Pressen ist fast immer unmöglich; außerdem sind
manche Teile geölt, in die kann der Kleister doch
nicht eindringen. Wie bauen wir nun nacheinander
zusammen? Zuerst Seitenwände aneinander, dann
Deckel und Boden ansetzen, hierauf überziehen der-
selben mit weißem (schwarzem) Papier. Bis jetzt sind
wir immer gewöhnt, daß einem Überzug ein Gegen-
zug durch ein Futter folgt. Diesmal lassen wir es weg.
Die Deckel biegen sich darum auch. Das wollen wir
diesmal machen. Warum, werden wir an der fertigen
Form sehen. Ich zeige den Schülern dann, wie reizvoll
die geschwungenen Linien des Deckels zu den steifen
Seitenkanten stehen, wie die Form an Papierleichtig-
keit gewinnt, durch die leicht einwärts gewölbten Sei-
tenwände, ohne daß die Fratzen verzerrt werden. Wer
sich die Mühe nehmen will, kann ja eine Lampe mit
gefütterten Deckeln machen und als Gegenbeispiel
daneben stellen. Schwachempfindenden Schülern wird
es dann aufgehen. Es kommt nicht alles aus den Kindern.
Der Lehrer hat auch zu geben und anzuregen. Wird
es in der rechten Weise gemacht, wirkt es auch bil-
....!
ßOpEN
RAHNEN
§ $ b
5^
.' ■■.'■
242
gibt sich später aus dem Formaufbau der Laterne.
Daß es Papier gibt, das das Licht leichter durch-
scheinen läßt, wissen die Kinder. Sie empfinden
die Dichte des Zeichenpapiers auch als Mangel.
Wie ist nun dem abzuhelfen? Also nehmen wir
anderes Papierl Seidenpapier, Pergamentpapierl ru-
fen die Schüler. Seidenpapier ist zu leicht und
brüchig, wird außerdem auch reichlich unansehn-
lich beim Bearbeiten. Pergament ist besser, aber, wie
eine Probe zeigt, stößt es die Tusche ab. Also bleiben
wir eben doch beim Zeichenpapierl Wie machen wir
es nun? Denkt an das Einwickelpapier eures Butter-
brotes! Ah! Wo es fett ist, sieht man alles durch.
Man kann Drunterliegendes lesen. Durch Fetten wird
Papier also durchscheinender. Gut, jetzt haben wir esl
Wir malen zuerst ungehemmt unsere Fratzen und ölen
dann erst unser Papier von der Rückseite mit einigen
Tropfen Salatöl. Zwei gezeigte Gegenbeispiele be-
stätigen die Zweckmäßigkeit unseres Tuns.
Nun kommen wir auf die Laternenform zu sprechen.
Bei der Lösung dieser Aufgabe scheide ich diesmal
die freie Gestaltung aus. Die Form ist zweckbestimmt,
stoffbestimmt, baubestimmt, wendet sich lediglich an
den bauenden Verstand: alles Grenzen, die das Per-
sönliche fast vollständig außer acht lassen. Meiner
Ansicht nach hat der Werkunterricht diese Seite auch
zu pflegen. Vielen unserer Kinder kommt das sehr
entgegen, das merkt man an ihrer Schaffensfreude,
ihrem Dabeisein. Mancher phantasiearme Kerl atmet
erleichtert auf, wenn er auch mal was Mustergültiges
leisten kann. Was wir machen, ist natürlich kein ein-
faches Nachmachen. Gemeinsam überlegen wir Stück
für Stück und Schnitt für Schnitt innerhalb der gege-
benen Schranken.
Daß gefaltete Formen und Kugelformen ausscheiden,
ist selbstverständlich, daß zylindrische und Kegelfor-
men ihre Bautücken haben, begreifen viele. So blei-
ben uns zur Wahl lediglich noch Pyramiden und eckige
Säulen. Wir entscheiden uns für die vierkantige Säule.
Sie wird in ihrer Abwicklungsform leicht erfaßt. Wir
überlegen uns nun, welche Teile nötig sind, und welche
Form sie haben: Vier Seitenrechtecke als Wände aus
Zeichenpapier, ein geschlossenes Quadrat als Boden
aus Pappdeckel (Lichthalteri), einen quadratischen
Pappdeckelrahmen als oberen Abschluß. (Offen, we-
gen des Anzündens und der Luftzufuhr.) An den vier
Ecken des Rahmens werden feuersichere Drähte als
Aufhängevorrichtung festgemacht. Lichthalter: Abge-
sägte Fadenrolle oder selbstgebogene Röhre aus
Abfallblech.
Jetzt besprechen wir die Frage der sparsamen Werk-
stoffeinteilung, eine für den heutigen rationalisierten
Menschen bedeutsame Frage. Wir machen die Seiten-
wände aus den Zeichenblättern unseres für alle gleich
großen Blockes, 32 X 23 groß. Die Höhe legen wir
zweckmäßig in der Richtung der schmalen Seite. Was
bleibt als Seitenlange? (8 cm) Wir nehmen 8 cm zwi-
schen unsere Finger und setzen unsere Fingerspitzen
als Ecken eines Quadrates auf. Nun! Die Geschichte
geht in Flammen auf! Die Seitenwände sind viel zu nahe
am Licht. Wir brauchen ein größeres Quadrat. Also
nehmen wir noch ein zweites Blatt. Wenn wir ein
zweites Blatt schon anbrechen, dann nützen wir das
auch ganz aus und machen je zwei Seitenwände draus,
gibt 16 cm auf die Breite. Quadrat setzenl Das geht;
wir sind beruhigt. Mit dieser Breite haben wir auch
eine schöne Fläche für unsere Malerei gewonnen,
ängstlich brauchen wir mit dem Pinsel nicht zu sein.
Deckel und Boden machen wir aus restlichen Block-
unterlagen oder aus alten Pappschachteln. Da spielt
der Stoff keine Rolle. Wir gehen drüber weg.
Nun geht es ans Zusammenbauen. Aneinanderge-
lehnt hält kein Papier, das weiß jeder. Wir brauchen
also Klebefälze. Nachteil? Doppelte Papierlage ergibt
eine geringere Lichtdurchlässigkeit. Wir beschränken
die Fälze darum nach Zahl und Breite. Für die Seiten-
kanten sind zwei nicht zu umgehen. Da wir der bes-
seren Meßbarkeit wegen glatte Zentimeterzahlen be-
vorzugen, infolgedessen also 15 cm als Seitenflächen-
breite nehmen, bleiben für die Fälze 1%cm (Kem
Abfall). Diese Breite genügt gerade noch, um ein
festes Verbinden zu ermöglichen. Der Deckel und
Boden muß auch mit verbunden werden. Also auch
Klebefälze oben und unten je 1%cm. Es bleibt für
die Höhe der Seitenwände 20 cm übrig. Nun sind wir
gerade am Flächeneinteilen, da können wir uns auch
darüber besinnen, was als Raum für unsere Fratzen
zur Verfügung steht. Alles? Nein, sonst berühren sich
die gemalten Formen und werden unklar. Also Ab-
stand. Wieviel ringsherum? Denkt an die Klebefälze!
Es bleibt als Mindestmaß 1%cm. Ziehen wir gleich
dann das Rechteck 12 X 17 in diesem Abstand herum.
Es ist unser Bauzaun. Ihr braucht ihn nicht unter allen
Umständen berühren, überschreiten aber ist unzweck-
mäßig. Wie steht es mit der Deckel- und Rahmen-
größe? 15X15cm im Geviert. Das gibt aber Schwierig-
keiten beim Zusammenbau. Man kann die Fälze schwer
anreiben. Außerdem, was sagt ihr zur Form? Plump
und unbeweglich-steif, es sieht aus als wäre die La-
terne aus Holz, nicht aus leichtem Papier. Wie wäre
es, wenn wir die Deckel größer machen würden?
(Zwei räumliche Zeichnungen oder zwei Modelle zei-
gen den Unterschied.) Das Steife fällt in diesem Falle
weg. 1/4 cm ist das Mindestmaß, wegen der Fälze.
Die Deckel werden jetzt also 18 cm im Quadrat. Ob?
man größere nimmt, ist eine Sache des persönlichen
Geschmacks. Eine Grenze, gefühlsmäßig bestimmt,
gibt es aber auch hier. Rahmenloch! (Handgroße.)
Was für ein Klebemittel ist hier angebracht? Leiml
Pressen ist fast immer unmöglich; außerdem sind
manche Teile geölt, in die kann der Kleister doch
nicht eindringen. Wie bauen wir nun nacheinander
zusammen? Zuerst Seitenwände aneinander, dann
Deckel und Boden ansetzen, hierauf überziehen der-
selben mit weißem (schwarzem) Papier. Bis jetzt sind
wir immer gewöhnt, daß einem Überzug ein Gegen-
zug durch ein Futter folgt. Diesmal lassen wir es weg.
Die Deckel biegen sich darum auch. Das wollen wir
diesmal machen. Warum, werden wir an der fertigen
Form sehen. Ich zeige den Schülern dann, wie reizvoll
die geschwungenen Linien des Deckels zu den steifen
Seitenkanten stehen, wie die Form an Papierleichtig-
keit gewinnt, durch die leicht einwärts gewölbten Sei-
tenwände, ohne daß die Fratzen verzerrt werden. Wer
sich die Mühe nehmen will, kann ja eine Lampe mit
gefütterten Deckeln machen und als Gegenbeispiel
daneben stellen. Schwachempfindenden Schülern wird
es dann aufgehen. Es kommt nicht alles aus den Kindern.
Der Lehrer hat auch zu geben und anzuregen. Wird
es in der rechten Weise gemacht, wirkt es auch bil-
....!
ßOpEN
RAHNEN
§ $ b
5^
.' ■■.'■
242