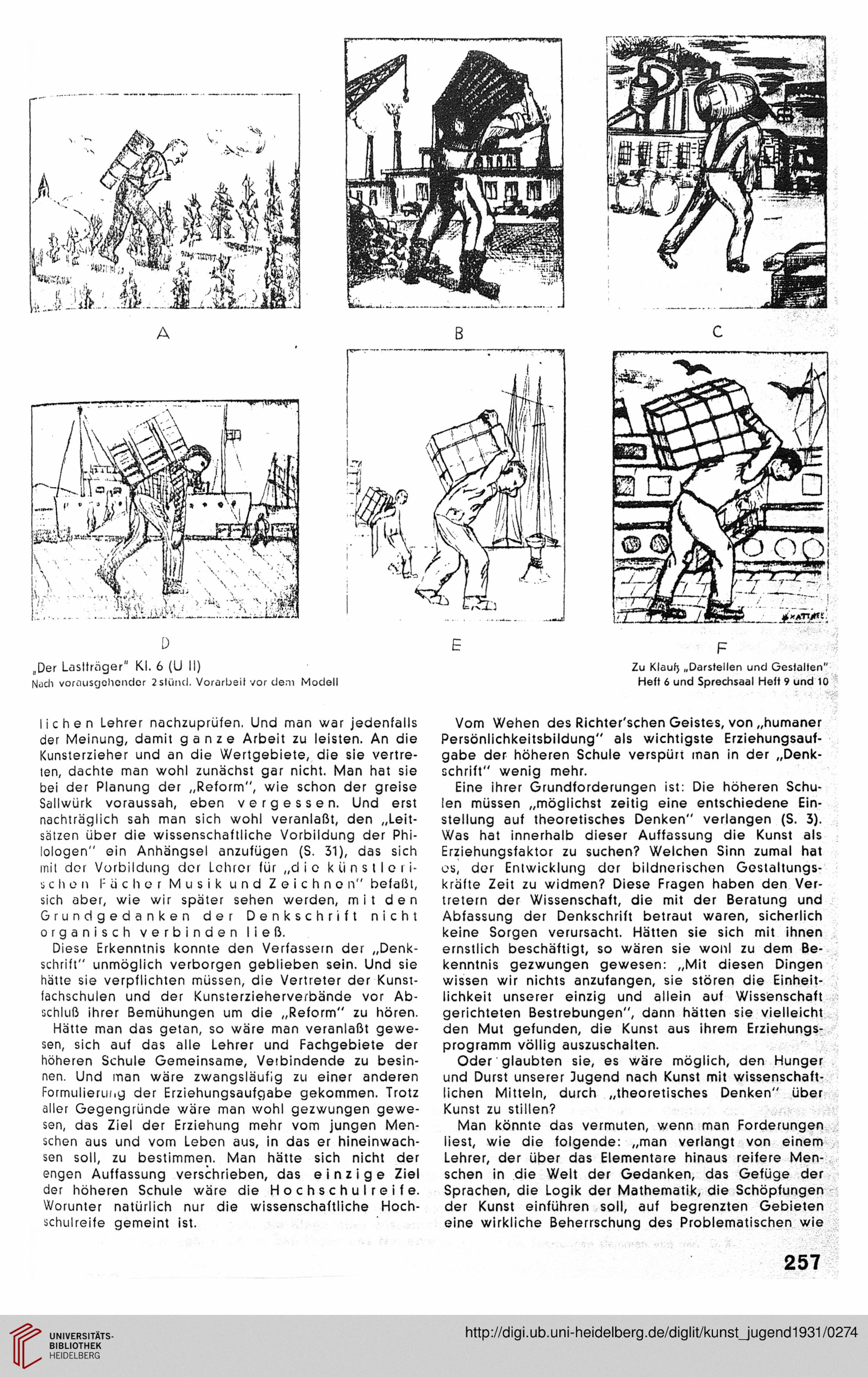B
D E
„Der Lastträger" Kl. 6 (U II)
Nadi vorausgohcndor 2slünd. Vorarbeit vor dem Modell
F
Zu Klaufj „Darstellen und Gestalten"
Heft 6 und Sprechsaal Heft 9 und 10
liehen Lehrer nachzuprüfen. Und man war jedenfalls
der Meinung, damit ganze Arbeit zu leisten. An die
Kunsterzieher und an die Wertgebiete, die sie vertre-
ten, dachte man wohl zunächst gar nicht. Man hat sie
bei der Planung der „Reform", wie schon der greise
Sallwürk voraussah, eben vergessen. Und erst
nachträglich sah man sich wohl veranlaßt, den „Leit-
sätzen über die wissenschaftliche Vorbildung der Phi-
lologen" ein Anhängsel anzufügen (S. 31), das sich
mit der Vorbildung der Lehret für „die künstlet i-
schon Fächer Musik und Zeichne n" befaßt,
sich aber, wie wir später sehen werden, mit den
Grundgedanken der Denkschrift nicht
organisch verbinden ließ.
Diese Erkenntnis konnte den Verfassern der „Denk-
schrift" unmöglich verborgen geblieben sein. Und sie
hätte sie verpflichten müssen, die Vertreter der Kunst-
fachschulen und der Kunsterzieherverbände vor Ab-
schluß ihrer Bemühungen um die „Reform" zu hören.
Hätte man das getan, so wäre man veranlaßt gewe-
sen, sich auf das alle Lehrer und Fachgebiete der
höheren Schule Gemeinsame, Verbindende zu besin-
nen. Und inan wäre zwangsläufig zu einer anderen
Formulierung der Erziehungsaufgabe gekommen. Trotz
aller Gegengründe wäre man wohl gezwungen gewe-
sen, das Ziel der Erziehung mehr vom jungen Men-
schen aus und vom Leben aus, in das er hineinwach-
sen soll, zu bestimmen. Man hätte sich nicht der
engen Auffassung verschrieben, das einzige Ziel
der höheren Schule wäre die Hochschulreife.
Worunter natürlich nur die wissenschaftliche Hoch-
schulreife gemeint ist.
Vom Wehen des Richter'schen Geistes, von „humaner
Persönlichkeitsbildung" als wichtigste Erziehungsauf-
gabe der höheren Schule verspürt man in der „Denk-
schrift" wenig mehr.
Eine ihrer Grundforderungen ist: Die höheren Schu-
len müssen „möglichst zeitig eine entschiedene Ein-
stellung auf theoretisches Denken" verlangen (S. 3).
Was hat innerhalb dieser Auffassung die Kunst als
Erziehungsfaktor zu suchen? Welchen Sinn zumal hat
es, der Entwicklung der bildnerischen Gestaltungs-
kräfte Zeit zu widmen? Diese Fragen haben den Ver-
tretern der Wissenschaft, die mit der Beratung und
Abfassung der Denkschrift betraut waren, sicherlich
keine Sorgen verursacht. Hätten sie sich mit ihnen
ernstlich beschäftigt, so wären sie wonl zu dem Be-
kenntnis gezwungen gewesen: „Mit diesen Dingen
wissen wir nichts anzufangen, sie stören die Einheit-
lichkeit unserer einzig und allein auf Wissenschaft
gerichteten Bestrebungen", dann hätten sie vielleicht
den Mut gefunden, die Kunst aus ihrem Erziehungs-
programm völlig auszuschalten.
Oder glaubten sie, es wäre möglich, den Hunger
und Durst unserer Jugend nach Kunst mit wissenschaft-
lichen Mitteln, durch „theoretisches Denken" über
Kunst zu stillen?
Man könnte das vermuten, wenn man Forderungen
liest, wie die folgende: „man verlangt von einem
Lehrer, der über das Elementare hinaus reifere Men-
schen in die Welt der Gedanken, das Gefüge der
Sprachen, die Logik der Mathematik, die Schöpfungen
der Kunst einführen soll, auf begrenzten Gebieten
eine wirkliche Beherrschung des Problematischen wie
257