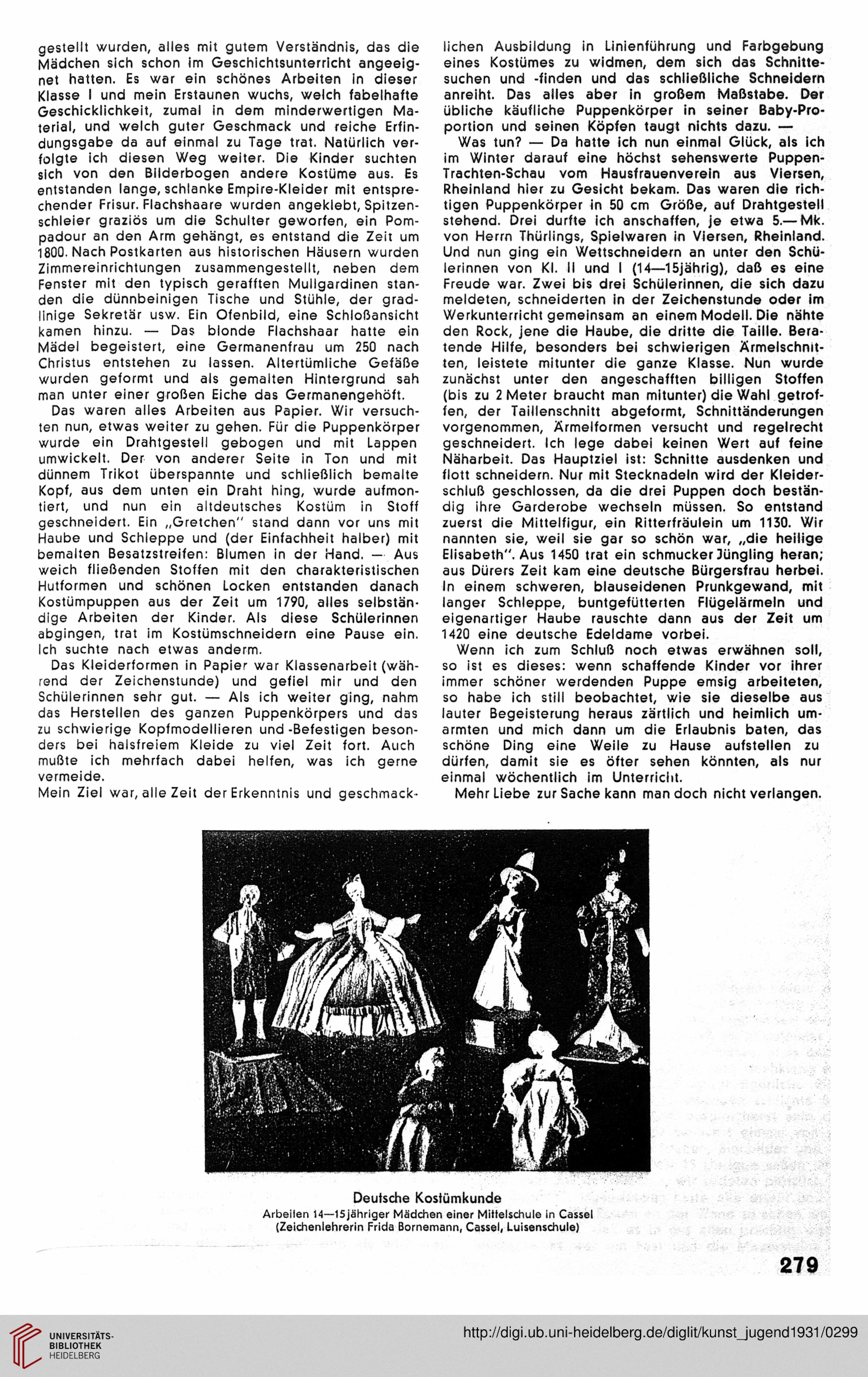gestellt wurden, alles mit gutem Verständnis, das die
Mädchen sich schon im Geschichtsunterricht angeeig-
net hatten. Es war ein schönes Arbeiten in dieser
Klasse I und mein Erstaunen wuchs, welch fabelhafte
Geschicklichkeit, zumal in dem minderwertigen Ma-
terial, und welch guter Geschmack und reiche Erfin-
dungsgabe da auf einmal zu Tage trat. Natürlich ver-
folgte ich diesen Weg weiter. Die Kinder suchten
sich von den Bilderbogen andere Kostüme aus. Es
entstanden lange, schlanke Empire-Kleider mit entspre-
chender Frisur. Flachshaare wurden angeklebt, Spitzen-
schleier graziös um die Schulter geworfen, ein Pom-
padour an den Arm gehängt, es entstand die Zeit um
1800. Nach Postkarten aus historischen Häusern wurden
Zimmereinrichtungen zusammengestellt, neben dem
Fenster mit den typisch gerafften Mullgardinen stan-
den die dünnbeinigen Tische und Stühle, der grad-
linige Sekretär usw. Ein Ofenbild, eine Schloßansicht
kamen hinzu. — Das blonde Flachshaar hatte ein
Mädel begeistert, eine Germanenfrau um 250 nach
Christus entstehen zu lassen. Altertümliche Gefäße
wurden geformt und als gemalten Hintergrund sah
man unter einer großen Eiche das Germanengehöft.
Das waren alles Arbeiten aus Papier. Wir versuch-
ten nun, etwas weiter zu gehen. Für die Puppenkörper
wurde ein Drahtgestell gebogen und mit Lappen
umwickelt. Der von anderer Seite in Ton und mit
dünnem Trikot überspannte und schließlich bemalte
Kopf, aus dem unten ein Draht hing, wurde aufmon-
tiert, und nun ein altdeutsches Kostüm in Stoff
geschneidert. Ein „Gretchen” stand dann vor uns mit
Haube und Schleppe und (der Einfachheit halber) mit
bemalten Besatzstreifen: Blumen in der Hand. — Aus
weich fließenden Stoffen mit den charakteristischen
Hutformen und schönen Locken entstanden danach
Kostümpuppen aus der Zeit um 1790, alles selbstän-
dige Arbeiten der Kinder. Als diese Schülerinnen
abgingen, trat im Kostümschneidern eine Pause ein.
Ich suchte nach etwas anderm.
Das Kleiderformen in Papier war Klassenarbeit (wäh-
rend der Zeichenstunde) und gefiel mir und den
Schülerinnen sehr gut. — Als ich weiter ging, nahm
das Herstellen des ganzen Puppenkörpers und das
zu schwierige Kopfmodellieren und-Befestigen beson-
ders bei halsfreiem Kleide zu viel Zeit fort. Auch
mußte ich mehrfach dabei helfen, was ich gerne
vermeide.
Mein Ziel war, alle Zeit der Erkenntnis und geschmack-
lichen Ausbildung in Linienführung und Farbgebung
eines Kostümes zu widmen, dem sich das Schnitte-
suchen und -finden und das schließliche Schneidern
anreiht. Das alles aber in großem Maßstabe. Der
übliche käufliche Puppenkörper in seiner Baby-Pro-
portion und seinen Köpfen taugt nichts dazu. —
Was tun? — Da hatte ich nun einmal Glück, als ich
im Winter darauf eine höchst sehenswerte Puppen-
Trachten-Schau vom Hausfrauenverein aus Viersen,
Rheinland hier zu Gesicht bekam. Das waren die rich-
tigen Puppenkörper in 50 cm Größe, auf Drahtgestell
stehend. Drei durfte Ich anschaffen, je etwa 5.— Mk.
von Herrn Thürlings, Spielwaren in Viersen, Rheinland.
Und nun ging ein Wettschneidern an unter den Schü-
lerinnen von Kl. II und I (14—15jährig), daß es eine
Freude war. Zwei bis drei Schülerinnen, die sich dazu
meldeten, schneiderten in der Zeichenstunde oder im
Werkunterricht gemeinsam an einem Modell. Die nähte
den Rock, jene die Haube, die dritte die Taille. Bera-
tende Hilfe, besonders bei schwierigen Ärmelschnit-
ten, leistete mitunter die ganze Klasse. Nun wurde
zunächst unter den angeschafften billigen Stoffen
(bis zu 2 Meter braucht man mitunter) die Wahl getrof-
fen, der Taillenschnitt abgeformt, Schnittänderungen
vorgenommen, Ärmelformen versucht und regelrecht
geschneidert. Ich lege dabei keinen Wert auf feine
Näharbeit. Das Hauptziel ist: Schnitte ausdenken und
flott schneidern. Nur mit Stecknadeln wird der Kleider-
schluß geschlossen, da die drei Puppen doch bestän-
dig ihre Garderobe wechseln müssen. So entstand
zuerst die Mittelfigur, ein Ritterfräulein um 1130. Wir
nannten sie, weil sie gar so schön war, „die heilige
Elisabeth". Aus 1450 trat ein schmucker Jüngling heran;
aus Dürers Zeit kam eine deutsche Bürgersfrau herbei.
In einem schweren, blauseidenen Prunkgewand, mit
langer Schleppe, buntgefütterten Flügelärmeln und
eigenartiger Haube rauschte dann aus der Zeit um
1420 eine deutsche Edeldame vorbei.
Wenn ich zum Schluß noch etwas erwähnen soll,
so ist es dieses: wenn schaffende Kinder vor ihrer
immer schöner werdenden Puppe emsig arbeiteten,
so habe ich still beobachtet, wie sie dieselbe aus
lauter Begeisterung heraus zärtlich und heimlich um-
armten und mich dann um die Erlaubnis baten, das
schöne Ding eine Weile zu Hause aufstellen zu
dürfen, damit sie es öfter sehen könnten, als nur
einmal wöchentlich im Unterricht.
Mehr Liebe zur Sache kann man doch nicht verlangen.
Deutsche Kostümkunde
Arbeiten 14—15 jähriger Mädchen einer Mittelschule in Cassel
(Zeichenlehrerin Frida Bornemann, Cassel, Luisenschule)
279
Mädchen sich schon im Geschichtsunterricht angeeig-
net hatten. Es war ein schönes Arbeiten in dieser
Klasse I und mein Erstaunen wuchs, welch fabelhafte
Geschicklichkeit, zumal in dem minderwertigen Ma-
terial, und welch guter Geschmack und reiche Erfin-
dungsgabe da auf einmal zu Tage trat. Natürlich ver-
folgte ich diesen Weg weiter. Die Kinder suchten
sich von den Bilderbogen andere Kostüme aus. Es
entstanden lange, schlanke Empire-Kleider mit entspre-
chender Frisur. Flachshaare wurden angeklebt, Spitzen-
schleier graziös um die Schulter geworfen, ein Pom-
padour an den Arm gehängt, es entstand die Zeit um
1800. Nach Postkarten aus historischen Häusern wurden
Zimmereinrichtungen zusammengestellt, neben dem
Fenster mit den typisch gerafften Mullgardinen stan-
den die dünnbeinigen Tische und Stühle, der grad-
linige Sekretär usw. Ein Ofenbild, eine Schloßansicht
kamen hinzu. — Das blonde Flachshaar hatte ein
Mädel begeistert, eine Germanenfrau um 250 nach
Christus entstehen zu lassen. Altertümliche Gefäße
wurden geformt und als gemalten Hintergrund sah
man unter einer großen Eiche das Germanengehöft.
Das waren alles Arbeiten aus Papier. Wir versuch-
ten nun, etwas weiter zu gehen. Für die Puppenkörper
wurde ein Drahtgestell gebogen und mit Lappen
umwickelt. Der von anderer Seite in Ton und mit
dünnem Trikot überspannte und schließlich bemalte
Kopf, aus dem unten ein Draht hing, wurde aufmon-
tiert, und nun ein altdeutsches Kostüm in Stoff
geschneidert. Ein „Gretchen” stand dann vor uns mit
Haube und Schleppe und (der Einfachheit halber) mit
bemalten Besatzstreifen: Blumen in der Hand. — Aus
weich fließenden Stoffen mit den charakteristischen
Hutformen und schönen Locken entstanden danach
Kostümpuppen aus der Zeit um 1790, alles selbstän-
dige Arbeiten der Kinder. Als diese Schülerinnen
abgingen, trat im Kostümschneidern eine Pause ein.
Ich suchte nach etwas anderm.
Das Kleiderformen in Papier war Klassenarbeit (wäh-
rend der Zeichenstunde) und gefiel mir und den
Schülerinnen sehr gut. — Als ich weiter ging, nahm
das Herstellen des ganzen Puppenkörpers und das
zu schwierige Kopfmodellieren und-Befestigen beson-
ders bei halsfreiem Kleide zu viel Zeit fort. Auch
mußte ich mehrfach dabei helfen, was ich gerne
vermeide.
Mein Ziel war, alle Zeit der Erkenntnis und geschmack-
lichen Ausbildung in Linienführung und Farbgebung
eines Kostümes zu widmen, dem sich das Schnitte-
suchen und -finden und das schließliche Schneidern
anreiht. Das alles aber in großem Maßstabe. Der
übliche käufliche Puppenkörper in seiner Baby-Pro-
portion und seinen Köpfen taugt nichts dazu. —
Was tun? — Da hatte ich nun einmal Glück, als ich
im Winter darauf eine höchst sehenswerte Puppen-
Trachten-Schau vom Hausfrauenverein aus Viersen,
Rheinland hier zu Gesicht bekam. Das waren die rich-
tigen Puppenkörper in 50 cm Größe, auf Drahtgestell
stehend. Drei durfte Ich anschaffen, je etwa 5.— Mk.
von Herrn Thürlings, Spielwaren in Viersen, Rheinland.
Und nun ging ein Wettschneidern an unter den Schü-
lerinnen von Kl. II und I (14—15jährig), daß es eine
Freude war. Zwei bis drei Schülerinnen, die sich dazu
meldeten, schneiderten in der Zeichenstunde oder im
Werkunterricht gemeinsam an einem Modell. Die nähte
den Rock, jene die Haube, die dritte die Taille. Bera-
tende Hilfe, besonders bei schwierigen Ärmelschnit-
ten, leistete mitunter die ganze Klasse. Nun wurde
zunächst unter den angeschafften billigen Stoffen
(bis zu 2 Meter braucht man mitunter) die Wahl getrof-
fen, der Taillenschnitt abgeformt, Schnittänderungen
vorgenommen, Ärmelformen versucht und regelrecht
geschneidert. Ich lege dabei keinen Wert auf feine
Näharbeit. Das Hauptziel ist: Schnitte ausdenken und
flott schneidern. Nur mit Stecknadeln wird der Kleider-
schluß geschlossen, da die drei Puppen doch bestän-
dig ihre Garderobe wechseln müssen. So entstand
zuerst die Mittelfigur, ein Ritterfräulein um 1130. Wir
nannten sie, weil sie gar so schön war, „die heilige
Elisabeth". Aus 1450 trat ein schmucker Jüngling heran;
aus Dürers Zeit kam eine deutsche Bürgersfrau herbei.
In einem schweren, blauseidenen Prunkgewand, mit
langer Schleppe, buntgefütterten Flügelärmeln und
eigenartiger Haube rauschte dann aus der Zeit um
1420 eine deutsche Edeldame vorbei.
Wenn ich zum Schluß noch etwas erwähnen soll,
so ist es dieses: wenn schaffende Kinder vor ihrer
immer schöner werdenden Puppe emsig arbeiteten,
so habe ich still beobachtet, wie sie dieselbe aus
lauter Begeisterung heraus zärtlich und heimlich um-
armten und mich dann um die Erlaubnis baten, das
schöne Ding eine Weile zu Hause aufstellen zu
dürfen, damit sie es öfter sehen könnten, als nur
einmal wöchentlich im Unterricht.
Mehr Liebe zur Sache kann man doch nicht verlangen.
Deutsche Kostümkunde
Arbeiten 14—15 jähriger Mädchen einer Mittelschule in Cassel
(Zeichenlehrerin Frida Bornemann, Cassel, Luisenschule)
279