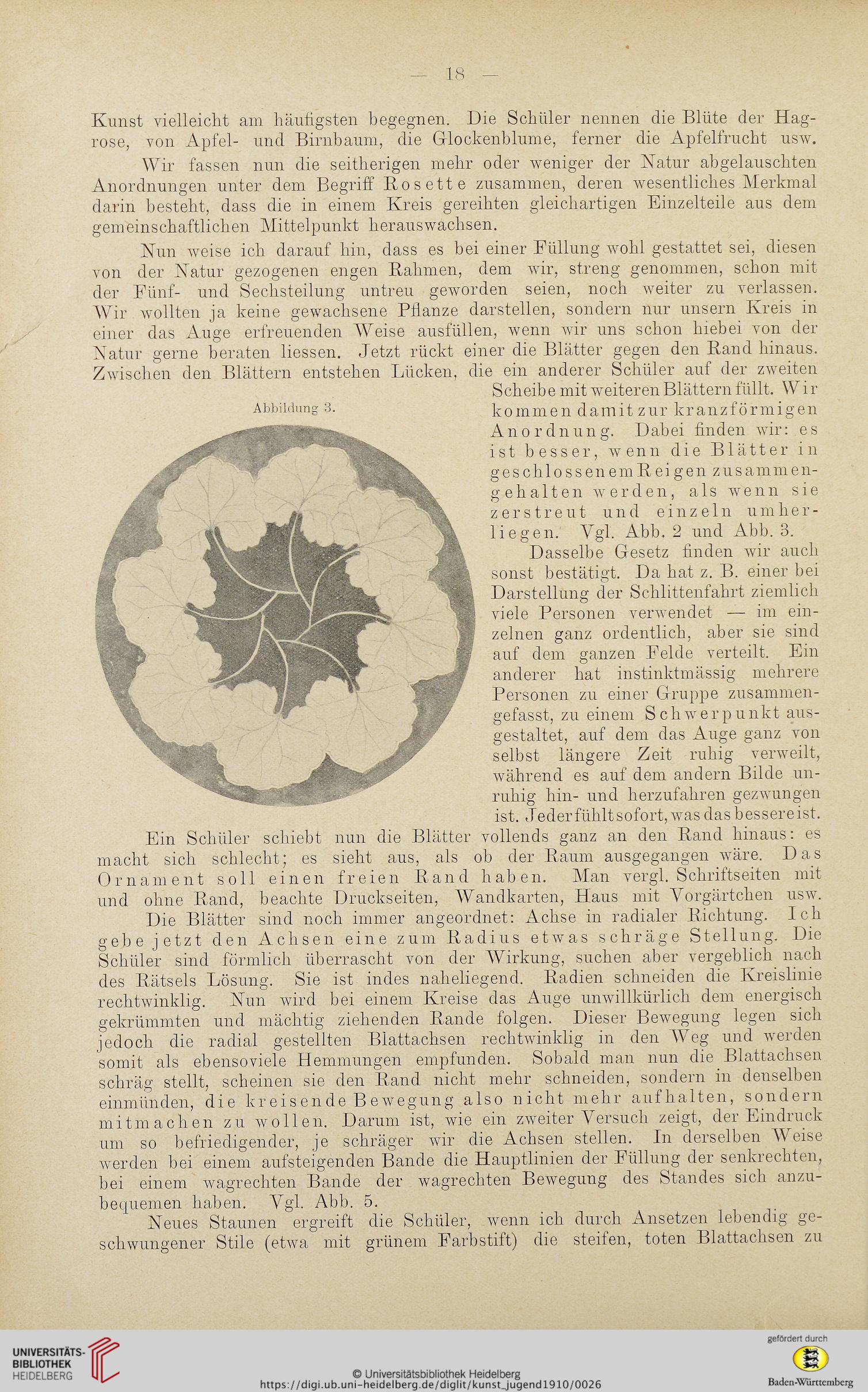18
Kunst vielleicht am häufigsten begegnen. Die Schüler nennen die Blüte der Hag-
rose, von Apfel- und Birnbaum, die Glockenblume, ferner die Apfelfrucht usw.
Wir fassen nun die seitherigen mehr oder weniger der Natur abgelauschten
Anordnungen unter dem Begriff Bosette zusammen, deren wesentliches Merkmal
darin besteht, dass die in einem Kreis gereihten gleichartigen Einzelteile aus dem
gemeinschaftlichen Mittelpunkt herauswachsen.
Nun weise ich darauf hin, dass es bei einer Füllung wohl gestattet sei, diesen
von der Natur gezogenen engen Rahmen, dem wir, streng genommen, schon mit
der Fünf- und Sechsteilung untreu geworden seien, noch weiter zu verlassen.
Wir wollten ja keine gewachsene Fflanze darstellen, sondern nur unsern Kreis in
einer das Auge erfreuenden Weise ausfüllen, wenn wir uns schon hiebei von der
Natur gerne beraten liessen. Jetzt rückt einer die Blätter gegen den Rand hinaus.
Zwischen den Blättern entstehen Lücken, die ein anderer Schüler auf der zweiten
Scheibe mit weiteren Blättern füllt. Wil-
kommen damit zur kranzförmigen
Anordnung. Dabei finden wir: es
ist besser, wenn die Blätter in
geschlossen em Bei gen zusammen-
gehalten werden, als wenn sie
zerstreut und einzeln um her-
liegen. Vgl. Abb. 2 und Abb. 3.
Dasselbe Gesetz finden wir auch
sonst bestätigt. Da hat z. B. einer bei
Darstellung der Schlittenfahrt ziemlich
viele Personen verwendet — im ein-
zelnen ganz ordentlich, aber sie sind
auf dem ganzen Felde verteilt. Ein
anderer hat instinktmässig mehrere
Personen zu einer Gruppe zusammen-
gefasst, zu einem Schwer p u n kt aus-
gestaltet, auf dem das Auge ganz von
selbst längere Zeit ruhig verweilt,
während es auf dem andern Bilde un-
ruhig hin- und herzufahren gezwungen
ist. Jederfiihltsofort, was das bessereist.
Ein Schüler schiebt nun die Blätter vollends ganz an den Rand hinaus: es
macht sich schlecht; es sieht aus, als ob der Raum ausgegangen wäre. Das
Ornament soll einen freien Rand haben. Man vergl. Schriftseiten mit
und ohne Rand, beachte Druckseiten, Wandkarten, Haus mit Vorgärtchen usw.
Die Blätter sind noch immer angeordnet: Achse in radialer Richtung. Ich
gebe jetzt den Achsen eine zum Radius etwas schräge Stellung. Die
Schüler sind förmlich überrascht von der Wirkung, suchen aber vergeblich nach
des Rätsels Lösung. Sie ist indes naheliegend. Radien schneiden die Kreislinie
rechtwinklig. Nun wird bei einem Kreise das Auge unwillkürlich dem energisch
gekrümmten und mächtig ziehenden Rande folgen. Dieser Bewegung legen sich
jedoch die radial gestellten Blattachsen rechtwinklig in den Weg und werden
somit als ebensoviele Hemmungen empfunden. Sobald man nun die Blattachsen
schräg stellt, scheinen sie den Rand nicht mehr schneiden, sondern in denselben
einmünden, die kreisende Bewegung also nicht mehr aufhalten, sondern
mitmachen zu wollen. Darum ist, wie ein zweiter Versuch zeigt, der Eindruck
um so befriedigender, je schräger wir die Achsen stellen. In derselben Weise
werden bei einem aufsteigenden Bande die Hauptlinien der Füllung der senkrechten,
bei einem wagrechten Bande der wagrechten Bewegung des Standes sich anzu-
bequemen haben. Vgl. Abb. 5.
Neues Staunen ergreift die Schüler, wenn ich durch Ansetzen lebendig ge-
schwungener Stile (etwa mit grünem Farbstift) die steifen, toten Blattachsen zu
Kunst vielleicht am häufigsten begegnen. Die Schüler nennen die Blüte der Hag-
rose, von Apfel- und Birnbaum, die Glockenblume, ferner die Apfelfrucht usw.
Wir fassen nun die seitherigen mehr oder weniger der Natur abgelauschten
Anordnungen unter dem Begriff Bosette zusammen, deren wesentliches Merkmal
darin besteht, dass die in einem Kreis gereihten gleichartigen Einzelteile aus dem
gemeinschaftlichen Mittelpunkt herauswachsen.
Nun weise ich darauf hin, dass es bei einer Füllung wohl gestattet sei, diesen
von der Natur gezogenen engen Rahmen, dem wir, streng genommen, schon mit
der Fünf- und Sechsteilung untreu geworden seien, noch weiter zu verlassen.
Wir wollten ja keine gewachsene Fflanze darstellen, sondern nur unsern Kreis in
einer das Auge erfreuenden Weise ausfüllen, wenn wir uns schon hiebei von der
Natur gerne beraten liessen. Jetzt rückt einer die Blätter gegen den Rand hinaus.
Zwischen den Blättern entstehen Lücken, die ein anderer Schüler auf der zweiten
Scheibe mit weiteren Blättern füllt. Wil-
kommen damit zur kranzförmigen
Anordnung. Dabei finden wir: es
ist besser, wenn die Blätter in
geschlossen em Bei gen zusammen-
gehalten werden, als wenn sie
zerstreut und einzeln um her-
liegen. Vgl. Abb. 2 und Abb. 3.
Dasselbe Gesetz finden wir auch
sonst bestätigt. Da hat z. B. einer bei
Darstellung der Schlittenfahrt ziemlich
viele Personen verwendet — im ein-
zelnen ganz ordentlich, aber sie sind
auf dem ganzen Felde verteilt. Ein
anderer hat instinktmässig mehrere
Personen zu einer Gruppe zusammen-
gefasst, zu einem Schwer p u n kt aus-
gestaltet, auf dem das Auge ganz von
selbst längere Zeit ruhig verweilt,
während es auf dem andern Bilde un-
ruhig hin- und herzufahren gezwungen
ist. Jederfiihltsofort, was das bessereist.
Ein Schüler schiebt nun die Blätter vollends ganz an den Rand hinaus: es
macht sich schlecht; es sieht aus, als ob der Raum ausgegangen wäre. Das
Ornament soll einen freien Rand haben. Man vergl. Schriftseiten mit
und ohne Rand, beachte Druckseiten, Wandkarten, Haus mit Vorgärtchen usw.
Die Blätter sind noch immer angeordnet: Achse in radialer Richtung. Ich
gebe jetzt den Achsen eine zum Radius etwas schräge Stellung. Die
Schüler sind förmlich überrascht von der Wirkung, suchen aber vergeblich nach
des Rätsels Lösung. Sie ist indes naheliegend. Radien schneiden die Kreislinie
rechtwinklig. Nun wird bei einem Kreise das Auge unwillkürlich dem energisch
gekrümmten und mächtig ziehenden Rande folgen. Dieser Bewegung legen sich
jedoch die radial gestellten Blattachsen rechtwinklig in den Weg und werden
somit als ebensoviele Hemmungen empfunden. Sobald man nun die Blattachsen
schräg stellt, scheinen sie den Rand nicht mehr schneiden, sondern in denselben
einmünden, die kreisende Bewegung also nicht mehr aufhalten, sondern
mitmachen zu wollen. Darum ist, wie ein zweiter Versuch zeigt, der Eindruck
um so befriedigender, je schräger wir die Achsen stellen. In derselben Weise
werden bei einem aufsteigenden Bande die Hauptlinien der Füllung der senkrechten,
bei einem wagrechten Bande der wagrechten Bewegung des Standes sich anzu-
bequemen haben. Vgl. Abb. 5.
Neues Staunen ergreift die Schüler, wenn ich durch Ansetzen lebendig ge-
schwungener Stile (etwa mit grünem Farbstift) die steifen, toten Blattachsen zu