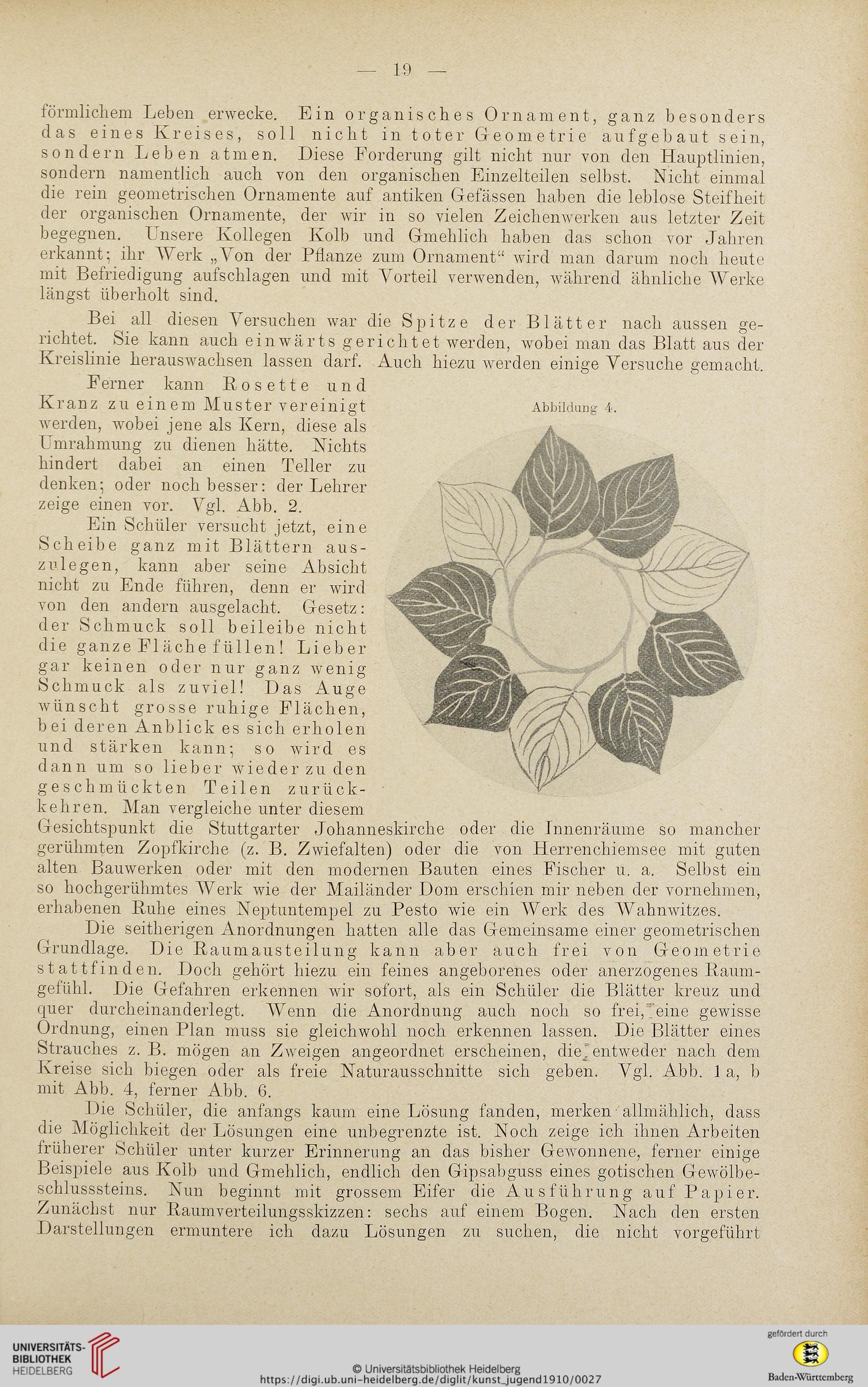19
förmlichem Leben erwecke. Ein organisches Ornament, ganz besonders
das eines Kreises, soll nicht in toter Geometrie aufgebaut sein,
sondern Leben atmen. Diese Forderung gilt nicht nur von den Hauptlinien,
sondern namentlich auch von den organischen Einzelteilen selbst. Nicht einmal
die rein geometrischen Ornamente auf antiken Gefässen haben die leblose Steifheit
der organischen Ornamente, der wir in so vielen Zeichenwerken aus letzter Zeit
begegnen. Unsere Kollegen Kolb und Gmehlich haben das schon vor Jahren
erkannt; ihr Werk „Von der Pflanze zum Ornament“ wird man darum noch heute
mit Befriedigung aufschlagen und mit Vorteil verwenden, während ähnliche Werke
längst überholt sind.
Bei all diesen Versuchen war die Spitze der Blätter nach aussen ge-
richtet. Sie kann auch einwärts gerichtet werden, wobei man das Blatt aus der
Kreislinie herauswachsen lassen darf. Auch hiezu werden einige Versuche gemacht.
F erner kann Rosette und
Kranz zu einem Muster vereinigt
werden, wobei jene als Kern, diese als
Umrahmung zu dienen hätte. Nichts
hindert dabei an einen Teller zu
denken; oder noch besser: der Lehrer
zeige einen vor. Vgl. Abb. 2.
Ein Schüler versucht jetzt, eine
Scheibe ganz mit Blättern aus¬
zulegen, kann aber seine Absicht
nicht zu Ende führen, denn er wird
von den andern ausgelacht. Gesetz:
der Schmuck soll beileibe nicht
die ganze Fl äche füllen ! Lieber
gar keinen oder nur ganz wenig
Schmuck als zuviel! Das Auge
wünscht grosse ruhige Flächen,
bei deren Anblick es sich erholen
und stärken kann; so wird es
dann um so lieber wieder zu den
geschmückten Teilen zurück¬
kehren. Man vergleiche unter diesem
Gesichtspunkt die Stuttgarter Johanneskirche oder die Innenräume so mancher
gerühmten Zopfkirche (z. B. Zwiefalten) oder die von Herrenchiemsee mit guten
alten Bauwerken oder mit den modernen Bauten eines Fischer u. a. Selbst ein
so hochgerühmtes Werk wie der Mailänder Dom erschien mir neben der vornehmen,
erhabenen Ruhe eines Neptuntempel zu Pesto wie ein Werk des Wahnwitzes.
Die seitherigen Anordnungen hatten alle das Gemeinsame einer geometrischen
Grundlage. Die Raumausteilung kann aber auch frei von Geometrie
statt find en. Doch gehört hiezu ein feines angeborenes oder an erzogenes Raum-
gefühl. Die Gefahren erkennen wir sofort, als ein Schüler die Blätter kreuz und
quer durcheinanderlegt. Wenn die Anordnung auch noch so frei,' eine gewisse
Ordnung, einen Plan muss sie gleichwohl noch erkennen lassen. Die Blätter eines
Strauches z. B. mögen an Zweigen angeordnet erscheinen, die"entweder nach dem
Kreise sich biegen oder als freie Naturausschnitte sich geben. Vgl. Abb. 1 a, b
mit Abb. 4, ferner Abb. 6.
Die Schüler, die anfangs kaum eine Lösung fanden, merken allmählich, dass
die Möglichkeit der Lösungen eine unbegrenzte ist. Noch zeige ich ihnen Arbeiten
früherer Schüler unter kurzer Erinnerung an das bisher Gewonnene, ferner einige
Beispiele aus Kolb und Gmehlich, endlich den Gipsabguss eines gotischen Gewölbe-
schlusssteins. Nun beginnt mit grossem Eifer die Ausführung auf Papier.
Zunächst nur Raumverteilungsskizzen: sechs auf einem Bogen. Nach den ersten
Darstellungen ermuntere ich dazu Lösungen zu suchen, die nicht vorgeführt
Abbildung 4.
förmlichem Leben erwecke. Ein organisches Ornament, ganz besonders
das eines Kreises, soll nicht in toter Geometrie aufgebaut sein,
sondern Leben atmen. Diese Forderung gilt nicht nur von den Hauptlinien,
sondern namentlich auch von den organischen Einzelteilen selbst. Nicht einmal
die rein geometrischen Ornamente auf antiken Gefässen haben die leblose Steifheit
der organischen Ornamente, der wir in so vielen Zeichenwerken aus letzter Zeit
begegnen. Unsere Kollegen Kolb und Gmehlich haben das schon vor Jahren
erkannt; ihr Werk „Von der Pflanze zum Ornament“ wird man darum noch heute
mit Befriedigung aufschlagen und mit Vorteil verwenden, während ähnliche Werke
längst überholt sind.
Bei all diesen Versuchen war die Spitze der Blätter nach aussen ge-
richtet. Sie kann auch einwärts gerichtet werden, wobei man das Blatt aus der
Kreislinie herauswachsen lassen darf. Auch hiezu werden einige Versuche gemacht.
F erner kann Rosette und
Kranz zu einem Muster vereinigt
werden, wobei jene als Kern, diese als
Umrahmung zu dienen hätte. Nichts
hindert dabei an einen Teller zu
denken; oder noch besser: der Lehrer
zeige einen vor. Vgl. Abb. 2.
Ein Schüler versucht jetzt, eine
Scheibe ganz mit Blättern aus¬
zulegen, kann aber seine Absicht
nicht zu Ende führen, denn er wird
von den andern ausgelacht. Gesetz:
der Schmuck soll beileibe nicht
die ganze Fl äche füllen ! Lieber
gar keinen oder nur ganz wenig
Schmuck als zuviel! Das Auge
wünscht grosse ruhige Flächen,
bei deren Anblick es sich erholen
und stärken kann; so wird es
dann um so lieber wieder zu den
geschmückten Teilen zurück¬
kehren. Man vergleiche unter diesem
Gesichtspunkt die Stuttgarter Johanneskirche oder die Innenräume so mancher
gerühmten Zopfkirche (z. B. Zwiefalten) oder die von Herrenchiemsee mit guten
alten Bauwerken oder mit den modernen Bauten eines Fischer u. a. Selbst ein
so hochgerühmtes Werk wie der Mailänder Dom erschien mir neben der vornehmen,
erhabenen Ruhe eines Neptuntempel zu Pesto wie ein Werk des Wahnwitzes.
Die seitherigen Anordnungen hatten alle das Gemeinsame einer geometrischen
Grundlage. Die Raumausteilung kann aber auch frei von Geometrie
statt find en. Doch gehört hiezu ein feines angeborenes oder an erzogenes Raum-
gefühl. Die Gefahren erkennen wir sofort, als ein Schüler die Blätter kreuz und
quer durcheinanderlegt. Wenn die Anordnung auch noch so frei,' eine gewisse
Ordnung, einen Plan muss sie gleichwohl noch erkennen lassen. Die Blätter eines
Strauches z. B. mögen an Zweigen angeordnet erscheinen, die"entweder nach dem
Kreise sich biegen oder als freie Naturausschnitte sich geben. Vgl. Abb. 1 a, b
mit Abb. 4, ferner Abb. 6.
Die Schüler, die anfangs kaum eine Lösung fanden, merken allmählich, dass
die Möglichkeit der Lösungen eine unbegrenzte ist. Noch zeige ich ihnen Arbeiten
früherer Schüler unter kurzer Erinnerung an das bisher Gewonnene, ferner einige
Beispiele aus Kolb und Gmehlich, endlich den Gipsabguss eines gotischen Gewölbe-
schlusssteins. Nun beginnt mit grossem Eifer die Ausführung auf Papier.
Zunächst nur Raumverteilungsskizzen: sechs auf einem Bogen. Nach den ersten
Darstellungen ermuntere ich dazu Lösungen zu suchen, die nicht vorgeführt
Abbildung 4.