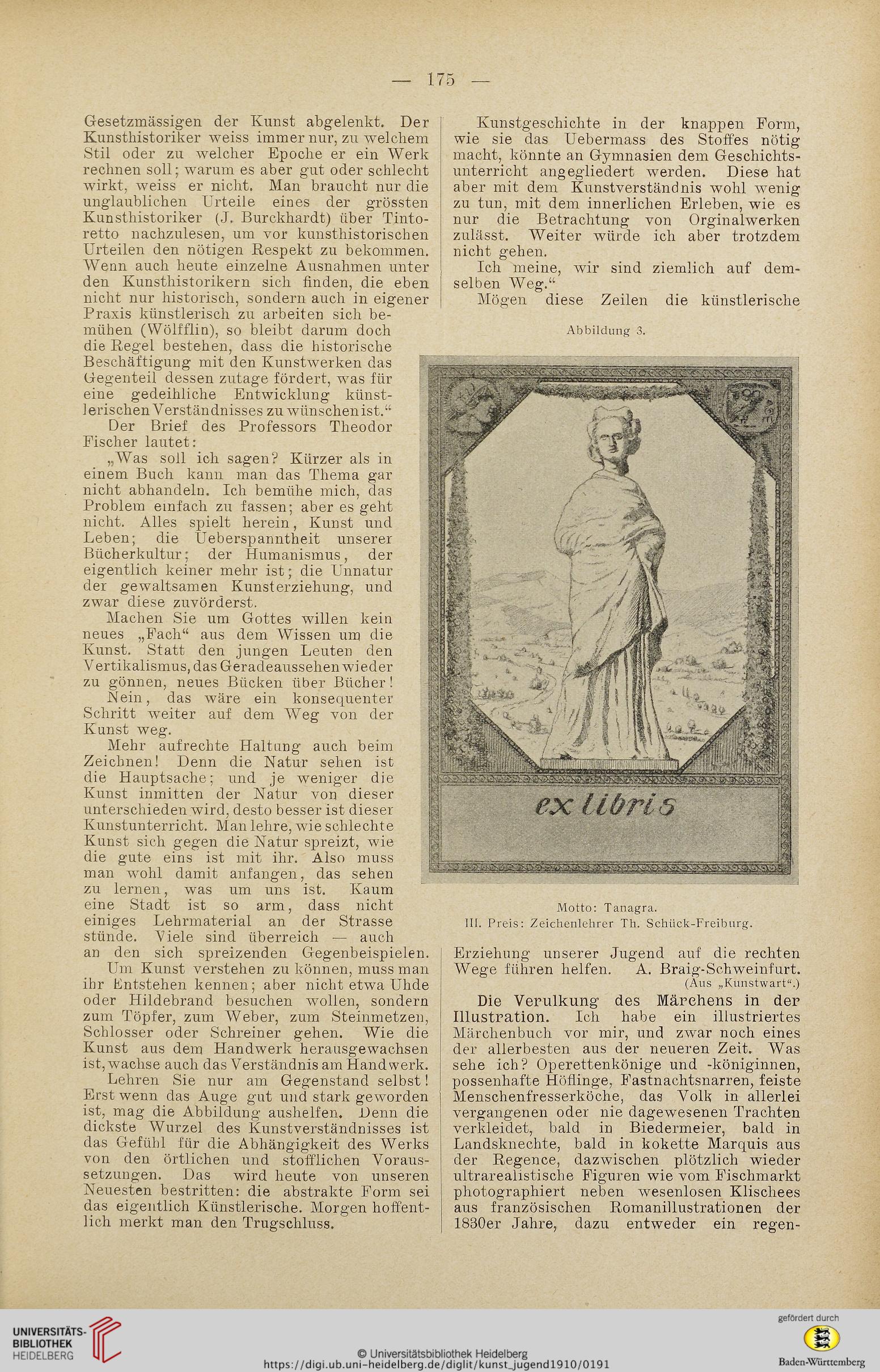175
Gesetzmässigen der Kunst abgelenkt. Der
Kunsthistoriker weiss immer nur, zu welchem
Stil oder zu welcher Epoche er ein Werk
rechnen soll; warum es aber gut oder schlecht
wirkt, weiss er nicht. Man braucht nur die
unglaublichen Urteile eines der grössten
Kunsthistoriker (J. Burckhardt) über Tinto-
retto nachzulesen, um vor kunsthistorischen
Urteilen den nötigen Respekt zu bekommen.
Wenn auch heute einzelne Ausnahmen unter
den Kunsthistorikern sich finden, die eben
nicht nur historisch, sondern auch in eigener
Praxis künstlerisch zu arbeiten sich be-
mühen (Wölfflin), so bleibt darum doch
die Regel bestehen, dass die historische
Beschäftigung mit den Kunstwerken das
Gegenteil dessen zutage fördert, was für
eine gedeihliche Entwicklung künst-
lerischen Verständnisses zu wünschen ist.“
Der Brief des Professors Theodor
Fischer lautet:
„Was soll ich sagen? Kürzer als in
einem Buch kann man das Thema gar
nicht abhandeln. Ich bemühe mich, das
Problem einfach zu fassen; aber es geht
nicht. Alles spielt herein, Kunst und
Leben; die Ueberspanntheit unserer
Bücherkultur; der Humanismus, der
eigentlich keiner mehr ist; die Unnatur
der gewaltsamen Kunsterziehung, und
zwar diese zuvörderst.
Machen Sie um Gottes willen kein
neues „Fach“ aus dem Wissen um die
Kunst. Statt den jungen Leuten den
Vertikalismus, das Geradeaussehen wieder
zu gönnen, neues Bücken über Bücher!
Nein, das wäre ein konsequenter
Schritt weiter auf dem Weg von der
Kunst weg.
Mehr aufrechte Haltung auch beim
Zeichnen! Denn die Natur sehen ist
die Hauptsache; und je weniger die
Kunst inmitten der Natur von dieser
unterschieden wird, desto besser ist dieser
Kunstunterricht. Man lehre, wie schlechte
Kunst sich gegen die Natur spreizt, wie
die gute eins ist mit ihr. Also muss
man wohl damit anfangen, das sehen
zu lernen, was um uns ist. Kaum
eine Stadt ist so arm, dass nicht
einiges Lehrmaterial an der Strasse
stünde. Viele sind überreich — auch
an den sich spreizenden Gegenbeispielen.
Um Kunst verstehen zu können, muss man
ihr Entstehen kennen; aber nicht etwa Uhde
oder Hildebrand besuchen wollen, sondern
zum Töpfer, zum Weber, zum Steinmetzen,
Schlosser oder Schreiner gehen. Wie die
Kunst aus dem Handwerk herausgewachsen
ist, wachse auch das Verständnis am Handwerk.
Lehren Sie nur am Gegenstand selbst!
Erst wenn das Auge gut und stark geworden
ist, mag die Abbildung aushelfen. Denn die
dickste Wurzel des Kunstverständnisses ist
das Gefühl für die Abhängigkeit des Werks
von den örtlichen und stofflichen Voraus-
setzungen. Das wird heute von unseren
Neuesten bestritten: die abstrakte Form sei
das eigentlich Künstlerische. Morgen hoffent-
lich merkt man den Trugschluss.
Kunstgeschichte in der knappen Form,
wie sie das Uebermass des Stoffes nötig
macht, könnte an Gymnasien dem Geschichts-
unterricht angegliedert werden. Diese hat
aber mit dem Kunstverständnis wohl wenig
zu tun, mit dem innerlichen Erleben, wie es
nur die Betrachtung von Orginalwerken
zulässt. Weiter würde ich aber trotzdem
nicht gehen.
Ich meine, wir sind ziemlich auf dem-
selben Weg.“
Mögen diese Zeilen die künstlerische
Abbildung 3.
Erziehung unserer Jugend auf die rechten
Wege führen helfen. A. Braig-Schweinfurt.
(Aus „Kunstwart“.)
Die Verulkung des Märchens in der
Illustration. Ich habe ein illustriertes
Märchenbuch vor mir, und zwar noch eines
der allerbesten aus der neueren Zeit. Was
sehe ich? Operettenkönige und -königinnen,
possenhafte Höflinge, Fastnachtsnarren, feiste
Menschenfresserköche, das Volk in allerlei
vergangenen oder nie dagewesenen Trachten
verkleidet, bald in Biedermeier, bald in
Landsknechte, bald in kokette Marquis aus
der Regence, dazwischen plötzlich wieder
ultrarealistische Figuren wie vom Fischmarkt
photographiert neben wesenlosen Klischees
aus französischen Romanillustrationen der
1830er Jahre, dazu entweder ein regen-
Motto: Tanagra.
III. Preis: Zeichenlehrer Th. Schlick-Freiburg.
Gesetzmässigen der Kunst abgelenkt. Der
Kunsthistoriker weiss immer nur, zu welchem
Stil oder zu welcher Epoche er ein Werk
rechnen soll; warum es aber gut oder schlecht
wirkt, weiss er nicht. Man braucht nur die
unglaublichen Urteile eines der grössten
Kunsthistoriker (J. Burckhardt) über Tinto-
retto nachzulesen, um vor kunsthistorischen
Urteilen den nötigen Respekt zu bekommen.
Wenn auch heute einzelne Ausnahmen unter
den Kunsthistorikern sich finden, die eben
nicht nur historisch, sondern auch in eigener
Praxis künstlerisch zu arbeiten sich be-
mühen (Wölfflin), so bleibt darum doch
die Regel bestehen, dass die historische
Beschäftigung mit den Kunstwerken das
Gegenteil dessen zutage fördert, was für
eine gedeihliche Entwicklung künst-
lerischen Verständnisses zu wünschen ist.“
Der Brief des Professors Theodor
Fischer lautet:
„Was soll ich sagen? Kürzer als in
einem Buch kann man das Thema gar
nicht abhandeln. Ich bemühe mich, das
Problem einfach zu fassen; aber es geht
nicht. Alles spielt herein, Kunst und
Leben; die Ueberspanntheit unserer
Bücherkultur; der Humanismus, der
eigentlich keiner mehr ist; die Unnatur
der gewaltsamen Kunsterziehung, und
zwar diese zuvörderst.
Machen Sie um Gottes willen kein
neues „Fach“ aus dem Wissen um die
Kunst. Statt den jungen Leuten den
Vertikalismus, das Geradeaussehen wieder
zu gönnen, neues Bücken über Bücher!
Nein, das wäre ein konsequenter
Schritt weiter auf dem Weg von der
Kunst weg.
Mehr aufrechte Haltung auch beim
Zeichnen! Denn die Natur sehen ist
die Hauptsache; und je weniger die
Kunst inmitten der Natur von dieser
unterschieden wird, desto besser ist dieser
Kunstunterricht. Man lehre, wie schlechte
Kunst sich gegen die Natur spreizt, wie
die gute eins ist mit ihr. Also muss
man wohl damit anfangen, das sehen
zu lernen, was um uns ist. Kaum
eine Stadt ist so arm, dass nicht
einiges Lehrmaterial an der Strasse
stünde. Viele sind überreich — auch
an den sich spreizenden Gegenbeispielen.
Um Kunst verstehen zu können, muss man
ihr Entstehen kennen; aber nicht etwa Uhde
oder Hildebrand besuchen wollen, sondern
zum Töpfer, zum Weber, zum Steinmetzen,
Schlosser oder Schreiner gehen. Wie die
Kunst aus dem Handwerk herausgewachsen
ist, wachse auch das Verständnis am Handwerk.
Lehren Sie nur am Gegenstand selbst!
Erst wenn das Auge gut und stark geworden
ist, mag die Abbildung aushelfen. Denn die
dickste Wurzel des Kunstverständnisses ist
das Gefühl für die Abhängigkeit des Werks
von den örtlichen und stofflichen Voraus-
setzungen. Das wird heute von unseren
Neuesten bestritten: die abstrakte Form sei
das eigentlich Künstlerische. Morgen hoffent-
lich merkt man den Trugschluss.
Kunstgeschichte in der knappen Form,
wie sie das Uebermass des Stoffes nötig
macht, könnte an Gymnasien dem Geschichts-
unterricht angegliedert werden. Diese hat
aber mit dem Kunstverständnis wohl wenig
zu tun, mit dem innerlichen Erleben, wie es
nur die Betrachtung von Orginalwerken
zulässt. Weiter würde ich aber trotzdem
nicht gehen.
Ich meine, wir sind ziemlich auf dem-
selben Weg.“
Mögen diese Zeilen die künstlerische
Abbildung 3.
Erziehung unserer Jugend auf die rechten
Wege führen helfen. A. Braig-Schweinfurt.
(Aus „Kunstwart“.)
Die Verulkung des Märchens in der
Illustration. Ich habe ein illustriertes
Märchenbuch vor mir, und zwar noch eines
der allerbesten aus der neueren Zeit. Was
sehe ich? Operettenkönige und -königinnen,
possenhafte Höflinge, Fastnachtsnarren, feiste
Menschenfresserköche, das Volk in allerlei
vergangenen oder nie dagewesenen Trachten
verkleidet, bald in Biedermeier, bald in
Landsknechte, bald in kokette Marquis aus
der Regence, dazwischen plötzlich wieder
ultrarealistische Figuren wie vom Fischmarkt
photographiert neben wesenlosen Klischees
aus französischen Romanillustrationen der
1830er Jahre, dazu entweder ein regen-
Motto: Tanagra.
III. Preis: Zeichenlehrer Th. Schlick-Freiburg.