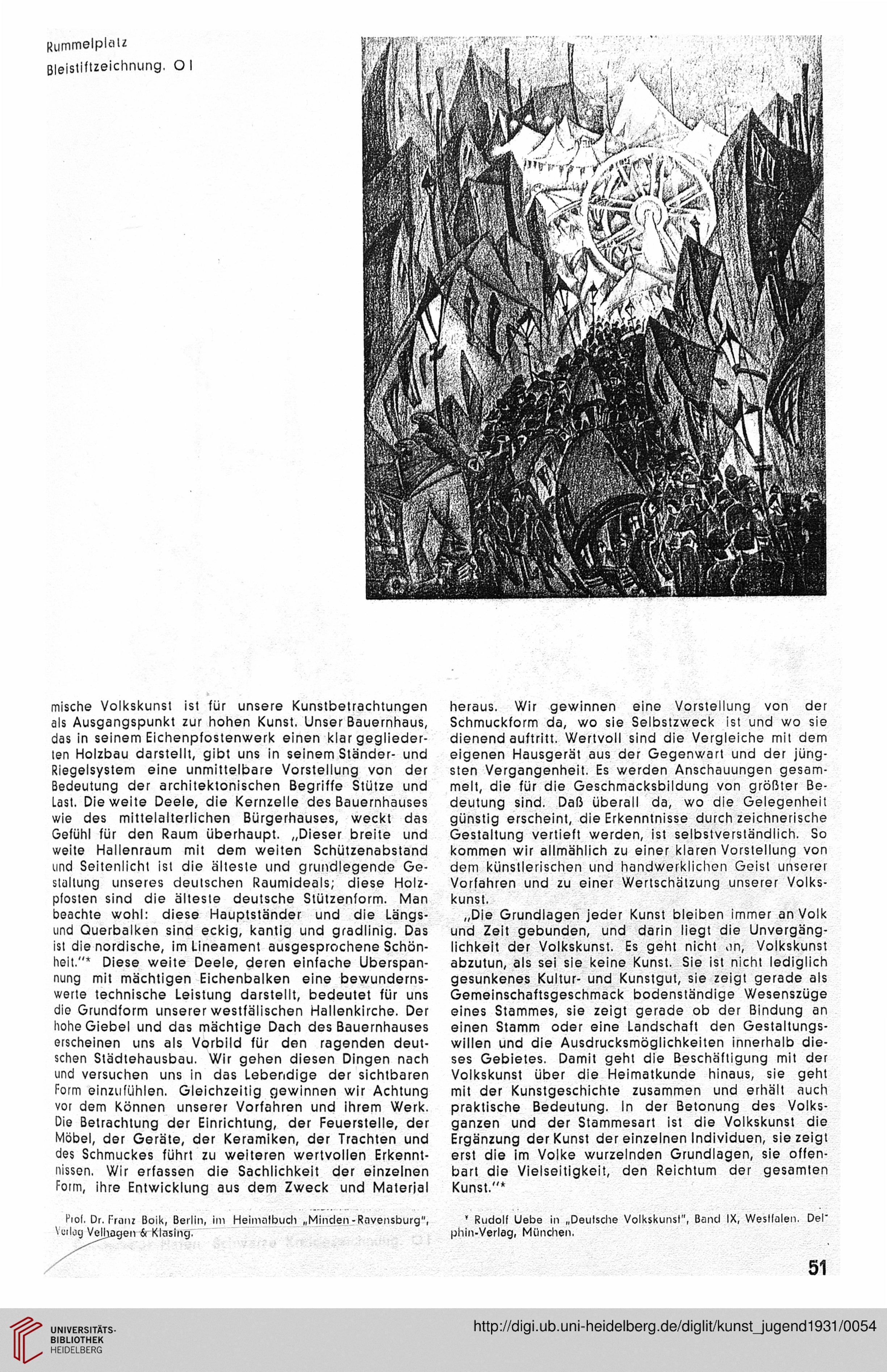Rummelplatz
Bleistiftzeichnung. O I
mische Volkskunst ist für unsere Kunstbetrachtungen
als Ausgangspunkt zur hohen Kunst. Unser Bauernhaus,
das in seinem Eichenpfostenwerk einen klar geglieder-
ten Holzbau darstellt, gibt uns in seinem Ständer- und
Riegelsystem eine unmittelbare Vorstellung von der
Bedeutung der architektonischen Begriffe Stütze und
Last. Die weite Deele, die Kernzelle des Bauernhauses
wie des mittelalterlichen Bürgerhauses, weckt das
Gefühl für den Raum überhaupt. „Dieser breite und
weite Hallenraum mit dem weiten Schützenabstand
und Seitenlicht ist die älteste und grundlegende Ge-
staltung unseres deutschen Raumideals,■ diese Holz-
pfosten sind die älteste deutsche Stützenform. Man
beachte wohl: diese Hauptständer und die Längs-
und Querbalken sind eckig, kantig und gradlinig. Das
ist die nordische, im Lineament ausgesprochene Schön-
heit."* Diese weite Deele, deren einfache Überspan-
nung mit mächtigen Eichenbalken eine bewunderns-
werte technische Leistung darstellt, bedeutet für uns
die Grundform unserer westfälischen Hallenkirche. Der
hohe Giebel und das mächtige Dach des Bauernhauses
erscheinen uns als Vorbild für den ragenden deut-
schen Städtehausbau. Wir gehen diesen Dingen nach
und versuchen uns in das Lebendige der sichtbaren
Form einzufühlen. Gleichzeitig gewinnen wir Achtung
vor dem Können unserer Vorfahren und ihrem Werk.
Die Betrachtung der Einrichtung, der Feuerstelle, der
Möbel, der Geräte, der Keramiken, der Trachten und
des Schmuckes führt zu weiteren wertvollen Erkennt-
nissen. Wir erfassen die Sachlichkeit der einzelnen
Form, ihre Entwicklung aus dem Zweck und Material
Piof. Dr. Franz Boik, Beilin, im Heimalbuch „Minden-Ravensburg",
Verlag Veltjagen & Klasing.
heraus. Wir gewinnen eine Vorstellung von der
Schmuckform da, wo sie Selbstzweck ist und wo sie
dienend auftritt. Wertvoll sind die Vergleiche mit dem
eigenen Hausgerät aus der Gegenwart und der jüng-
sten Vergangenheit. Es werden Anschauungen gesam-
melt, die für die Geschmacksbildung von größter Be-
deutung sind. Daß überall da, wo die Gelegenheit
günstig erscheint, die Erkenntnisse durch zeichnerische
Gestaltung vertieft werden, ist selbstverständlich. So
kommen wir allmählich zu einer klaren Vorstellung von
dem künstlerischen und handwerklichen Geist unserer
Vorfahren und zu einer Wertschätzung unserer Volks-
kunst.
„Die Grundlagen jeder Kunst bleiben immer an Volk
und Zeit gebunden, und darin liegt die Unvergäng-
lichkeit der Volkskunst. Es geht nicht an, Volkskunst
abzutun, als sei sie keine Kunst. Sie ist nicht lediglich
gesunkenes Kultur- und Kunstgut, sie zeigt gerade als
Gemeinschaftsgeschmack bodenständige Wesenszüge
eines Stammes, sie zeigt gerade ob der Bindung an
einen Stamm oder eine Landschaft den Gestaltungs-
willen und die Ausdrucksmöglichkeiten innerhalb die-
ses Gebietes. Damit geht die Beschäftigung mit der
Volkskunst über die Heimatkunde hinaus, sie geht
mit der Kunstgeschichte zusammen und erhält auch
praktische Bedeutung. In der Betonung des Volks-
ganzen und der Stammesart ist die Volkskunst die
Ergänzung der Kunst der einzelnen Individuen, sie zeigt
erst die im Volke wurzelnden Grundlagen, sie offen-
bart die Vielseitigkeit, den Reichtum der gesamten
Kunst."*
' Rudolf Uebe in „Deutsche Volkskunst", Band IX, Westfalen. Del'
phin-Verlag, München.
51
Bleistiftzeichnung. O I
mische Volkskunst ist für unsere Kunstbetrachtungen
als Ausgangspunkt zur hohen Kunst. Unser Bauernhaus,
das in seinem Eichenpfostenwerk einen klar geglieder-
ten Holzbau darstellt, gibt uns in seinem Ständer- und
Riegelsystem eine unmittelbare Vorstellung von der
Bedeutung der architektonischen Begriffe Stütze und
Last. Die weite Deele, die Kernzelle des Bauernhauses
wie des mittelalterlichen Bürgerhauses, weckt das
Gefühl für den Raum überhaupt. „Dieser breite und
weite Hallenraum mit dem weiten Schützenabstand
und Seitenlicht ist die älteste und grundlegende Ge-
staltung unseres deutschen Raumideals,■ diese Holz-
pfosten sind die älteste deutsche Stützenform. Man
beachte wohl: diese Hauptständer und die Längs-
und Querbalken sind eckig, kantig und gradlinig. Das
ist die nordische, im Lineament ausgesprochene Schön-
heit."* Diese weite Deele, deren einfache Überspan-
nung mit mächtigen Eichenbalken eine bewunderns-
werte technische Leistung darstellt, bedeutet für uns
die Grundform unserer westfälischen Hallenkirche. Der
hohe Giebel und das mächtige Dach des Bauernhauses
erscheinen uns als Vorbild für den ragenden deut-
schen Städtehausbau. Wir gehen diesen Dingen nach
und versuchen uns in das Lebendige der sichtbaren
Form einzufühlen. Gleichzeitig gewinnen wir Achtung
vor dem Können unserer Vorfahren und ihrem Werk.
Die Betrachtung der Einrichtung, der Feuerstelle, der
Möbel, der Geräte, der Keramiken, der Trachten und
des Schmuckes führt zu weiteren wertvollen Erkennt-
nissen. Wir erfassen die Sachlichkeit der einzelnen
Form, ihre Entwicklung aus dem Zweck und Material
Piof. Dr. Franz Boik, Beilin, im Heimalbuch „Minden-Ravensburg",
Verlag Veltjagen & Klasing.
heraus. Wir gewinnen eine Vorstellung von der
Schmuckform da, wo sie Selbstzweck ist und wo sie
dienend auftritt. Wertvoll sind die Vergleiche mit dem
eigenen Hausgerät aus der Gegenwart und der jüng-
sten Vergangenheit. Es werden Anschauungen gesam-
melt, die für die Geschmacksbildung von größter Be-
deutung sind. Daß überall da, wo die Gelegenheit
günstig erscheint, die Erkenntnisse durch zeichnerische
Gestaltung vertieft werden, ist selbstverständlich. So
kommen wir allmählich zu einer klaren Vorstellung von
dem künstlerischen und handwerklichen Geist unserer
Vorfahren und zu einer Wertschätzung unserer Volks-
kunst.
„Die Grundlagen jeder Kunst bleiben immer an Volk
und Zeit gebunden, und darin liegt die Unvergäng-
lichkeit der Volkskunst. Es geht nicht an, Volkskunst
abzutun, als sei sie keine Kunst. Sie ist nicht lediglich
gesunkenes Kultur- und Kunstgut, sie zeigt gerade als
Gemeinschaftsgeschmack bodenständige Wesenszüge
eines Stammes, sie zeigt gerade ob der Bindung an
einen Stamm oder eine Landschaft den Gestaltungs-
willen und die Ausdrucksmöglichkeiten innerhalb die-
ses Gebietes. Damit geht die Beschäftigung mit der
Volkskunst über die Heimatkunde hinaus, sie geht
mit der Kunstgeschichte zusammen und erhält auch
praktische Bedeutung. In der Betonung des Volks-
ganzen und der Stammesart ist die Volkskunst die
Ergänzung der Kunst der einzelnen Individuen, sie zeigt
erst die im Volke wurzelnden Grundlagen, sie offen-
bart die Vielseitigkeit, den Reichtum der gesamten
Kunst."*
' Rudolf Uebe in „Deutsche Volkskunst", Band IX, Westfalen. Del'
phin-Verlag, München.
51