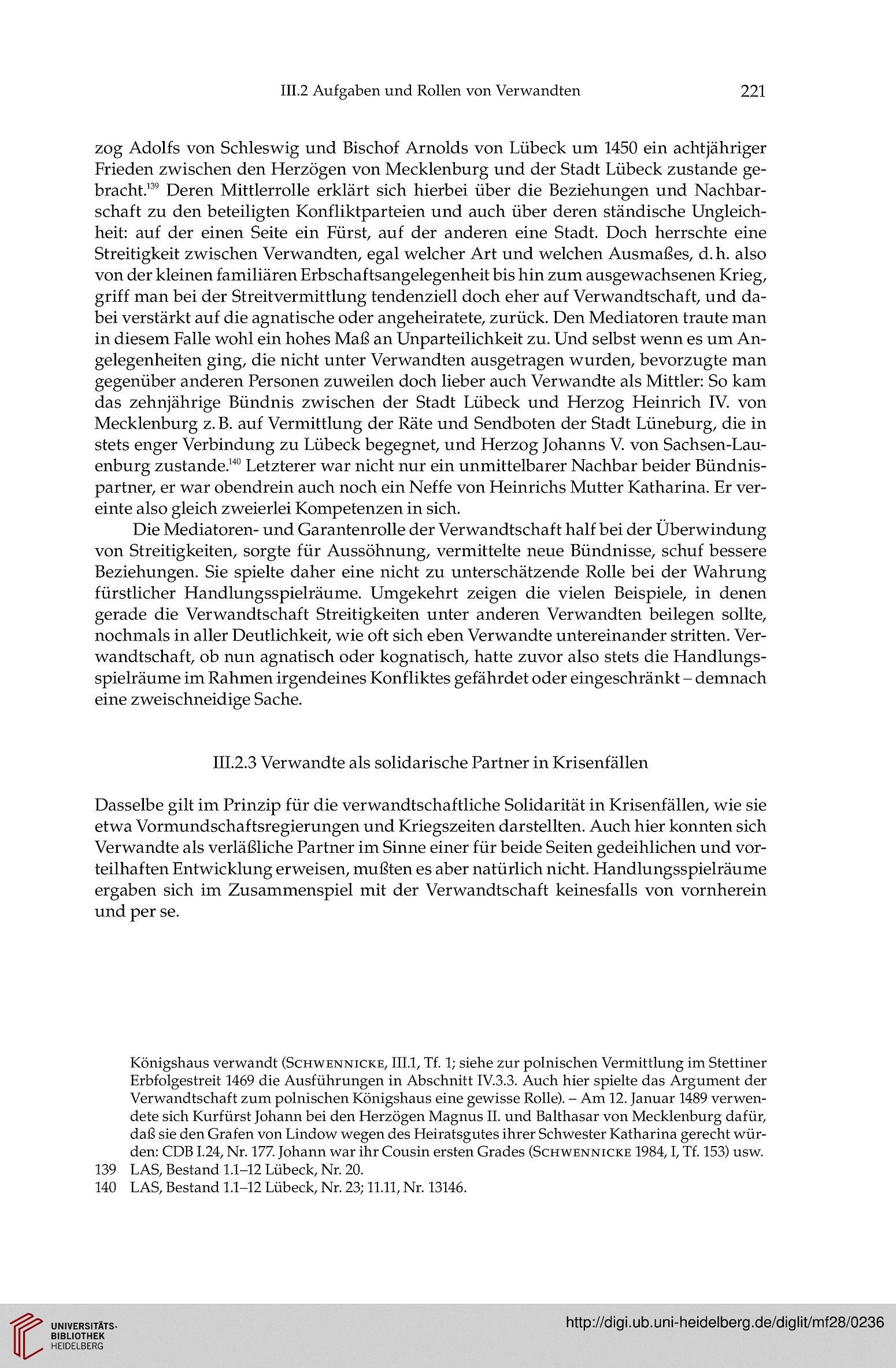111.2 Aufgaben und Rollen von Verwandten
221
zog Adolfs von Schleswig und Bischof Arnolds von Lübeck um 1450 ein achtjähriger
Frieden zwischen den Herzogen von Mecklenburg und der Stadt Lübeck zustande ge-
bracht.^ Deren Mittlerrolle erklärt sich hierbei über die Beziehungen und Nachbar-
schaft zu den beteiligten Konfliktparteien und auch über deren ständische Ungleich-
heit: auf der einen Seite ein Fürst, auf der anderen eine Stadt. Doch herrschte eine
Streitigkeit zwischen Verwandten, egal welcher Art und welchen Ausmaßes, d. h. also
von der kleinen familiären Erbschaftsangelegenheit bis hin zum ausgewachsenen Krieg,
griff man bei der Streitvermittlung tendenziell doch eher auf Verwandtschaft, und da-
bei verstärkt auf die agnatische oder angeheiratete, zurück. Den Mediatoren traute man
in diesem Falle wohl ein hohes Maß an Unparteilichkeit zu. Und selbst wenn es um An-
gelegenheiten ging, die nicht unter Verwandten ausgetragen wurden, bevorzugte man
gegenüber anderen Personen zuweilen doch lieber auch Verwandte als Mittler: So kam
das zehnjährige Bündnis zwischen der Stadt Lübeck und Herzog Heinrich IV. von
Mecklenburg z. B. auf Vermittlung der Räte und Sendboten der Stadt Lüneburg, die in
stets enger Verbindung zu Lübeck begegnet, und Herzog Johanns V. von Sachsen-Lau-
enburg zustande.^" Letzterer war nicht nur ein unmittelbarer Nachbar beider Bündnis-
partner, er war obendrein auch noch ein Neffe von Heinrichs Mutter Katharina. Er ver-
einte also gleich zweierlei Kompetenzen in sich.
Die Mediatoren- und Garantenrolle der Verwandtschaft half bei der Überwindung
von Streitigkeiten, sorgte für Aussöhnung, vermittelte neue Bündnisse, schuf bessere
Beziehungen. Sie spielte daher eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Wahrung
fürstlicher Handlungsspielräume. Umgekehrt zeigen die vielen Beispiele, in denen
gerade die Verwandtschaft Streitigkeiten unter anderen Verwandten beilegen sollte,
nochmals in aller Deutlichkeit, wie oft sich eben Verwandte untereinander stritten. Ver-
wandtschaft, ob nun agnatisch oder kognatisch, hatte zuvor also stets die Handlungs-
spielräume im Rahmen irgendeines Konfliktes gefährdet oder eingeschränkt - demnach
eine zweischneidige Sache.
111.2.3 Verwandte als solidarische Partner in Krisenfällen
Dasselbe gilt im Prinzip für die verwandtschaftliche Solidarität in Krisenfällen, wie sie
etwa Vormundschaftsregierungen und Kriegszeiten darstellten. Auch hier konnten sich
Verwandte als verläßliche Partner im Sinne einer für beide Seiten gedeihlichen und vor-
teilhaften Entwicklung erweisen, mußten es aber natürlich nicht. Handlungsspielräume
ergaben sich im Zusammenspiel mit der Verwandtschaft keinesfalls von vornherein
und per se.
Königshaus verwandt (ScHWENNiCKE, 111.1, Tf. 1; siehe zur polnischen Vermittlung im Stettiner
Erbfolgestreit 1469 die Ausführungen in Abschnitt IV.3.3. Auch hier spielte das Argument der
Verwandtschaft zum polnischen Königshaus eine gewisse Rolle). - Am 12. Januar 1489 verwen-
dete sich Kurfürst Johann bei den Herzogen Magnus II. und Balthasar von Mecklenburg dafür,
daß sie den Grafen von Lindow wegen des Heiratsgutes ihrer Schwester Katharina gerecht wür-
den: CDB 1.24, Nr. 177. Johann war ihr Cousin ersten Grades (ScHWENNiCKE 1984,1, Tf. 153) usw.
139 LAS, Bestand 1.1-12 Lübeck, Nr. 20.
140 LAS, Bestand 1.1-12 Lübeck, Nr. 23; 11.11, Nr. 13146.
221
zog Adolfs von Schleswig und Bischof Arnolds von Lübeck um 1450 ein achtjähriger
Frieden zwischen den Herzogen von Mecklenburg und der Stadt Lübeck zustande ge-
bracht.^ Deren Mittlerrolle erklärt sich hierbei über die Beziehungen und Nachbar-
schaft zu den beteiligten Konfliktparteien und auch über deren ständische Ungleich-
heit: auf der einen Seite ein Fürst, auf der anderen eine Stadt. Doch herrschte eine
Streitigkeit zwischen Verwandten, egal welcher Art und welchen Ausmaßes, d. h. also
von der kleinen familiären Erbschaftsangelegenheit bis hin zum ausgewachsenen Krieg,
griff man bei der Streitvermittlung tendenziell doch eher auf Verwandtschaft, und da-
bei verstärkt auf die agnatische oder angeheiratete, zurück. Den Mediatoren traute man
in diesem Falle wohl ein hohes Maß an Unparteilichkeit zu. Und selbst wenn es um An-
gelegenheiten ging, die nicht unter Verwandten ausgetragen wurden, bevorzugte man
gegenüber anderen Personen zuweilen doch lieber auch Verwandte als Mittler: So kam
das zehnjährige Bündnis zwischen der Stadt Lübeck und Herzog Heinrich IV. von
Mecklenburg z. B. auf Vermittlung der Räte und Sendboten der Stadt Lüneburg, die in
stets enger Verbindung zu Lübeck begegnet, und Herzog Johanns V. von Sachsen-Lau-
enburg zustande.^" Letzterer war nicht nur ein unmittelbarer Nachbar beider Bündnis-
partner, er war obendrein auch noch ein Neffe von Heinrichs Mutter Katharina. Er ver-
einte also gleich zweierlei Kompetenzen in sich.
Die Mediatoren- und Garantenrolle der Verwandtschaft half bei der Überwindung
von Streitigkeiten, sorgte für Aussöhnung, vermittelte neue Bündnisse, schuf bessere
Beziehungen. Sie spielte daher eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Wahrung
fürstlicher Handlungsspielräume. Umgekehrt zeigen die vielen Beispiele, in denen
gerade die Verwandtschaft Streitigkeiten unter anderen Verwandten beilegen sollte,
nochmals in aller Deutlichkeit, wie oft sich eben Verwandte untereinander stritten. Ver-
wandtschaft, ob nun agnatisch oder kognatisch, hatte zuvor also stets die Handlungs-
spielräume im Rahmen irgendeines Konfliktes gefährdet oder eingeschränkt - demnach
eine zweischneidige Sache.
111.2.3 Verwandte als solidarische Partner in Krisenfällen
Dasselbe gilt im Prinzip für die verwandtschaftliche Solidarität in Krisenfällen, wie sie
etwa Vormundschaftsregierungen und Kriegszeiten darstellten. Auch hier konnten sich
Verwandte als verläßliche Partner im Sinne einer für beide Seiten gedeihlichen und vor-
teilhaften Entwicklung erweisen, mußten es aber natürlich nicht. Handlungsspielräume
ergaben sich im Zusammenspiel mit der Verwandtschaft keinesfalls von vornherein
und per se.
Königshaus verwandt (ScHWENNiCKE, 111.1, Tf. 1; siehe zur polnischen Vermittlung im Stettiner
Erbfolgestreit 1469 die Ausführungen in Abschnitt IV.3.3. Auch hier spielte das Argument der
Verwandtschaft zum polnischen Königshaus eine gewisse Rolle). - Am 12. Januar 1489 verwen-
dete sich Kurfürst Johann bei den Herzogen Magnus II. und Balthasar von Mecklenburg dafür,
daß sie den Grafen von Lindow wegen des Heiratsgutes ihrer Schwester Katharina gerecht wür-
den: CDB 1.24, Nr. 177. Johann war ihr Cousin ersten Grades (ScHWENNiCKE 1984,1, Tf. 153) usw.
139 LAS, Bestand 1.1-12 Lübeck, Nr. 20.
140 LAS, Bestand 1.1-12 Lübeck, Nr. 23; 11.11, Nr. 13146.