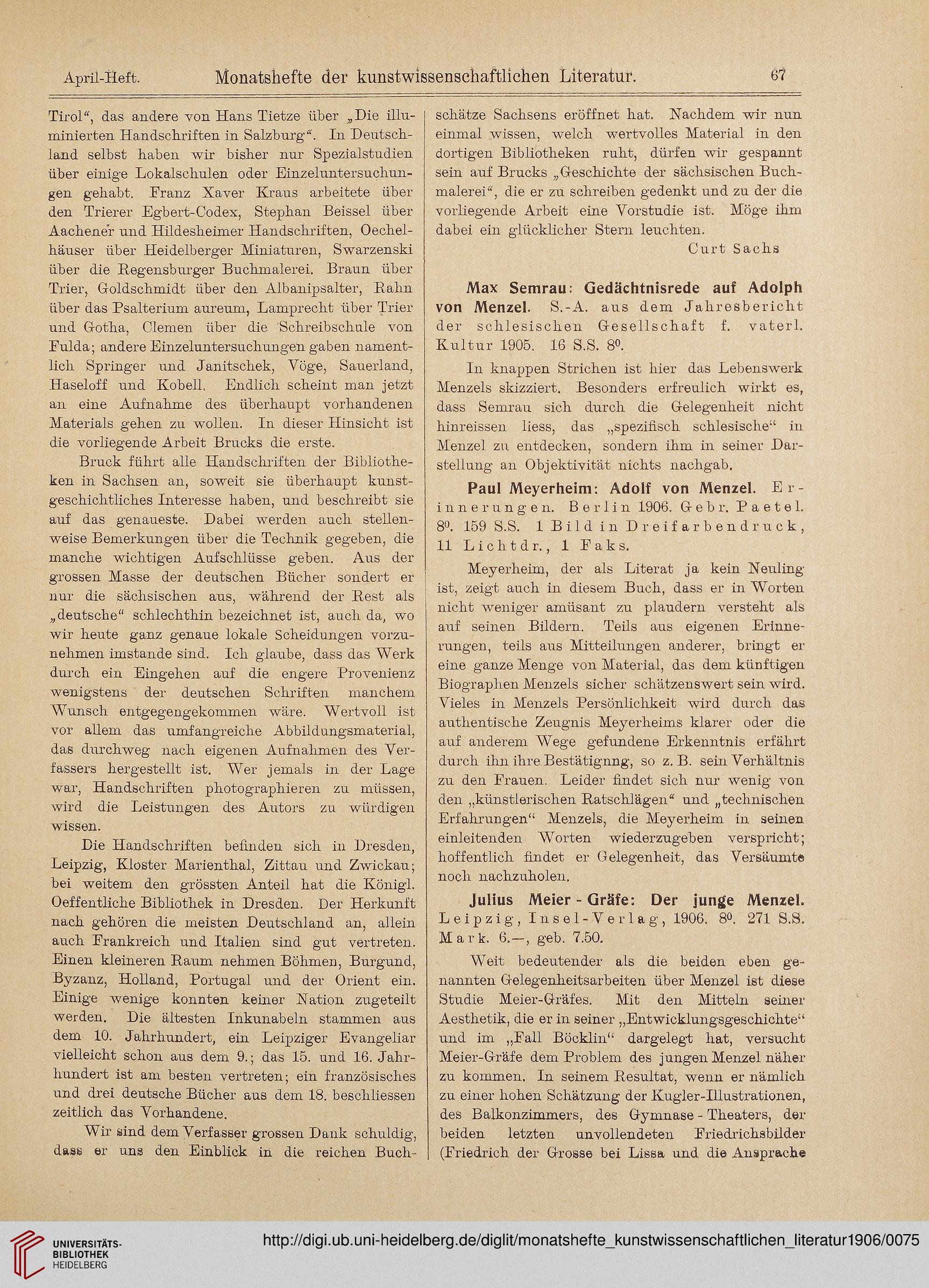April-Heft.
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
67
Tirol", das andere von Hans Tietze über „Die illu-
minierten Handschriften in Salzburg". In Deutsch-
land selbst haben wir bisher nur Spezialstudien
über einige Lokalschulen oder Einzeluntersuchun-
gen gehabt. Franz Xaver Kraus arbeitete über
den Trierer Egbert-Codex, Stephan Beissel über
Aachener und Hildesheimer Handschriften, Oechel-
häuser über Heidelberger Miniaturen, Swarzenski
über die Regensburger Buchmalerei. Braun über
Trier, Goldschmidt über den Albanipsalter, Rahn
über das Psalterium aureum, Lamprecht über Trier
und Gotha, Clemen über die Schreibschule von
Fulda; andere Einzeluntersuchungen gaben nament-
lich Springer und Janitschek, Vöge, Sauerland,
Haseloff und Kobell. Endlich scheint man jetzt
an eine Aufnahme des überhaupt vorhandenen
Materials gehen zu wollen. In dieser Hinsicht ist
die vorliegende Arbeit Brucks die erste.
Bruck führt alle Handschriften der Bibliothe-
ken in Sachsen an, soweit sie überhaupt kunst-
geschichtliches Interesse haben, und beschreibt sie
auf das genaueste. Dabei werden auch stellen-
weise Bemerkungen über die Technik gegeben, die
manche wichtigen Aufschlüsse geben. Aus der
grossen Masse der deutschen Bücher sondert er
nur die sächsischen aus, während der Rest als
„deutsche“ schlechthin bezeichnet ist, auch da, wo
wir heute ganz genaue lokale Scheidungen vorzu-
nehmen imstande sind. Ich glaube, dass das Werk
durch ein Eingehen auf die engere Provenienz
wenigstens der deutschen Schriften manchem
Wunsch entgegengekommen wäre. Wertvoll ist
vor allem das umfangreiche Abbildungsmaterial,
das durchweg nach eigenen Aufnahmen des Ver-
fassers hergestellt ist. Wer jemals in der Lage
war, Handschriften photographieren zu müssen,
wird die Leistungen des Autors zu würdigen
wissen.
Die Handschriften befinden sich in Dresden,
Leipzig, Kloster Marienthal, Zittau und Zwickau;
bei weitem den grössten Anteil hat die König!.
Oeffentliche Bibliothek in Dresden. Der Herkunft
nach gehören die meisten Deutschland an, allein
auch Frankreich und Italien sind gut vertreten.
Einen kleineren Raum nehmen Böhmen, Burgund,
Byzanz, Holland, Portugal und der Orient ein.
Einige wenige konnten keiner Nation zugeteilt
werden. Die ältesten Inkunabeln stammen aus
dem 10. Jahrhundert, ein Leipziger’ Evangeliar
vielleicht schon aus dem 9.; das 15. und 16. Jahr-
hundert ist am besten vertreten; ein französisches
und drei deutsche Bücher aus dem 18. beschliessen
zeitlich das Vorhandene.
Wir sind dem Verfasser grossen Dank schuldig,
dass er uns den Einblick in die reichen Buch-
schätze Sachsens eröffnet hat. Nachdem wir nun
einmal wissen, welch wertvolles Material in den
dortigen Bibliotheken ruht, dürfen wir gespannt
sein auf Brucks „Geschichte der sächsischen Buch-
malerei", die er zu schreiben gedenkt und zu der die
vorliegende Arbeit eine Vorstudie ist. Möge ihm
dabei ein glücklicher Stern leuchten.
Curt Sachs
Max Semrau; Gedächtnisrede auf Adolph
von Menzel. S.-A. aus dem Jahresbericht
der schlesischen Gesellschaft f. vaterl.
Kultur 1905. 16 S.S. 8°.
In knappen Strichen ist hier das Lebenswerk
Menzels skizziert. Besonders erfreulich wirkt es,
dass Semrau sich durch die Gelegenheit nicht
hinreissen liess, das „spezifisch schlesische“ in
Menzel zu entdecken, sondern ihm in seiner Dar-
stellung an Objektivität nichts nachgab.
Paul Meyerheim: Adolf von Menzel. Er-
innerungen. Berlin 1906. G e b r. P a e t e 1.
8°. 159 S.S. 1 Bild in Dreifarbendruck,
11 Lichtdr., 1 Faks.
Meyerheim, der als Literat ja kein Neuling
ist, zeigt auch in diesem Buch, dass er in Worten
nicht weniger amüsant zu plaudern versteht als
auf seinen Bildern. Teils aus eigenen Erinne-
rungen, teils aus Mitteilungen anderer, bringt er
eine ganze Menge von Material, das dem künftigen
Biographen Menzels sicher schätzenswert sein wird.
Vieles in Menzels Persönlichkeit wird durch das
authentische Zeugnis Meyerheims klarer oder die
auf anderem Wege gefundene Erkenntnis erfährt
durch ihn ihre Bestätigung, so z. B. sein Verhältnis
zu den Frauen. Leider findet sich nur wenig von
den „künstlerischen Ratschlägen" und „technischen
Erfahrungen“ Menzels, die Meyerheim in seinen
einleitenden Worten wiederzugeben verspricht;
hoffentlich findet er Gelegenheit, das Versäumte
noch nachzuholen.
Julius Meier - Gräfe: Der junge Menzel.
Leipzig, Insel-Verlag, 1906. 8°. 271 S.S.
Mark. 6.—, geb. 7.50.
Weit bedeutender als die beiden eben ge-
nannten Gelegenheitsarbeiten über Menzel ist diese
Studie Meier-Gräfes. Mit den Mitteln seiner
Aesthetik, die er in seiner „Entwicklungsgeschichte“
und im „Fall Böcklin“ dargelegt hat, versucht
Meier-Gräfe dem Problem des jungen Menzel näher
zu kommen. In seinem Resultat, wenn er nämlich
zu einer hohen Schätzung der Kugler-Illustrationen,
des Balkonzimmers, des Gymnase - Theaters, der
beiden letzten unvollendeten Friedrichsbilder
(Friedrich der Grosse bei Lissa und die Ansprache
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
67
Tirol", das andere von Hans Tietze über „Die illu-
minierten Handschriften in Salzburg". In Deutsch-
land selbst haben wir bisher nur Spezialstudien
über einige Lokalschulen oder Einzeluntersuchun-
gen gehabt. Franz Xaver Kraus arbeitete über
den Trierer Egbert-Codex, Stephan Beissel über
Aachener und Hildesheimer Handschriften, Oechel-
häuser über Heidelberger Miniaturen, Swarzenski
über die Regensburger Buchmalerei. Braun über
Trier, Goldschmidt über den Albanipsalter, Rahn
über das Psalterium aureum, Lamprecht über Trier
und Gotha, Clemen über die Schreibschule von
Fulda; andere Einzeluntersuchungen gaben nament-
lich Springer und Janitschek, Vöge, Sauerland,
Haseloff und Kobell. Endlich scheint man jetzt
an eine Aufnahme des überhaupt vorhandenen
Materials gehen zu wollen. In dieser Hinsicht ist
die vorliegende Arbeit Brucks die erste.
Bruck führt alle Handschriften der Bibliothe-
ken in Sachsen an, soweit sie überhaupt kunst-
geschichtliches Interesse haben, und beschreibt sie
auf das genaueste. Dabei werden auch stellen-
weise Bemerkungen über die Technik gegeben, die
manche wichtigen Aufschlüsse geben. Aus der
grossen Masse der deutschen Bücher sondert er
nur die sächsischen aus, während der Rest als
„deutsche“ schlechthin bezeichnet ist, auch da, wo
wir heute ganz genaue lokale Scheidungen vorzu-
nehmen imstande sind. Ich glaube, dass das Werk
durch ein Eingehen auf die engere Provenienz
wenigstens der deutschen Schriften manchem
Wunsch entgegengekommen wäre. Wertvoll ist
vor allem das umfangreiche Abbildungsmaterial,
das durchweg nach eigenen Aufnahmen des Ver-
fassers hergestellt ist. Wer jemals in der Lage
war, Handschriften photographieren zu müssen,
wird die Leistungen des Autors zu würdigen
wissen.
Die Handschriften befinden sich in Dresden,
Leipzig, Kloster Marienthal, Zittau und Zwickau;
bei weitem den grössten Anteil hat die König!.
Oeffentliche Bibliothek in Dresden. Der Herkunft
nach gehören die meisten Deutschland an, allein
auch Frankreich und Italien sind gut vertreten.
Einen kleineren Raum nehmen Böhmen, Burgund,
Byzanz, Holland, Portugal und der Orient ein.
Einige wenige konnten keiner Nation zugeteilt
werden. Die ältesten Inkunabeln stammen aus
dem 10. Jahrhundert, ein Leipziger’ Evangeliar
vielleicht schon aus dem 9.; das 15. und 16. Jahr-
hundert ist am besten vertreten; ein französisches
und drei deutsche Bücher aus dem 18. beschliessen
zeitlich das Vorhandene.
Wir sind dem Verfasser grossen Dank schuldig,
dass er uns den Einblick in die reichen Buch-
schätze Sachsens eröffnet hat. Nachdem wir nun
einmal wissen, welch wertvolles Material in den
dortigen Bibliotheken ruht, dürfen wir gespannt
sein auf Brucks „Geschichte der sächsischen Buch-
malerei", die er zu schreiben gedenkt und zu der die
vorliegende Arbeit eine Vorstudie ist. Möge ihm
dabei ein glücklicher Stern leuchten.
Curt Sachs
Max Semrau; Gedächtnisrede auf Adolph
von Menzel. S.-A. aus dem Jahresbericht
der schlesischen Gesellschaft f. vaterl.
Kultur 1905. 16 S.S. 8°.
In knappen Strichen ist hier das Lebenswerk
Menzels skizziert. Besonders erfreulich wirkt es,
dass Semrau sich durch die Gelegenheit nicht
hinreissen liess, das „spezifisch schlesische“ in
Menzel zu entdecken, sondern ihm in seiner Dar-
stellung an Objektivität nichts nachgab.
Paul Meyerheim: Adolf von Menzel. Er-
innerungen. Berlin 1906. G e b r. P a e t e 1.
8°. 159 S.S. 1 Bild in Dreifarbendruck,
11 Lichtdr., 1 Faks.
Meyerheim, der als Literat ja kein Neuling
ist, zeigt auch in diesem Buch, dass er in Worten
nicht weniger amüsant zu plaudern versteht als
auf seinen Bildern. Teils aus eigenen Erinne-
rungen, teils aus Mitteilungen anderer, bringt er
eine ganze Menge von Material, das dem künftigen
Biographen Menzels sicher schätzenswert sein wird.
Vieles in Menzels Persönlichkeit wird durch das
authentische Zeugnis Meyerheims klarer oder die
auf anderem Wege gefundene Erkenntnis erfährt
durch ihn ihre Bestätigung, so z. B. sein Verhältnis
zu den Frauen. Leider findet sich nur wenig von
den „künstlerischen Ratschlägen" und „technischen
Erfahrungen“ Menzels, die Meyerheim in seinen
einleitenden Worten wiederzugeben verspricht;
hoffentlich findet er Gelegenheit, das Versäumte
noch nachzuholen.
Julius Meier - Gräfe: Der junge Menzel.
Leipzig, Insel-Verlag, 1906. 8°. 271 S.S.
Mark. 6.—, geb. 7.50.
Weit bedeutender als die beiden eben ge-
nannten Gelegenheitsarbeiten über Menzel ist diese
Studie Meier-Gräfes. Mit den Mitteln seiner
Aesthetik, die er in seiner „Entwicklungsgeschichte“
und im „Fall Böcklin“ dargelegt hat, versucht
Meier-Gräfe dem Problem des jungen Menzel näher
zu kommen. In seinem Resultat, wenn er nämlich
zu einer hohen Schätzung der Kugler-Illustrationen,
des Balkonzimmers, des Gymnase - Theaters, der
beiden letzten unvollendeten Friedrichsbilder
(Friedrich der Grosse bei Lissa und die Ansprache