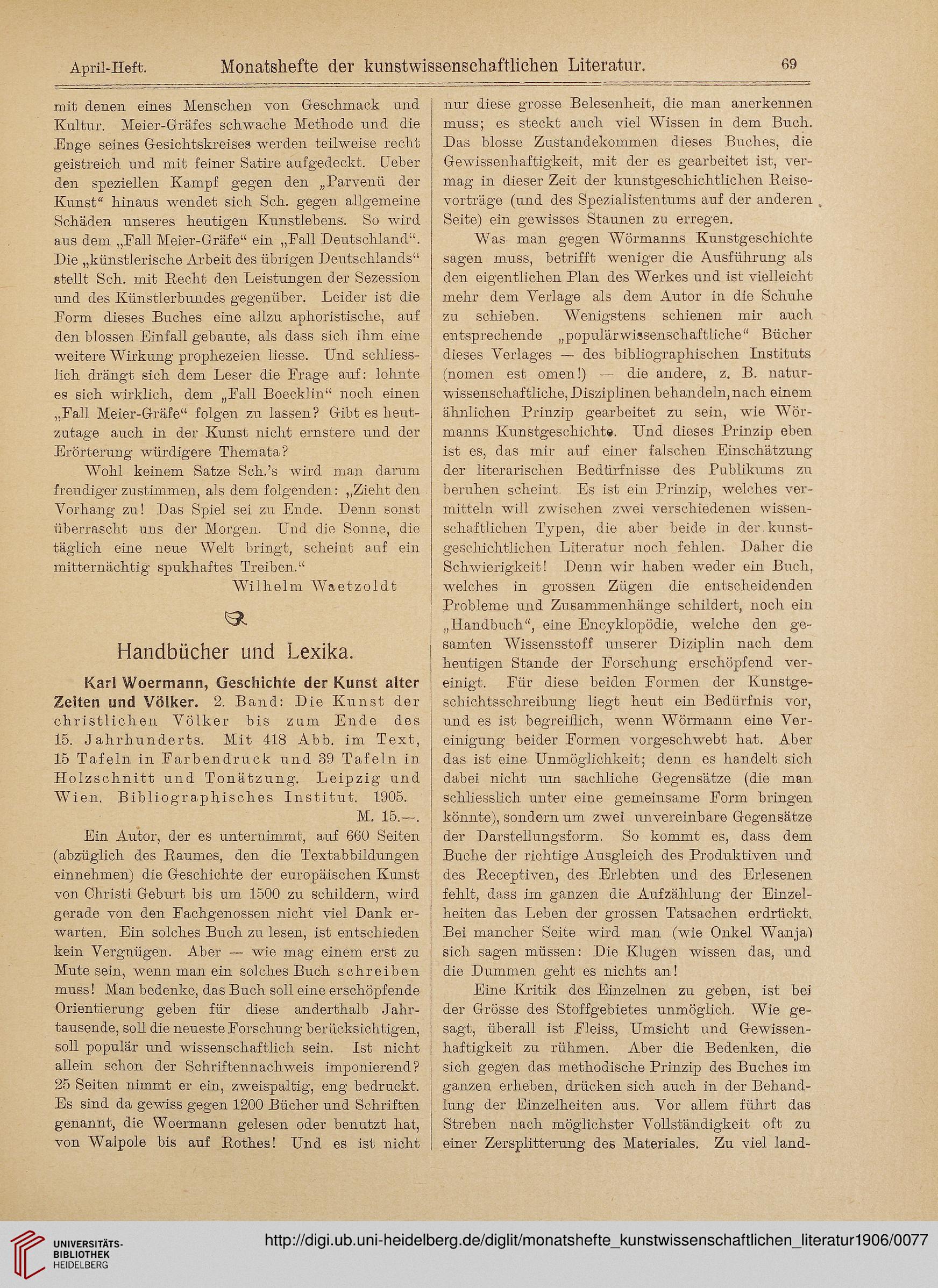April-Heft.
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
69
mit denen eines Menschen von Geschmack und
Kultur. Meier-Gräfes schwache Methode und die
Enge seines Gesichtskreises werden teilweise recht
geistreich und mit feiner Satire aufgedeckt. Geber
den speziellen Kampf gegen den „Parvenü der
Kunst® hinaus wendet sich Sch. gegen allgemeine
Schäden unseres heutigen Kunstlebens. So wird
aus dem „Fall Meier-Gräfe“ ein „Fall Deutschland“.
Die „künstlerische Arbeit des übrigen Deutschlands“
stellt Sch. mit Recht den Leistungen der Sezession
und des Künstlerbundes gegenüber. Leider ist die
Form dieses Buches eine allzu aphoristische, auf
den blossen Einfall gebaute, als dass sich ihm eine
weitere Wirkung prophezeien liesse. Und schliess-
lich drängt sich dem Leser die Frage auf: lohnte
es sich wirklich, dem „Fall Boecklin“ noch einen
„Fall Meier-Gräfe“ folgen zu lassen? Gibt es heut-
zutage auch in der Kunst nicht ernstere und der
Erörterung würdigere Themata?
Wohl keinem Satze Sch.’s wird man darum
freudiger’ zustimmen, als dem folgenden: „Zieht den
Vorhang zu! Das Spiel sei zu Ende. Denn sonst
überrascht uns der Morgen. Und die Sonne, die
täglich eine neue Welt bringt, scheint auf ein
mitternächtig spukhaftes Treiben.“
Wilhelm Waetzoldt
Handbücher und Lexika.
Karl Woermann, Geschichte der Kunst alter
Zeiten und Völker. 2. Band: Die Kunst der
christlichen Völker bis zum Ende des
15. Jahrhunderts. Mit 418 Abb. im Text,
15 Tafeln in Farbendruck und 39 Tafeln in
Holzschnitt und Tonätzung. Leipzig und
Wien. Bibliographisches Institut. 1905.
M. 15.-.
Ein Autor, der es unternimmt, auf 660 Seiten
(abzüglich des Raumes, den die Textabbildungen
einnehmen) die Geschichte der europäischen Kunst
von Christi Geburt bis um 1500 zu schildern, wird
gerade von den Fachgenossen nicht viel Dank er-
warten. Ein solches Buch zu lesen, ist entschieden
kein Vergnügen. Aber — wie mag einem erst zu
Mute sein, wenn man ein solches Buch schreiben
muss! Man bedenke, das Buch soll eine erschöpfende
Orientierung geben für diese anderthalb Jahr-
tausende, soll die neueste Forschung berücksichtigen,
soll populär und wissenschaftlich sein. Ist nicht
allein schon der Schriftennachweis imponierend?
25 Seiten nimmt er ein, zweispaltig, eng bedruckt.
Es sind da gewiss gegen 1200 Bücher und Schriften
genannt, die Woermann gelesen oder benutzt hat,
von Walpole bis auf Rothes! Und es ist nicht
nur diese grosse Belesenheit, die man anerkennen
muss; es steckt auch viel Wissen in dem Buch.
Das blosse Zustandekommen dieses Buches, die
Gewissenhaftigkeit, mit der es gearbeitet ist, ver-
mag in dieser Zeit der kunstgeschichtlichen Reise-
vorträge (und des Spezialistentums auf der anderen
Seite) ein gewisses Staunen zu erregen.
Was man gegen Wörmanns Kunstgeschichte
sagen muss, betrifft weniger die Ausführung als
den eigentlichen Plan des Werkes und ist vielleicht
mehr dem Verlage als dem Autor in die Schuhe
zu schieben. Wenigstens schienen mir auch
entsprechende „populärwissenschaftliche“ Bücher
dieses Verlages — des bibliographischen Instituts
(nomen est omen!) — die andere, z. B. natur-
wissenschaftliche, Disziplinen behandeln, nach einem
ähnlichen Prinzip gearbeitet zu sein, wie Wör-
manns Kunstgeschichte. Und dieses Prinzip eben
ist es, das mir auf einer falschen Einschätzung
der literarischen Bedürfnisse des Publikums zu
beruhen scheint. Es ist ein Prinzip, welches ver-
mitteln will zwischen zwei verschiedenen wissen-
schaftlichen Typen, die aber beide in der kunst-
geschichtlichen Literatur noch fehlen. Daher die
Schwierigkeit! Denn wir haben weder ein Buch,
welches in grossen Zügen die entscheidenden
Probleme und Zusammenhänge schildert, noch ein
„Handbuch“, eine Encyklopödie, welche den ge-
samten Wissensstoff unserer Diziplin nach dem
heutigen Stande der Forschung erschöpfend ver-
einigt. Für diese beiden Formen der Kunstge-
schichtsschreibung liegt heut ein Bedürfnis vor,
und es ist begreiflich, wenn Wörmann eine Ver-
einigung beider Formen vorgeschwebt hat. Aber
das ist eine Unmöglichkeit; denn es handelt sich
dabei nicht um sachliche Gegensätze (die man
schliesslich unter eine gemeinsame Form bringen
könnte), sondern um zwei unvereinbare Gegensätze
der Darstellungsform. So kommt es, dass dem
Buche der richtige Ausgleich des Produktiven und
des Receptiven, des Erlebten und des Erlesenen
fehlt, dass im ganzen die Aufzählung der Einzel-
heiten das Leben der grossen Tatsachen erdrückt.
Bei mancher Seite wird man (wie Onkel Wanja)
sich sagen müssen: Die Klugen wissen das, und
die Dummen geht es nichts an!
Eine Kritik des Einzelnen zu geben, ist bei
der Grösse des Stoffgebietes unmöglich. Wie ge-
sagt, überall ist Fleiss, Umsicht und Gewissen-
haftigkeit zu rühmen. Aber die Bedenken, die
sich gegen das methodische Prinzip des Buches im
ganzen erheben, drücken sich auch in der Behand-
lung der Einzelheiten aus. Vor allem führt das
Streben nach möglichster Vollständigkeit oft zu
einer Zersplitterung des Materiales. Zu viel land-
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
69
mit denen eines Menschen von Geschmack und
Kultur. Meier-Gräfes schwache Methode und die
Enge seines Gesichtskreises werden teilweise recht
geistreich und mit feiner Satire aufgedeckt. Geber
den speziellen Kampf gegen den „Parvenü der
Kunst® hinaus wendet sich Sch. gegen allgemeine
Schäden unseres heutigen Kunstlebens. So wird
aus dem „Fall Meier-Gräfe“ ein „Fall Deutschland“.
Die „künstlerische Arbeit des übrigen Deutschlands“
stellt Sch. mit Recht den Leistungen der Sezession
und des Künstlerbundes gegenüber. Leider ist die
Form dieses Buches eine allzu aphoristische, auf
den blossen Einfall gebaute, als dass sich ihm eine
weitere Wirkung prophezeien liesse. Und schliess-
lich drängt sich dem Leser die Frage auf: lohnte
es sich wirklich, dem „Fall Boecklin“ noch einen
„Fall Meier-Gräfe“ folgen zu lassen? Gibt es heut-
zutage auch in der Kunst nicht ernstere und der
Erörterung würdigere Themata?
Wohl keinem Satze Sch.’s wird man darum
freudiger’ zustimmen, als dem folgenden: „Zieht den
Vorhang zu! Das Spiel sei zu Ende. Denn sonst
überrascht uns der Morgen. Und die Sonne, die
täglich eine neue Welt bringt, scheint auf ein
mitternächtig spukhaftes Treiben.“
Wilhelm Waetzoldt
Handbücher und Lexika.
Karl Woermann, Geschichte der Kunst alter
Zeiten und Völker. 2. Band: Die Kunst der
christlichen Völker bis zum Ende des
15. Jahrhunderts. Mit 418 Abb. im Text,
15 Tafeln in Farbendruck und 39 Tafeln in
Holzschnitt und Tonätzung. Leipzig und
Wien. Bibliographisches Institut. 1905.
M. 15.-.
Ein Autor, der es unternimmt, auf 660 Seiten
(abzüglich des Raumes, den die Textabbildungen
einnehmen) die Geschichte der europäischen Kunst
von Christi Geburt bis um 1500 zu schildern, wird
gerade von den Fachgenossen nicht viel Dank er-
warten. Ein solches Buch zu lesen, ist entschieden
kein Vergnügen. Aber — wie mag einem erst zu
Mute sein, wenn man ein solches Buch schreiben
muss! Man bedenke, das Buch soll eine erschöpfende
Orientierung geben für diese anderthalb Jahr-
tausende, soll die neueste Forschung berücksichtigen,
soll populär und wissenschaftlich sein. Ist nicht
allein schon der Schriftennachweis imponierend?
25 Seiten nimmt er ein, zweispaltig, eng bedruckt.
Es sind da gewiss gegen 1200 Bücher und Schriften
genannt, die Woermann gelesen oder benutzt hat,
von Walpole bis auf Rothes! Und es ist nicht
nur diese grosse Belesenheit, die man anerkennen
muss; es steckt auch viel Wissen in dem Buch.
Das blosse Zustandekommen dieses Buches, die
Gewissenhaftigkeit, mit der es gearbeitet ist, ver-
mag in dieser Zeit der kunstgeschichtlichen Reise-
vorträge (und des Spezialistentums auf der anderen
Seite) ein gewisses Staunen zu erregen.
Was man gegen Wörmanns Kunstgeschichte
sagen muss, betrifft weniger die Ausführung als
den eigentlichen Plan des Werkes und ist vielleicht
mehr dem Verlage als dem Autor in die Schuhe
zu schieben. Wenigstens schienen mir auch
entsprechende „populärwissenschaftliche“ Bücher
dieses Verlages — des bibliographischen Instituts
(nomen est omen!) — die andere, z. B. natur-
wissenschaftliche, Disziplinen behandeln, nach einem
ähnlichen Prinzip gearbeitet zu sein, wie Wör-
manns Kunstgeschichte. Und dieses Prinzip eben
ist es, das mir auf einer falschen Einschätzung
der literarischen Bedürfnisse des Publikums zu
beruhen scheint. Es ist ein Prinzip, welches ver-
mitteln will zwischen zwei verschiedenen wissen-
schaftlichen Typen, die aber beide in der kunst-
geschichtlichen Literatur noch fehlen. Daher die
Schwierigkeit! Denn wir haben weder ein Buch,
welches in grossen Zügen die entscheidenden
Probleme und Zusammenhänge schildert, noch ein
„Handbuch“, eine Encyklopödie, welche den ge-
samten Wissensstoff unserer Diziplin nach dem
heutigen Stande der Forschung erschöpfend ver-
einigt. Für diese beiden Formen der Kunstge-
schichtsschreibung liegt heut ein Bedürfnis vor,
und es ist begreiflich, wenn Wörmann eine Ver-
einigung beider Formen vorgeschwebt hat. Aber
das ist eine Unmöglichkeit; denn es handelt sich
dabei nicht um sachliche Gegensätze (die man
schliesslich unter eine gemeinsame Form bringen
könnte), sondern um zwei unvereinbare Gegensätze
der Darstellungsform. So kommt es, dass dem
Buche der richtige Ausgleich des Produktiven und
des Receptiven, des Erlebten und des Erlesenen
fehlt, dass im ganzen die Aufzählung der Einzel-
heiten das Leben der grossen Tatsachen erdrückt.
Bei mancher Seite wird man (wie Onkel Wanja)
sich sagen müssen: Die Klugen wissen das, und
die Dummen geht es nichts an!
Eine Kritik des Einzelnen zu geben, ist bei
der Grösse des Stoffgebietes unmöglich. Wie ge-
sagt, überall ist Fleiss, Umsicht und Gewissen-
haftigkeit zu rühmen. Aber die Bedenken, die
sich gegen das methodische Prinzip des Buches im
ganzen erheben, drücken sich auch in der Behand-
lung der Einzelheiten aus. Vor allem führt das
Streben nach möglichster Vollständigkeit oft zu
einer Zersplitterung des Materiales. Zu viel land-