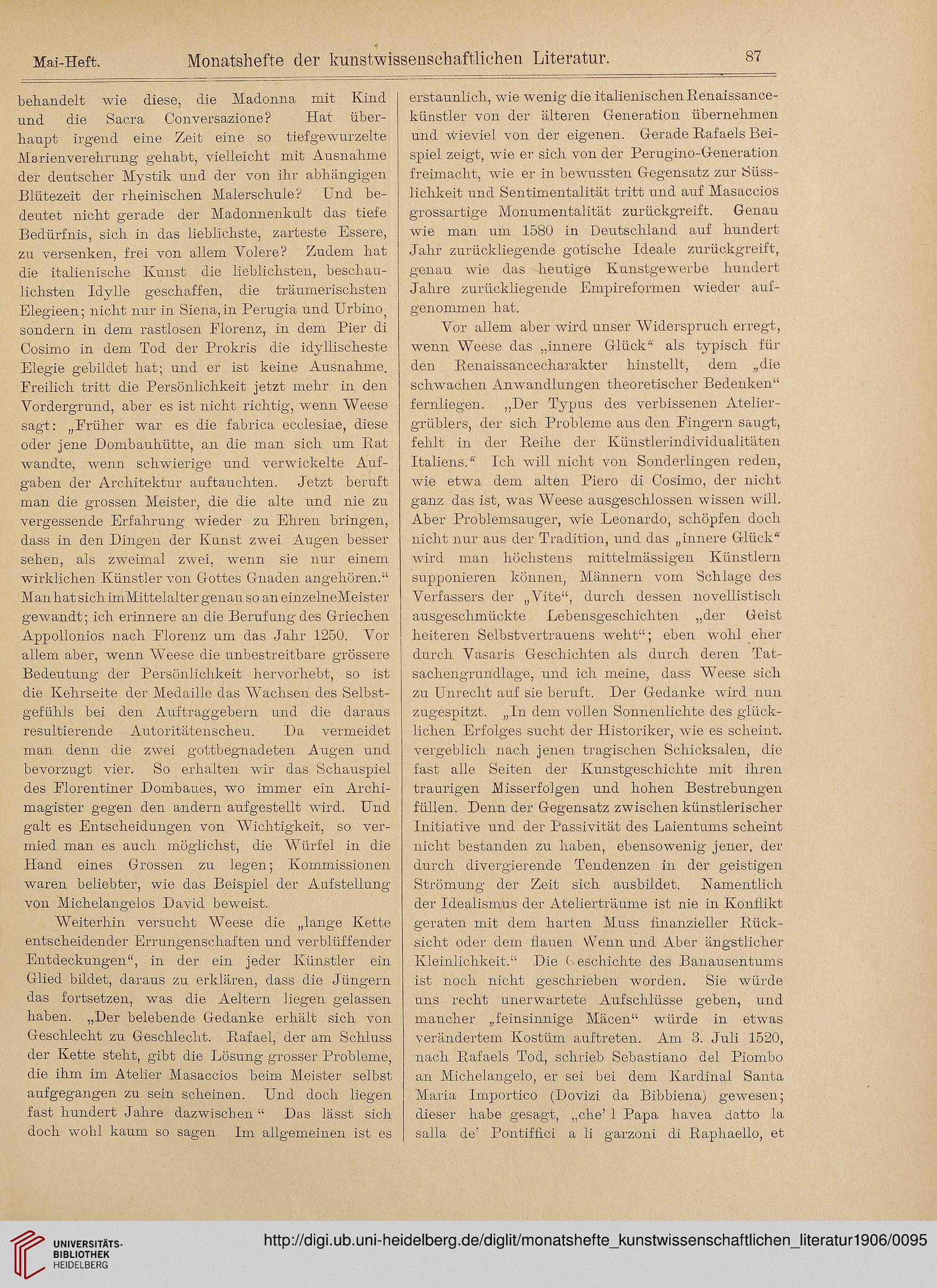Mai-Heft.
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
87
behandelt wie diese, die Madonna mit Kind
und die Sacra Conversazione? Hat über-
haupt irgend eine Zeit eine so tiefgewurzelte
Marienverehrung gehabt, vielleicht mit Ausnahme
der deutscher Mystik und der von ihr abhängigen
Blütezeit der rheinischen Malerschule? Und be-
deutet nicht gerade der Madonnenkult das tiefe
Bedürfnis, sich in das lieblichste, zarteste Essere,
zu versenken, frei von allem Volere? Zudem hat
die italienische Kunst die lieblichsten, beschau-
lichsten Idylle geschaffen, die träumerischsten
Elegieen; nicht nur in Siena, in Perugia und Urbino,
sondern in dem rastlosen Florenz, in dem Pier di
Cosimo in dem Tod der Prokris die idyllischeste
Elegie gebildet hat; und er ist keine Ausnahme.
Freilich tritt die Persönlichkeit jetzt mehr in den
Vordergrund, aber es ist nicht richtig, wenn Weese
sagt: „Früher war es die fabrica ecclesiae, diese
oder jene Dombauhütte, an die man sich um Bat
wandte, wenn schwierige und verwickelte Auf-
gaben der Architektur auftauchten. Jetzt beruft
man die grossen Meister, die die alte und nie zu
vergessende Erfahrung wieder zu Ehren bringen,
dass in den Dingen der Kunst zwei Augen besser
sehen, als zweimal zwei, wenn sie nur einem
wirklichen Künstler von Gottes Gnaden angehören.“
Man hat sich im Mittelalter genau so an einzelneMeister
gewandt; ich erinnere an die Berufung des Griechen
Appollonios nach Florenz um das Jahr 1250. Vor
allem aber, wenn Weese die unbestreitbare grössere
Bedeutung der Persönlichkeit hervorhebt, so ist
die Kehrseite der Medaille das Wachsen des Selbst-
gefühls bei den Auftraggebern und die daraus
resultierende Autoritätenscheu. Da vermeidet
man denn die zwei gottbegnadeten Augen und
bevorzugt vier. So erhalten wir das Schauspiel
des Florentiner Dombaues, wo immer ein Archi-
magister gegen den andern aufgestellt wird. Und
galt es Entscheidungen von Wichtigkeit, so ver-
mied man es auch möglichst, die Würfel in die
Hand eines Grossen zu legen; Kommissionen
waren beliebter, wie das Beispiel der Aufstellung
von Michelangelos David beweist.
Weiterhin versucht Weese die „lange Kette
entscheidender Errungenschaften und verblüffender
Entdeckungen“, in der ein jeder Künstler ein
Glied bildet, daraus zu erklären, dass die Jüngern
das fortsetzen, was die Aeltern liegen gelassen
haben. „Der belebende Gedanke erhält sich von
Geschlecht zu Geschlecht. Bafael, der am Schluss
der Kette steht, gibt die Lösung grosser Probleme,
die ihm im Atelier Masaccios beim Meister selbst
aufgegangen zu sein scheinen. Und doch liegen
fast hundert Jahre dazwischen“ Das lässt sich
doch wohl kaum so sagen Im allgemeinen ist es
erstaunlich, wie wenig die italienischen Benaissance-
künstler von der älteren Generation übernehmen
und wieviel von der eigenen. Gerade Bafaels Bei-
spiel zeigt, wie er sich von der Perugino-Generation
freimacht, wie er in bewussten Gegensatz zur Süss-
lichkeit und Sentimentalität tritt und auf Masaccios
grossartige Monumentalität zurückgreift. Genau
wie man um 1580 in Deutschland auf hundert
Jahr zurückliegende gotische Ideale zurückgreift,
genau wie das heutige Kunstgewerbe hundert
Jahre zurückliegende Empireformen wieder auf-
genommen hat.
Vor allem aber wird unser Widerspruch erregt,
wenn Weese das „innere Glück“ als typisch für
den Benaissancecharakter hinstellt, dem „die
schwachen Anwandlungen theoretischer Bedenken“
fernliegen. „Der Typus des verbissenen Atelier-
grüblers, der sich Probleme aus den Fingern saugt,
fehlt in der Beihe der Künstlerindividualitäten
Italiens.“ Ich will nicht von Sonderlingen reden,
wie etwa dem alten Piero di Cosimo, der nicht
ganz das ist, was Weese ausgeschlossen wissen will.
Aber Problemsauger, wie Leonardo, schöpfen doch
nicht nur aus der Tradition, und das „innere Glück“
wird man höchstens mittelmässigen Künstlern
supponieren können, Männern vom Schlage des
Verfassers der „Vite“, durch dessen novellistisch
ausgeschmückte Lebensgeschichten „der- Geist
heiteren Selbstvertrauens weht“; eben wohl eher
durch Vasaris Geschichten als durch deren Tat-
sachengrundlage, und ich meine, dass Weese sich
zu Unrecht auf sie beruft. Der Gedanke wird nun
zugespitzt. „In dem vollen Sonnenlichte des glück-
lichen Erfolges sucht der Historiker, wie es scheint,
vergeblich nach jenen tragischen Schicksalen, die
fast alle Seiten der Kunstgeschichte mit ihren
traurigen Misserfolgen und hohen Bestrebungen
füllen. Denn der Gegensatz zwischen künstlerischer
Initiative und der Passivität des Laientums scheint
nicht bestanden zu haben, ebensowenig jener, der
durch divergierende Tendenzen in der geistigen
Strömung der Zeit sich ausbildet. Namentlich
der Idealismus der Atelierträume ist nie in Konflikt
geraten mit dem harten Muss finanzieller Bück-
sicht oder dem flauen Wenn und Aber ängstlicher
Kleinlichkeit.“ Die beschichte des Banausentums
ist noch nicht geschrieben worden. Sie würde
uns recht unerwartete Aufschlüsse geben, und
mancher „feinsinnige Mäcen“ würde in etwas
verändertem Kostüm auftreten. Am 3. Juli 1520,
nach Bafaels Tod, schrieb Sebastiano del Piombo
an Michelangelo, er sei bei dem Kardinal Santa
Maria Importico (Dovizi da Bibbienaj gewesen;
dieser habe gesagt, „ehe’ 1 Papa havea datto la
salla de’ Pontiffici a li garzoni di Baphaello, et
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
87
behandelt wie diese, die Madonna mit Kind
und die Sacra Conversazione? Hat über-
haupt irgend eine Zeit eine so tiefgewurzelte
Marienverehrung gehabt, vielleicht mit Ausnahme
der deutscher Mystik und der von ihr abhängigen
Blütezeit der rheinischen Malerschule? Und be-
deutet nicht gerade der Madonnenkult das tiefe
Bedürfnis, sich in das lieblichste, zarteste Essere,
zu versenken, frei von allem Volere? Zudem hat
die italienische Kunst die lieblichsten, beschau-
lichsten Idylle geschaffen, die träumerischsten
Elegieen; nicht nur in Siena, in Perugia und Urbino,
sondern in dem rastlosen Florenz, in dem Pier di
Cosimo in dem Tod der Prokris die idyllischeste
Elegie gebildet hat; und er ist keine Ausnahme.
Freilich tritt die Persönlichkeit jetzt mehr in den
Vordergrund, aber es ist nicht richtig, wenn Weese
sagt: „Früher war es die fabrica ecclesiae, diese
oder jene Dombauhütte, an die man sich um Bat
wandte, wenn schwierige und verwickelte Auf-
gaben der Architektur auftauchten. Jetzt beruft
man die grossen Meister, die die alte und nie zu
vergessende Erfahrung wieder zu Ehren bringen,
dass in den Dingen der Kunst zwei Augen besser
sehen, als zweimal zwei, wenn sie nur einem
wirklichen Künstler von Gottes Gnaden angehören.“
Man hat sich im Mittelalter genau so an einzelneMeister
gewandt; ich erinnere an die Berufung des Griechen
Appollonios nach Florenz um das Jahr 1250. Vor
allem aber, wenn Weese die unbestreitbare grössere
Bedeutung der Persönlichkeit hervorhebt, so ist
die Kehrseite der Medaille das Wachsen des Selbst-
gefühls bei den Auftraggebern und die daraus
resultierende Autoritätenscheu. Da vermeidet
man denn die zwei gottbegnadeten Augen und
bevorzugt vier. So erhalten wir das Schauspiel
des Florentiner Dombaues, wo immer ein Archi-
magister gegen den andern aufgestellt wird. Und
galt es Entscheidungen von Wichtigkeit, so ver-
mied man es auch möglichst, die Würfel in die
Hand eines Grossen zu legen; Kommissionen
waren beliebter, wie das Beispiel der Aufstellung
von Michelangelos David beweist.
Weiterhin versucht Weese die „lange Kette
entscheidender Errungenschaften und verblüffender
Entdeckungen“, in der ein jeder Künstler ein
Glied bildet, daraus zu erklären, dass die Jüngern
das fortsetzen, was die Aeltern liegen gelassen
haben. „Der belebende Gedanke erhält sich von
Geschlecht zu Geschlecht. Bafael, der am Schluss
der Kette steht, gibt die Lösung grosser Probleme,
die ihm im Atelier Masaccios beim Meister selbst
aufgegangen zu sein scheinen. Und doch liegen
fast hundert Jahre dazwischen“ Das lässt sich
doch wohl kaum so sagen Im allgemeinen ist es
erstaunlich, wie wenig die italienischen Benaissance-
künstler von der älteren Generation übernehmen
und wieviel von der eigenen. Gerade Bafaels Bei-
spiel zeigt, wie er sich von der Perugino-Generation
freimacht, wie er in bewussten Gegensatz zur Süss-
lichkeit und Sentimentalität tritt und auf Masaccios
grossartige Monumentalität zurückgreift. Genau
wie man um 1580 in Deutschland auf hundert
Jahr zurückliegende gotische Ideale zurückgreift,
genau wie das heutige Kunstgewerbe hundert
Jahre zurückliegende Empireformen wieder auf-
genommen hat.
Vor allem aber wird unser Widerspruch erregt,
wenn Weese das „innere Glück“ als typisch für
den Benaissancecharakter hinstellt, dem „die
schwachen Anwandlungen theoretischer Bedenken“
fernliegen. „Der Typus des verbissenen Atelier-
grüblers, der sich Probleme aus den Fingern saugt,
fehlt in der Beihe der Künstlerindividualitäten
Italiens.“ Ich will nicht von Sonderlingen reden,
wie etwa dem alten Piero di Cosimo, der nicht
ganz das ist, was Weese ausgeschlossen wissen will.
Aber Problemsauger, wie Leonardo, schöpfen doch
nicht nur aus der Tradition, und das „innere Glück“
wird man höchstens mittelmässigen Künstlern
supponieren können, Männern vom Schlage des
Verfassers der „Vite“, durch dessen novellistisch
ausgeschmückte Lebensgeschichten „der- Geist
heiteren Selbstvertrauens weht“; eben wohl eher
durch Vasaris Geschichten als durch deren Tat-
sachengrundlage, und ich meine, dass Weese sich
zu Unrecht auf sie beruft. Der Gedanke wird nun
zugespitzt. „In dem vollen Sonnenlichte des glück-
lichen Erfolges sucht der Historiker, wie es scheint,
vergeblich nach jenen tragischen Schicksalen, die
fast alle Seiten der Kunstgeschichte mit ihren
traurigen Misserfolgen und hohen Bestrebungen
füllen. Denn der Gegensatz zwischen künstlerischer
Initiative und der Passivität des Laientums scheint
nicht bestanden zu haben, ebensowenig jener, der
durch divergierende Tendenzen in der geistigen
Strömung der Zeit sich ausbildet. Namentlich
der Idealismus der Atelierträume ist nie in Konflikt
geraten mit dem harten Muss finanzieller Bück-
sicht oder dem flauen Wenn und Aber ängstlicher
Kleinlichkeit.“ Die beschichte des Banausentums
ist noch nicht geschrieben worden. Sie würde
uns recht unerwartete Aufschlüsse geben, und
mancher „feinsinnige Mäcen“ würde in etwas
verändertem Kostüm auftreten. Am 3. Juli 1520,
nach Bafaels Tod, schrieb Sebastiano del Piombo
an Michelangelo, er sei bei dem Kardinal Santa
Maria Importico (Dovizi da Bibbienaj gewesen;
dieser habe gesagt, „ehe’ 1 Papa havea datto la
salla de’ Pontiffici a li garzoni di Baphaello, et