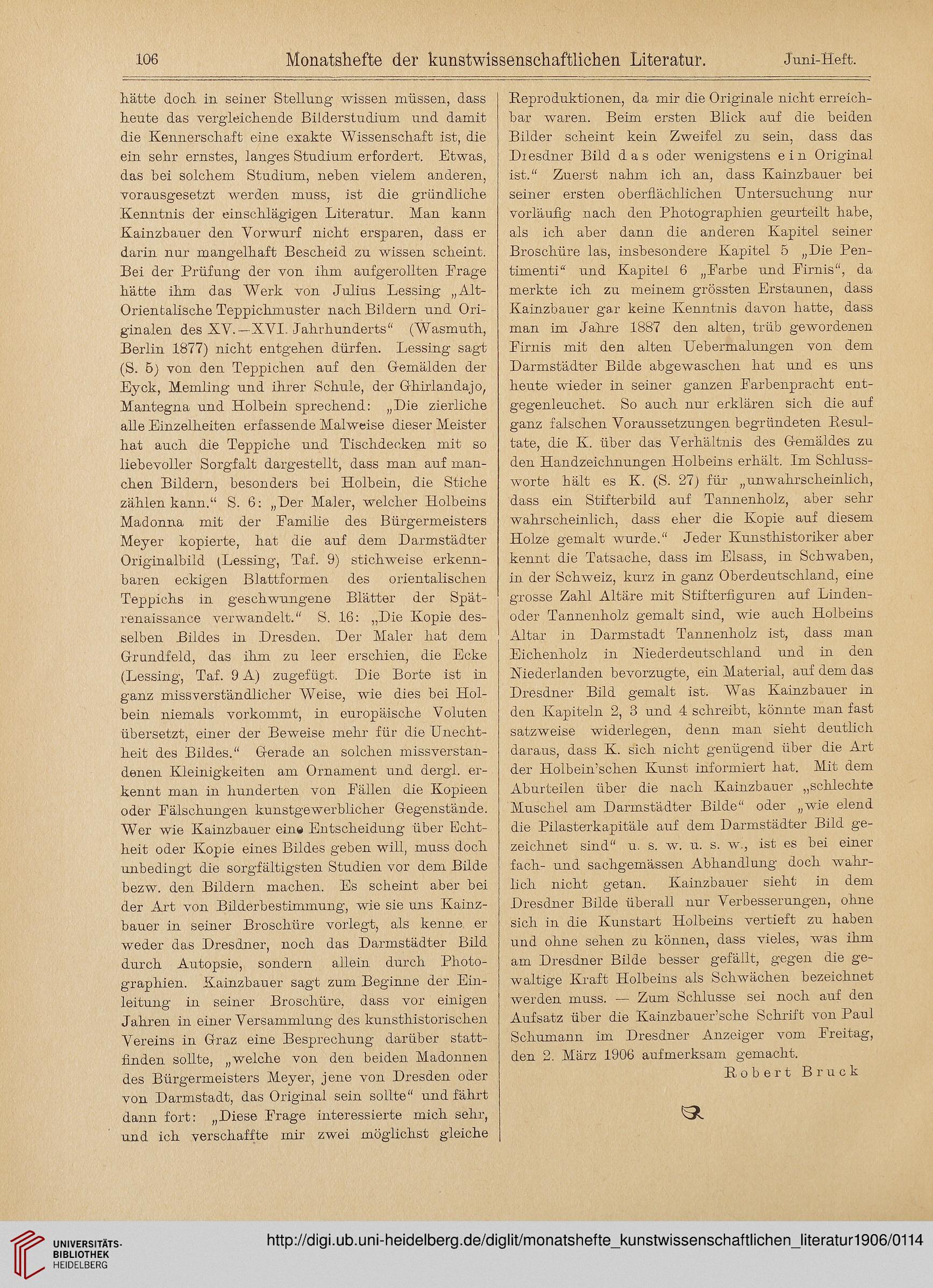106
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
Juni-Heft.
hätte doch in seiner Stellung wissen müssen, dass
heute das vergleichende Bilderstudium und damit
die Kennerschaft eine exakte Wissenschaft ist, die
ein sehr ernstes, langes Studium erfordert. Etwas,
das bei solchem Studium, neben vielem anderen,
vorausgesetzt werden muss, ist die gründliche
Kenntnis der einschlägigen Literatur. Man kann
Kainzbauer den Vorwurf nicht ersparen, dass er
darin nur mangelhaft Bescheid zu wissen scheint.
Bei der Prüfung der von ihm aufgerollten Präge
hätte ihm das Werk von Julius Lessing „Alt-
Orientalische Teppichmuster nach Bildern und Ori-
ginalen des XV.—XVI. Jahrhunderts“ (Wasmuth,
Berlin 1877) nicht entgehen dürfen. Lessing sagt
(S. 5) von den Teppichen auf den Gemälden der
Eyck, Memling und ihrer Schule, der Ghirlandajo,
Mantegna und Holbein sprechend: „Die zierliche
alle Einzelheiten erfassende Malweise dieser' Meister
hat auch die Teppiche und Tischdecken mit so
liebevoller Sorgfalt dargestellt, dass man auf man-
chen Bildern, besonders bei Holbein, die Stiche
zählen kann.“ S. 6: „Der Maler, welcher Holbeins
Madonna mit der Eamilie des Bürgermeisters
Meyer kopierte, hat die auf dem Darmstädter
Originalbild (Lessing, Taf. 9) stichweise erkenn-
baren eckigen Blattformen des orientalischen
Teppichs in geschwungene Blätter der Spät-
renaissance verwandelt.“ S. 16: „Die Kopie des-
selben Bildes in Dresden. Der Maler hat dem
Grundfeld, das ihm zu leer erschien, die Ecke
(Lessing, Taf. 9 A) zugefügt. Die Borte ist in
ganz missverständlicher Weise, wie dies bei Hol-
bein niemals vorkommt, in europäische Voluten
übersetzt, einer der Beweise mehr für die Unecht-
heit des Bildes.“ Gerade an solchen missverstan-
denen Kleinigkeiten am Ornament und dergl. er-
kennt man in hunderten von Bällen die Kopieen
oder Fälschungen kunstgewerblicher Gegenstände.
Wer wie Kainzbauer ein» Entscheidung über Echt-
heit oder Kopie eines Bildes geben will, muss doch
unbedingt die sorgfältigsten Studien vor dem Bilde
bezw. den Bildern machen. Es scheint aber bei
der Art von Bilderbestimmung, wie sie uns Kainz-
bauer in seiner Broschüre vorlegt, als kenne er
weder das Dresdner, noch das Darmstädter Bild
durch Autopsie, sondern allein durch Photo-
graphien. Kainzbauer sagt zum Beginne der Ein-
leitung in seiner Broschüre, dass vor einigen
Jahren in einer Versammlung des kunsthistorischen
Vereins in Graz eine Besprechung darüber statt-
finden sollte, „welche von den beiden Madonnen
des Bürgermeisters Meyer, jene von Dresden oder
von Darmstadt, das Original sein sollte“ und fährt
dann fort: „Diese Frage interessierte mich sehr,
und ich verschaffte mir zwei möglichst gleiche
Reproduktionen, da mir die Originale nicht erreich-
bar waren. Beim ersten Blick auf die beiden
Bilder scheint kein Zweifel zu sein, dass das
Dresdner Bild das oder wenigstens ein Original
ist.“ Zuerst nahm ich an, dass Kainzbauer bei
seiner ersten oberflächlichen Untersuchung nur
vorläufig nach den Photographien geurteilt habe,
als ich aber dann die anderen Kapitel seiner
Broschüre las, insbesondere Kapitel 5 „Die Pen-
timenti“ und Kapitel 6 „Farbe und Firnis“, da
merkte ich zu meinem grössten Erstaunen, dass
Kainzbauer gar keine Kenntnis davon hatte, dass
man im Jahre 1887 den alten, trüb gewordenen
Firnis mit den alten Uebermalungen von dem
Darmstädter Bilde abgewaschen hat und es uns
heute wieder in seiner ganzen Farbenpracht ent-
gegenleuchet. So auch nur erklären sich die auf
ganz falschen Voraussetzungen begründeten Resul-
tate, die K. über das Verhältnis des Gemäldes zu
den Handzeichnungen Holbeins erhält. Im Schluss-
worte hält es K. (S. 27) für „unwahrscheinlich,
dass ein Stifterbild auf Tannenholz, aber sehr
wahrscheinlich, dass eher die Kopie auf diesem
Holze gemalt wurde.“ Jeder Kunsthistoriker aber
kennt die Tatsache, dass im Elsass, in Schwaben,
in der Schweiz, kurz in ganz Oberdeutschland, eine
grosse Zahl Altäre mit Stifterfiguren auf Linden-
oder Tannenholz gemalt sind, wie auch Holbeins
Altar in Darmstadt Tannenholz ist, dass man
Eichenholz in Niederdeutschland und in den
Niederlanden bevorzugte, ein Material, auf dem das
Dresdner Bild gemalt ist. Was Kainzbauer in
den Kapiteln 2, 3 und 4 schreibt, könnte man fast
satzweise widerlegen, denn man sieht deutlich
daraus, dass K. sich nicht genügend über die Art
der Holbein’schen Kunst informiert hat. Mit dem
Aburteilen über die nach Kainzbauer „schlechte
Muschel am Darmstädter Bilde“ oder „wie elend
die Pilasterkapitäle auf dem Darmstädter Bild ge-
zeichnet sind“ u. s. w. u. s. w., ist es bei einer
fach- und sachgemässen Abhandlung doch wahr-
lich nicht getan. Kainzbauer sieht in dem
Dresdner Bilde überall nur Verbesserungen, ohne
sich in die Kunstart Holbeins vertieft zu haben
und ohne sehen zu können, dass vieles, was ihm
am Dresdner Bilde besser gefällt, gegen die ge-
waltige Kraft Holbeins als Schwächen bezeichnet
werden muss. — Zum Schlüsse sei noch auf den
Aufsatz über die Kainzbauer’sche Schläft von Paul
Schumann im Dresdner Anzeiger vom Freitag,
den 2. März 1906 aufmerksam gemacht.
Robert Bruck
31
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
Juni-Heft.
hätte doch in seiner Stellung wissen müssen, dass
heute das vergleichende Bilderstudium und damit
die Kennerschaft eine exakte Wissenschaft ist, die
ein sehr ernstes, langes Studium erfordert. Etwas,
das bei solchem Studium, neben vielem anderen,
vorausgesetzt werden muss, ist die gründliche
Kenntnis der einschlägigen Literatur. Man kann
Kainzbauer den Vorwurf nicht ersparen, dass er
darin nur mangelhaft Bescheid zu wissen scheint.
Bei der Prüfung der von ihm aufgerollten Präge
hätte ihm das Werk von Julius Lessing „Alt-
Orientalische Teppichmuster nach Bildern und Ori-
ginalen des XV.—XVI. Jahrhunderts“ (Wasmuth,
Berlin 1877) nicht entgehen dürfen. Lessing sagt
(S. 5) von den Teppichen auf den Gemälden der
Eyck, Memling und ihrer Schule, der Ghirlandajo,
Mantegna und Holbein sprechend: „Die zierliche
alle Einzelheiten erfassende Malweise dieser' Meister
hat auch die Teppiche und Tischdecken mit so
liebevoller Sorgfalt dargestellt, dass man auf man-
chen Bildern, besonders bei Holbein, die Stiche
zählen kann.“ S. 6: „Der Maler, welcher Holbeins
Madonna mit der Eamilie des Bürgermeisters
Meyer kopierte, hat die auf dem Darmstädter
Originalbild (Lessing, Taf. 9) stichweise erkenn-
baren eckigen Blattformen des orientalischen
Teppichs in geschwungene Blätter der Spät-
renaissance verwandelt.“ S. 16: „Die Kopie des-
selben Bildes in Dresden. Der Maler hat dem
Grundfeld, das ihm zu leer erschien, die Ecke
(Lessing, Taf. 9 A) zugefügt. Die Borte ist in
ganz missverständlicher Weise, wie dies bei Hol-
bein niemals vorkommt, in europäische Voluten
übersetzt, einer der Beweise mehr für die Unecht-
heit des Bildes.“ Gerade an solchen missverstan-
denen Kleinigkeiten am Ornament und dergl. er-
kennt man in hunderten von Bällen die Kopieen
oder Fälschungen kunstgewerblicher Gegenstände.
Wer wie Kainzbauer ein» Entscheidung über Echt-
heit oder Kopie eines Bildes geben will, muss doch
unbedingt die sorgfältigsten Studien vor dem Bilde
bezw. den Bildern machen. Es scheint aber bei
der Art von Bilderbestimmung, wie sie uns Kainz-
bauer in seiner Broschüre vorlegt, als kenne er
weder das Dresdner, noch das Darmstädter Bild
durch Autopsie, sondern allein durch Photo-
graphien. Kainzbauer sagt zum Beginne der Ein-
leitung in seiner Broschüre, dass vor einigen
Jahren in einer Versammlung des kunsthistorischen
Vereins in Graz eine Besprechung darüber statt-
finden sollte, „welche von den beiden Madonnen
des Bürgermeisters Meyer, jene von Dresden oder
von Darmstadt, das Original sein sollte“ und fährt
dann fort: „Diese Frage interessierte mich sehr,
und ich verschaffte mir zwei möglichst gleiche
Reproduktionen, da mir die Originale nicht erreich-
bar waren. Beim ersten Blick auf die beiden
Bilder scheint kein Zweifel zu sein, dass das
Dresdner Bild das oder wenigstens ein Original
ist.“ Zuerst nahm ich an, dass Kainzbauer bei
seiner ersten oberflächlichen Untersuchung nur
vorläufig nach den Photographien geurteilt habe,
als ich aber dann die anderen Kapitel seiner
Broschüre las, insbesondere Kapitel 5 „Die Pen-
timenti“ und Kapitel 6 „Farbe und Firnis“, da
merkte ich zu meinem grössten Erstaunen, dass
Kainzbauer gar keine Kenntnis davon hatte, dass
man im Jahre 1887 den alten, trüb gewordenen
Firnis mit den alten Uebermalungen von dem
Darmstädter Bilde abgewaschen hat und es uns
heute wieder in seiner ganzen Farbenpracht ent-
gegenleuchet. So auch nur erklären sich die auf
ganz falschen Voraussetzungen begründeten Resul-
tate, die K. über das Verhältnis des Gemäldes zu
den Handzeichnungen Holbeins erhält. Im Schluss-
worte hält es K. (S. 27) für „unwahrscheinlich,
dass ein Stifterbild auf Tannenholz, aber sehr
wahrscheinlich, dass eher die Kopie auf diesem
Holze gemalt wurde.“ Jeder Kunsthistoriker aber
kennt die Tatsache, dass im Elsass, in Schwaben,
in der Schweiz, kurz in ganz Oberdeutschland, eine
grosse Zahl Altäre mit Stifterfiguren auf Linden-
oder Tannenholz gemalt sind, wie auch Holbeins
Altar in Darmstadt Tannenholz ist, dass man
Eichenholz in Niederdeutschland und in den
Niederlanden bevorzugte, ein Material, auf dem das
Dresdner Bild gemalt ist. Was Kainzbauer in
den Kapiteln 2, 3 und 4 schreibt, könnte man fast
satzweise widerlegen, denn man sieht deutlich
daraus, dass K. sich nicht genügend über die Art
der Holbein’schen Kunst informiert hat. Mit dem
Aburteilen über die nach Kainzbauer „schlechte
Muschel am Darmstädter Bilde“ oder „wie elend
die Pilasterkapitäle auf dem Darmstädter Bild ge-
zeichnet sind“ u. s. w. u. s. w., ist es bei einer
fach- und sachgemässen Abhandlung doch wahr-
lich nicht getan. Kainzbauer sieht in dem
Dresdner Bilde überall nur Verbesserungen, ohne
sich in die Kunstart Holbeins vertieft zu haben
und ohne sehen zu können, dass vieles, was ihm
am Dresdner Bilde besser gefällt, gegen die ge-
waltige Kraft Holbeins als Schwächen bezeichnet
werden muss. — Zum Schlüsse sei noch auf den
Aufsatz über die Kainzbauer’sche Schläft von Paul
Schumann im Dresdner Anzeiger vom Freitag,
den 2. März 1906 aufmerksam gemacht.
Robert Bruck
31