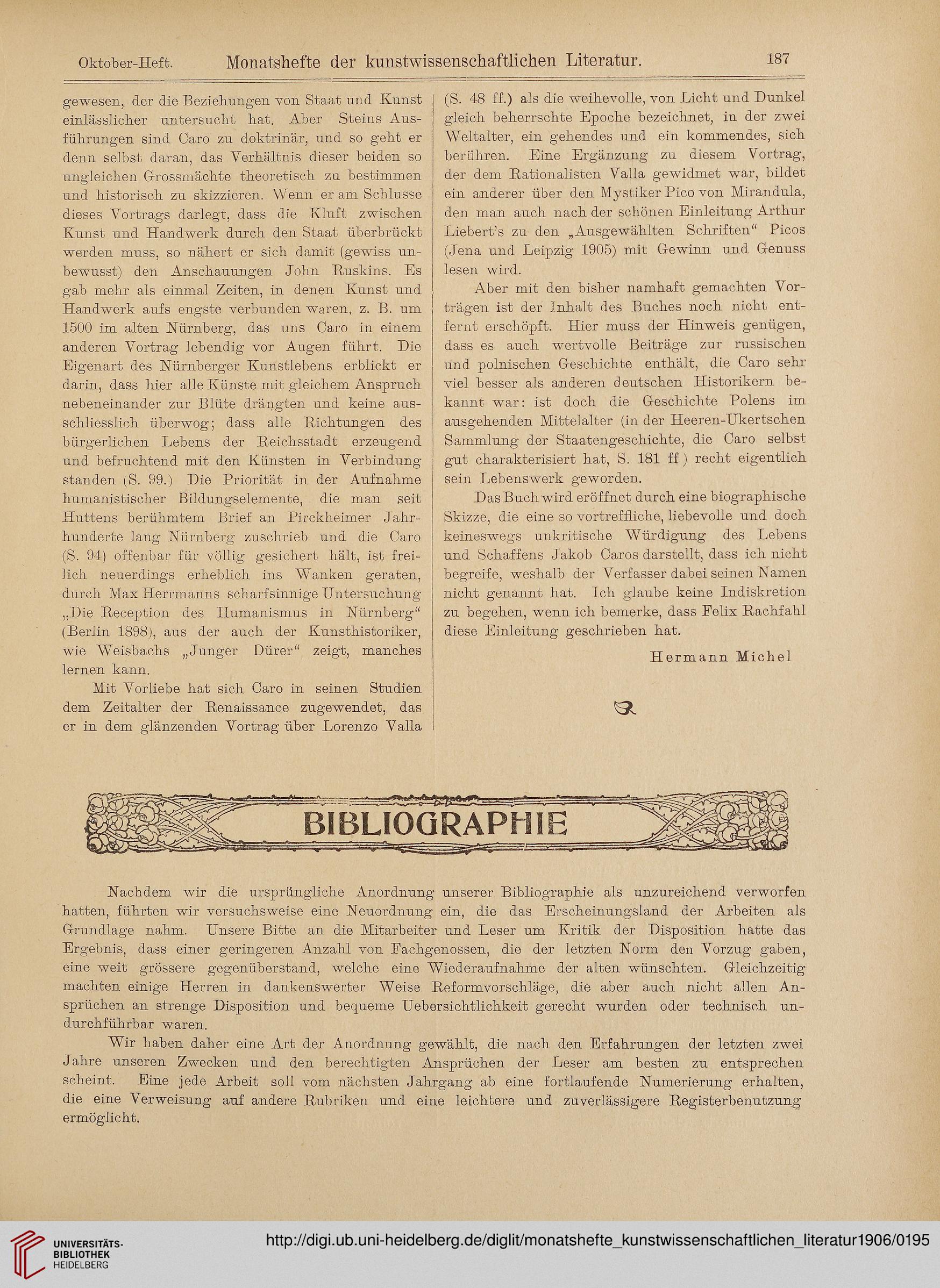Oktober-Heft.
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
187
gewesen, der die Beziehungen von Staat und Kunst
einlässlicher untersucht hat. Aber Steins Aus-
führungen sind Caro zu doktrinär, und so geht er
denn selbst daran, das Verhältnis dieser beiden so
ungleichen Grossmächte theoretisch zu bestimmen
und historisch zu skizzieren. Wenn er am Schlüsse
dieses Vortrags darlegt, dass die Kluft zwischen
Kunst und Handwerk durch den Staat überbrückt
werden muss, so nähert er sich damit (gewiss un-
bewusst) den Anschauungen John Ruskins. Es
gab mehr als einmal Zeiten, in denen Kunst und
Handwerk aufs engste verbunden waren, z. B. um
1500 im alten Nürnberg, das uns Caro in einem
anderen Vortrag lebendig vor Augen führt. Die
Eigenart des Nürnberger Kunstlebens erblickt er
darin, dass hier alle Künste mit gleichem Anspruch
nebeneinander zur Blüte drängten und keine aus-
schliesslich überwog; dass alle Richtungen des
bürgerlichen Lebens der Reichsstadt erzeugend
und befruchtend mit den Künsten in Verbindung
standen (S. 99.) Die Priorität in der Aufnahme
humanistischer Bildungselemente, die man seit
Huttens berühmtem Brief an Pirckheimer Jahr-
hunderte lang Nürnberg zuschrieb und die Caro
(S. 94) offenbar für völlig gesichert hält, ist frei-
lich neuerdings erheblich ins Wanken geraten,
durch Max Herrmanns scharfsinnige Untersuchung
„Die Reception des Humanismus in Nürnberg“
(Berlin 1898), aus der auch der Kunsthistoriker,
wie Weisbachs „Junger Dürer“ zeigt, manches
lernen kann.
Mit Vorliebe hat sich Caro in seinen Studien
dem Zeitalter der Renaissance zugewendet, das
er in dem glänzenden Vortrag über Lorenzo Valla
(S. 48 ff.) als die weihevolle, von Licht und Dunkel
gleich beherrschte Epoche bezeichnet, iu der zwei
Weltalter, ein gehendes und ein kommendes, sich
berühren. Eine Ergänzung zu diesem Vortrag,
der dem Rationalisten Valla gewidmet war, bildet
ein anderer über den Mystiker Pico von Mirandula,
den man auch nach der schönen Einleitung Arthur
Liebert’s zu den „Ausgewählten Schriften“ Picos
(Jena und Leipzig 1905) mit Gewinn und Genuss
lesen wird.
Aber mit den bisher namhaft gemachten Vor-
trägen ist der Inhalt des Buches noch nicht ent-
fernt erschöpft. Hier muss der Hinweis genügen,
dass es auch wertvolle Beiträge zur russischen
und polnischen Geschichte enthält, die Caro sehr-
viel besser als anderen deutschen Historikern be-
kannt war: ist doch die Geschichte Polens im
ausgehenden Mittelalter (in der Heeren-Ukertschen
Sammlung der Staatengeschichte, die Caro selbst
gut charakterisiert hat, S. 181 ff) recht eigentlich
sein Lebenswerk geworden.
Das Buch wird eröffnet durch eine biographische
Skizze, die eine so vortreffliche, liebevolle und doch
keineswegs unkritische Würdigung des Lebens
und Schaffens Jakob Caros darstellt, dass ich nicht
begreife, weshalb der Verfasser dabei seinen Namen
nicht genannt hat. Ich glaube keine Indiskretion
zu begehen, wenn ich bemerke, dass Felix Rachfahl
diese Einleitung geschrieben hat.
Hermann Michel
BIBLIOGRAPHIE
Nachdem wir die ursprüngliche Anordnung unserer Bibliographie als unzureichend verworfen
hatten, führten wir versuchsweise eine Neuordnung ein, die das Erscheinungsland der Arbeiten als
Grundlage nahm. Unsere Bitte an die Mitarbeiter und Leser um Kritik der Disposition hatte das
Ergebnis, dass einer geringeren Anzahl von Fachgenossen, die der letzten Norm den Vorzug gaben,
eine weit grössere gegenüberstand, welche eine Wiederaufnahme der alten wünschten. Gleichzeitig
machten einige Herren in dankenswerter Weise Reformvorschläge, die aber auch nicht allen An-
sprüchen an strenge Disposition und bequeme Uebersichtlichkeit gerecht wurden oder technisch un-
durchführbar waren.
Wir haben daher eine Art der Anordnung gewählt, die nach den Erfahrungen der letzten zwei
Jahre unseren Zwecken und den berechtigten Ansprüchen der Leser am besten zu entsprechen
scheint. Eine jede Arbeit soll vom nächsten Jahrgang ab eine fortlaufende Numerierung erhalten,
die eine Verweisung auf andere Rubriken und eine leichtere und zuverlässigere Registerbenutzung
ermöglicht.
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
187
gewesen, der die Beziehungen von Staat und Kunst
einlässlicher untersucht hat. Aber Steins Aus-
führungen sind Caro zu doktrinär, und so geht er
denn selbst daran, das Verhältnis dieser beiden so
ungleichen Grossmächte theoretisch zu bestimmen
und historisch zu skizzieren. Wenn er am Schlüsse
dieses Vortrags darlegt, dass die Kluft zwischen
Kunst und Handwerk durch den Staat überbrückt
werden muss, so nähert er sich damit (gewiss un-
bewusst) den Anschauungen John Ruskins. Es
gab mehr als einmal Zeiten, in denen Kunst und
Handwerk aufs engste verbunden waren, z. B. um
1500 im alten Nürnberg, das uns Caro in einem
anderen Vortrag lebendig vor Augen führt. Die
Eigenart des Nürnberger Kunstlebens erblickt er
darin, dass hier alle Künste mit gleichem Anspruch
nebeneinander zur Blüte drängten und keine aus-
schliesslich überwog; dass alle Richtungen des
bürgerlichen Lebens der Reichsstadt erzeugend
und befruchtend mit den Künsten in Verbindung
standen (S. 99.) Die Priorität in der Aufnahme
humanistischer Bildungselemente, die man seit
Huttens berühmtem Brief an Pirckheimer Jahr-
hunderte lang Nürnberg zuschrieb und die Caro
(S. 94) offenbar für völlig gesichert hält, ist frei-
lich neuerdings erheblich ins Wanken geraten,
durch Max Herrmanns scharfsinnige Untersuchung
„Die Reception des Humanismus in Nürnberg“
(Berlin 1898), aus der auch der Kunsthistoriker,
wie Weisbachs „Junger Dürer“ zeigt, manches
lernen kann.
Mit Vorliebe hat sich Caro in seinen Studien
dem Zeitalter der Renaissance zugewendet, das
er in dem glänzenden Vortrag über Lorenzo Valla
(S. 48 ff.) als die weihevolle, von Licht und Dunkel
gleich beherrschte Epoche bezeichnet, iu der zwei
Weltalter, ein gehendes und ein kommendes, sich
berühren. Eine Ergänzung zu diesem Vortrag,
der dem Rationalisten Valla gewidmet war, bildet
ein anderer über den Mystiker Pico von Mirandula,
den man auch nach der schönen Einleitung Arthur
Liebert’s zu den „Ausgewählten Schriften“ Picos
(Jena und Leipzig 1905) mit Gewinn und Genuss
lesen wird.
Aber mit den bisher namhaft gemachten Vor-
trägen ist der Inhalt des Buches noch nicht ent-
fernt erschöpft. Hier muss der Hinweis genügen,
dass es auch wertvolle Beiträge zur russischen
und polnischen Geschichte enthält, die Caro sehr-
viel besser als anderen deutschen Historikern be-
kannt war: ist doch die Geschichte Polens im
ausgehenden Mittelalter (in der Heeren-Ukertschen
Sammlung der Staatengeschichte, die Caro selbst
gut charakterisiert hat, S. 181 ff) recht eigentlich
sein Lebenswerk geworden.
Das Buch wird eröffnet durch eine biographische
Skizze, die eine so vortreffliche, liebevolle und doch
keineswegs unkritische Würdigung des Lebens
und Schaffens Jakob Caros darstellt, dass ich nicht
begreife, weshalb der Verfasser dabei seinen Namen
nicht genannt hat. Ich glaube keine Indiskretion
zu begehen, wenn ich bemerke, dass Felix Rachfahl
diese Einleitung geschrieben hat.
Hermann Michel
BIBLIOGRAPHIE
Nachdem wir die ursprüngliche Anordnung unserer Bibliographie als unzureichend verworfen
hatten, führten wir versuchsweise eine Neuordnung ein, die das Erscheinungsland der Arbeiten als
Grundlage nahm. Unsere Bitte an die Mitarbeiter und Leser um Kritik der Disposition hatte das
Ergebnis, dass einer geringeren Anzahl von Fachgenossen, die der letzten Norm den Vorzug gaben,
eine weit grössere gegenüberstand, welche eine Wiederaufnahme der alten wünschten. Gleichzeitig
machten einige Herren in dankenswerter Weise Reformvorschläge, die aber auch nicht allen An-
sprüchen an strenge Disposition und bequeme Uebersichtlichkeit gerecht wurden oder technisch un-
durchführbar waren.
Wir haben daher eine Art der Anordnung gewählt, die nach den Erfahrungen der letzten zwei
Jahre unseren Zwecken und den berechtigten Ansprüchen der Leser am besten zu entsprechen
scheint. Eine jede Arbeit soll vom nächsten Jahrgang ab eine fortlaufende Numerierung erhalten,
die eine Verweisung auf andere Rubriken und eine leichtere und zuverlässigere Registerbenutzung
ermöglicht.