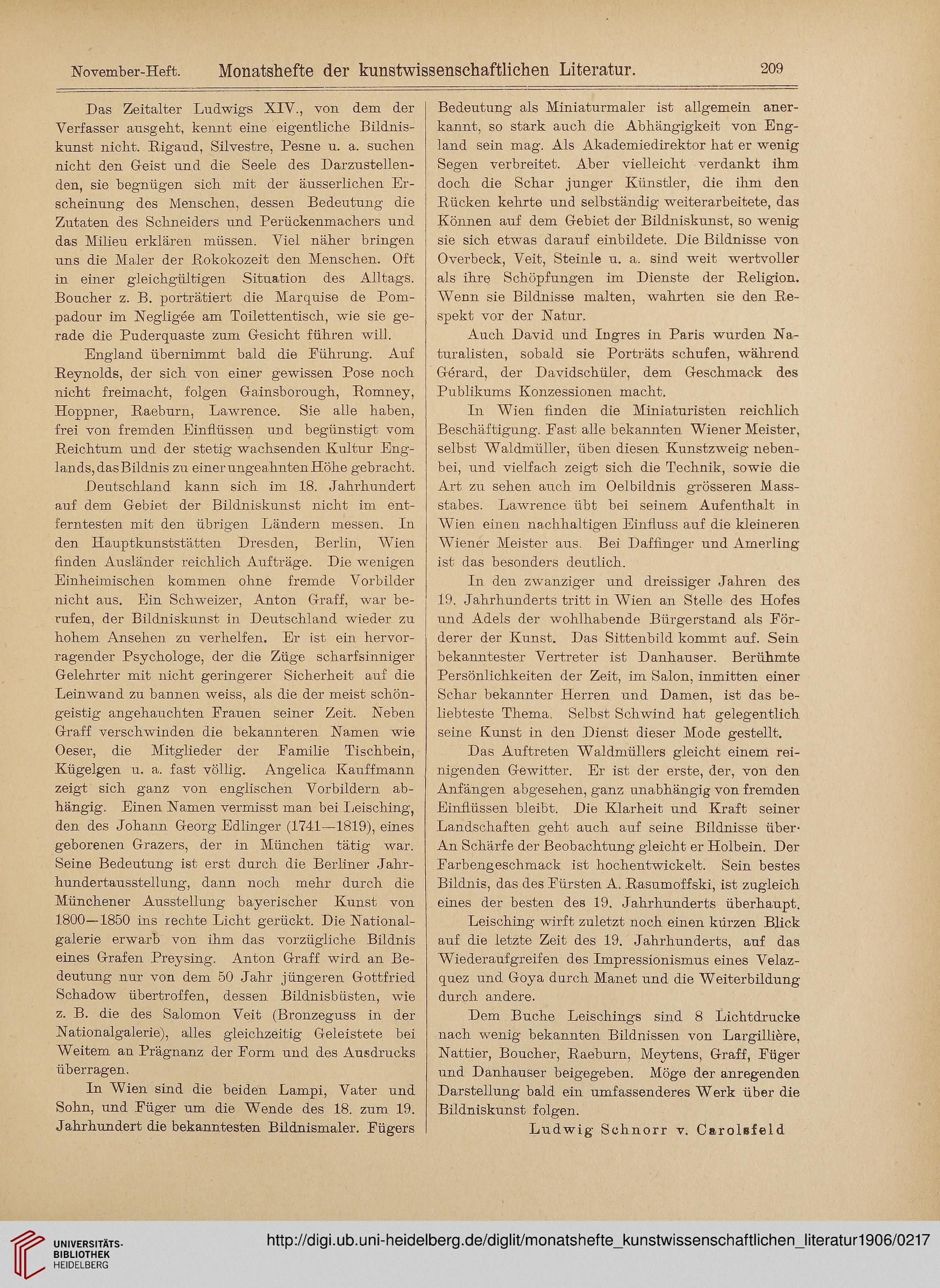November-Heft.
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
209
Das Zeitalter Ludwigs XIV., von dem der
Verfasser ausgeht, kennt eine eigentliche Bildnis-
kunst nicht. Rigaud, Silvestre, Pesne u. a. suchen
nicht den Geist und die Seele des Darzustellen-
den, sie begnügen sich mit der äusserlichen Er-
scheinung des Menschen, dessen Bedeutung die
Zutaten des Schneiders und Perückenmachers und
das Milieu erklären müssen. Viel näher bringen
uns die Maler der Rokokozeit den Menschen. Oft
in einer gleichgültigen Situation des Alltags.
Boucher z. B. porträtiert die Marquise de Pom-
padour im Negligee am Toilettentisch, wie sie ge-
rade die Puderquaste zum Gesicht führen will.
England übernimmt bald die Bührung. Auf
Reynolds, der sich von einer gewissen Pose noch
nicht freimacht, folgen Gainsborough, Romney,
Höppner, Raeburn, Lawrence. Sie alle haben,
frei von fremden Einflüssen und begünstigt vom
Reichtum und der stetig wachsenden Kultur Eng-
lands, das Bildnis zu einer ungeahnten Höhe gebracht.
Deutschland kann sich im 18. Jahrhundert
auf dem Gebiet der Bildniskunst nicht im ent-
ferntesten mit den übrigen Ländern messen. In
den Hauptkunststätten Dresden, Berlin, "Wien
finden Ausländer reichlich Aufträge. Die wenigen
Einheimischen kommen ohne fremde Vorbilder
nicht aus. Ein Schweizer, Anton Graff, war be-
rufen, der Bildniskunst in Deutschland wieder zu
hohem Ansehen zu verhelfen. Er ist ein hervor-
ragender Psychologe, der die Züge scharfsinniger
Gelehrter mit nicht geringerer Sicherheit auf die
Leinwand zu bannen weiss, als die der meist schön-
geistig angehauchten Brauen seiner Zeit. Neben
Graff verschwinden die bekannteren Namen wie
Oeser, die Mitglieder der Bamilie Tischbein,
Kügelgen u. a. fast völlig. Angelica Kauffmann
zeigt sich ganz von englischen Vorbildern ab-
hängig. Einen Namen vermisst man bei Leisching,
den des Johann Georg Edlinger (1741—1819), eines
geborenen Grazers, der in München tätig war.
Seine Bedeutung ist erst durch die Berliner Jahr-
hundertausstellung, dann noch mehr durch die
Münchener Ausstellung bayerischer Kunst von
1800—1850 ins rechte Licht gerückt. Die National-
galerie erwarb von ihm das vorzügliche Bildnis
eines Grafen Prey sing. Anton Graff wird an Be-
deutung nur von dem 50 Jahr jüngeren Gottfried
Schadow übertroffen, dessen Bildnisbüsten, wie
z. B. die des Salomon Veit (Bronzeguss in der
Nationalgalerie), alles gleichzeitig Geleistete bei
Weitem an Prägnanz der Borm und des Ausdrucks
überragen.
In Wien sind die beiden Lampi, Vater und
Sohn, und Büger um die Wende des 18. zum 19.
Jahrhundert die bekanntesten Bildnismaler. Bügers
Bedeutung als Miniaturmaler ist allgemein aner-
kannt, so stark auch die Abhängigkeit von Eng-
land sein mag. Als Akademiedirektor hat er wenig
Segen verbreitet. Aber vielleicht verdankt ihm
doch die Schar junger Künstler, die ihm den
Rücken kehrte und selbständig weiter arbeitete, das
Können auf dem Gebiet der Bildniskunst, so wenig
sie sich etwas darauf einbildete. Die Bildnisse von
Overbeck, Veit, Steinle u. a. sind weit wertvoller
als ihre Schöpfungen im Dienste der Religion.
Wenn sie Bildnisse malten, wahrten sie den Re-
spekt vor der Natur.
Auch David und Ingres in Paris wurden Na-
turalisten, sobald sie Porträts schufen, während
Gerard, der Davidschüler, dem Geschmack des
Publikums Konzessionen macht.
In Wien finden die Miniaturisten reichlich
Beschäftigung. Bast alle bekannten Wiener Meister,
selbst Waldmüller, üben diesen Kunstzweig neben-
bei, und vielfach zeigt sich die Technik, sowie die
Art zu sehen auch im Oelbildnis grösseren Mass-
stabes. Lawrence übt bei seinem Aufenthalt in
Wien einen nachhaltigen Einfluss auf die kleineren
Wiener Meister aus. Bei Daffinger und Amerling
ist das besonders deutlich.
In den zwanziger und dreissiger’ Jahren des
19. Jahrhunderts tritt in Wien an Stelle des Hofes
und Adels der wohlhabende Bürgerstand als Bör-
derer der Kunst. Das Sittenbild kommt auf. Sein
bekanntester Vertreter ist Danhauser. Berühmte
Persönlichkeiten der Zeit, im Salon, inmitten einer
Schar bekannter Herren und Damen, ist das be-
liebteste Thema. Selbst Schwind hat gelegentlich
seine Kunst in den Dienst dieser Mode gestellt.
Das Auftreten Waldmüllers gleicht einem rei-
nigenden Gewitter. Er ist der erste, der, von den
Anfängen abgesehen, ganz unabhängig von fremden
Einflüssen bleibt. Die Klarheit und Kraft seiner
Landschaften geht auch auf seine Bildnisse über-
An Schärfe der Beobachtung gleicht er Holbein. Der
Barbengeschmack ist hochentwickelt. Sein bestes
Bildnis, das des Bürsten A. Rasumoffski, ist zugleich
eines der besten des 19. Jahrhunderts überhaupt.
Leisching wirft zuletzt noch einen kürzen Blick
auf die letzte Zeit des 19. Jahrhunderts, auf das
Wiederaufgreifen des Impressionismus eines Velaz-
quez und Goya durch Manet und die Weiterbildung
durch andere.
Dem Buche Leischings sind 8 Lichtdrucke
nach wenig bekannten Bildnissen von Largilliere,
Nattier, Boucher, Raeburn, Meytens, Graff, Büger
und Danhauser beigegeben. Möge der anregenden
Darstellung bald ein umfassenderes Werk über die
Bildniskunst folgen.
Ludwig Schnorr v. Carolefeld
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
209
Das Zeitalter Ludwigs XIV., von dem der
Verfasser ausgeht, kennt eine eigentliche Bildnis-
kunst nicht. Rigaud, Silvestre, Pesne u. a. suchen
nicht den Geist und die Seele des Darzustellen-
den, sie begnügen sich mit der äusserlichen Er-
scheinung des Menschen, dessen Bedeutung die
Zutaten des Schneiders und Perückenmachers und
das Milieu erklären müssen. Viel näher bringen
uns die Maler der Rokokozeit den Menschen. Oft
in einer gleichgültigen Situation des Alltags.
Boucher z. B. porträtiert die Marquise de Pom-
padour im Negligee am Toilettentisch, wie sie ge-
rade die Puderquaste zum Gesicht führen will.
England übernimmt bald die Bührung. Auf
Reynolds, der sich von einer gewissen Pose noch
nicht freimacht, folgen Gainsborough, Romney,
Höppner, Raeburn, Lawrence. Sie alle haben,
frei von fremden Einflüssen und begünstigt vom
Reichtum und der stetig wachsenden Kultur Eng-
lands, das Bildnis zu einer ungeahnten Höhe gebracht.
Deutschland kann sich im 18. Jahrhundert
auf dem Gebiet der Bildniskunst nicht im ent-
ferntesten mit den übrigen Ländern messen. In
den Hauptkunststätten Dresden, Berlin, "Wien
finden Ausländer reichlich Aufträge. Die wenigen
Einheimischen kommen ohne fremde Vorbilder
nicht aus. Ein Schweizer, Anton Graff, war be-
rufen, der Bildniskunst in Deutschland wieder zu
hohem Ansehen zu verhelfen. Er ist ein hervor-
ragender Psychologe, der die Züge scharfsinniger
Gelehrter mit nicht geringerer Sicherheit auf die
Leinwand zu bannen weiss, als die der meist schön-
geistig angehauchten Brauen seiner Zeit. Neben
Graff verschwinden die bekannteren Namen wie
Oeser, die Mitglieder der Bamilie Tischbein,
Kügelgen u. a. fast völlig. Angelica Kauffmann
zeigt sich ganz von englischen Vorbildern ab-
hängig. Einen Namen vermisst man bei Leisching,
den des Johann Georg Edlinger (1741—1819), eines
geborenen Grazers, der in München tätig war.
Seine Bedeutung ist erst durch die Berliner Jahr-
hundertausstellung, dann noch mehr durch die
Münchener Ausstellung bayerischer Kunst von
1800—1850 ins rechte Licht gerückt. Die National-
galerie erwarb von ihm das vorzügliche Bildnis
eines Grafen Prey sing. Anton Graff wird an Be-
deutung nur von dem 50 Jahr jüngeren Gottfried
Schadow übertroffen, dessen Bildnisbüsten, wie
z. B. die des Salomon Veit (Bronzeguss in der
Nationalgalerie), alles gleichzeitig Geleistete bei
Weitem an Prägnanz der Borm und des Ausdrucks
überragen.
In Wien sind die beiden Lampi, Vater und
Sohn, und Büger um die Wende des 18. zum 19.
Jahrhundert die bekanntesten Bildnismaler. Bügers
Bedeutung als Miniaturmaler ist allgemein aner-
kannt, so stark auch die Abhängigkeit von Eng-
land sein mag. Als Akademiedirektor hat er wenig
Segen verbreitet. Aber vielleicht verdankt ihm
doch die Schar junger Künstler, die ihm den
Rücken kehrte und selbständig weiter arbeitete, das
Können auf dem Gebiet der Bildniskunst, so wenig
sie sich etwas darauf einbildete. Die Bildnisse von
Overbeck, Veit, Steinle u. a. sind weit wertvoller
als ihre Schöpfungen im Dienste der Religion.
Wenn sie Bildnisse malten, wahrten sie den Re-
spekt vor der Natur.
Auch David und Ingres in Paris wurden Na-
turalisten, sobald sie Porträts schufen, während
Gerard, der Davidschüler, dem Geschmack des
Publikums Konzessionen macht.
In Wien finden die Miniaturisten reichlich
Beschäftigung. Bast alle bekannten Wiener Meister,
selbst Waldmüller, üben diesen Kunstzweig neben-
bei, und vielfach zeigt sich die Technik, sowie die
Art zu sehen auch im Oelbildnis grösseren Mass-
stabes. Lawrence übt bei seinem Aufenthalt in
Wien einen nachhaltigen Einfluss auf die kleineren
Wiener Meister aus. Bei Daffinger und Amerling
ist das besonders deutlich.
In den zwanziger und dreissiger’ Jahren des
19. Jahrhunderts tritt in Wien an Stelle des Hofes
und Adels der wohlhabende Bürgerstand als Bör-
derer der Kunst. Das Sittenbild kommt auf. Sein
bekanntester Vertreter ist Danhauser. Berühmte
Persönlichkeiten der Zeit, im Salon, inmitten einer
Schar bekannter Herren und Damen, ist das be-
liebteste Thema. Selbst Schwind hat gelegentlich
seine Kunst in den Dienst dieser Mode gestellt.
Das Auftreten Waldmüllers gleicht einem rei-
nigenden Gewitter. Er ist der erste, der, von den
Anfängen abgesehen, ganz unabhängig von fremden
Einflüssen bleibt. Die Klarheit und Kraft seiner
Landschaften geht auch auf seine Bildnisse über-
An Schärfe der Beobachtung gleicht er Holbein. Der
Barbengeschmack ist hochentwickelt. Sein bestes
Bildnis, das des Bürsten A. Rasumoffski, ist zugleich
eines der besten des 19. Jahrhunderts überhaupt.
Leisching wirft zuletzt noch einen kürzen Blick
auf die letzte Zeit des 19. Jahrhunderts, auf das
Wiederaufgreifen des Impressionismus eines Velaz-
quez und Goya durch Manet und die Weiterbildung
durch andere.
Dem Buche Leischings sind 8 Lichtdrucke
nach wenig bekannten Bildnissen von Largilliere,
Nattier, Boucher, Raeburn, Meytens, Graff, Büger
und Danhauser beigegeben. Möge der anregenden
Darstellung bald ein umfassenderes Werk über die
Bildniskunst folgen.
Ludwig Schnorr v. Carolefeld