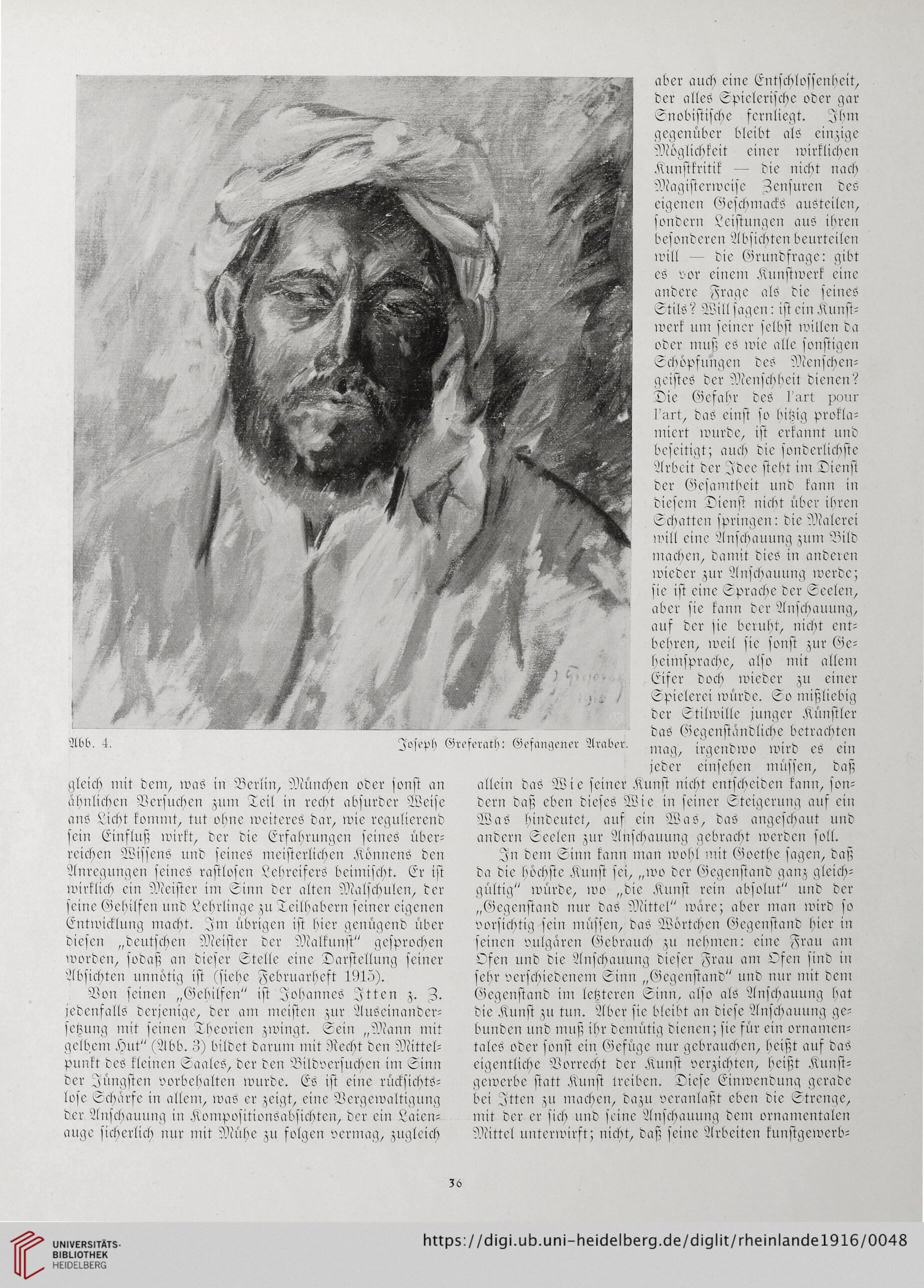Abb. 4. Greferath: Gefangener Araber.
aber auch eine Entschlossenheit,
der alles Spielerische oder gar
Snobistische fcrnliegt. Ihm
gegenüber bleibt als einzige
Möglichkeit einer wirklichen
Kunstkritik — die nicht nach
Magisterweise Zensuren des
eigenen Geschmacks austeilen,
sondern Leistungen aus ihren
besonderen Absichten beurteilen
will — die Grundfrage: gibt
es vor einem Kunstwerk eine
andere Frage als die seines
Stils? Will sagen: ist ein Kunst-
werk um seiner selbst nullen da
oder muß es wie alle sonstigen
Schöpfungen des Menschen-
geistes der Menschheit dienen?
Die Gefabr des l'urt pour
l'urt, das einst so bitzig prokla-
miert wurde, ist erkannt und
beseitigt; auch die sonderlichste
Arbeit der Idee steht im Dienst
der Gesamtbeit und kann in
diesem Dienst nicht über ihren
Schatten springen: die Malerei
null eine Anschauung zum Bild
machen, damit dies in anderen
wieder zur Anschauung werde;
sie ist eine Sprache der Seelen,
aber sie kann der Anschauung,
auf der sie beruht, nicht ent-
behren, weil sie sonst zur Ge-
heimsprache, also mit allem
Eifer doch wieder zu einer
Spielerei würde. So mißliebig
der Stilwille junger Künstler
das Gegenständliche betrachten
mag, irgendwo wird es ein
jeder einsehen müssen, daß
gleich mit dem, was in Berlin, München oder sonst an
ähnlichen Versuchen zum Teil in recht absurder Weise
ans Licht kommt, tut ohne weiteres dar, wie regulierend
sein Einfluß wirkt, der die Erfahrungen seines über-
reichen Wissens und seines meisterlichen Könnens den
Anregungen seines rastlosen Lehreifers beimischt. Er ist
wirklich ein Meister im Sinn der alten Malschulen, der
seine Gehilfen und Lehrlinge zu Teilhabern seiner eigenen
Entwicklung macht. Im übrigen ist hier genügend über
diesen „deutschen Meister der Malkunst" gesprochen
worden, sodaß an dieser Stelle eine Darstellung seiner
Absichten unnötig ist (siehe Februarheft 1915).
Von seinen „Gebilfen" ist Johannes Jtten z. Z.
jedenfalls derjenige, der am meisten zur Auseinander-
setzung mit seinen Theorien zwingt. Sein „Mann mit
gelbem Hut" (Abb. 3) bildet darum mit Recht den Mittel-
punkt des kleinen Saales, der den Bildversuchen im Sinn
der Jüngsten vorbebalten wurde. Es ist eine rücksichts-
lose Scharfe in allem, was er zeigt, eine Vergewaltigung
der Anschauung in Koncpositionsnbsichtcn, der ein Laien-
auge sicherlich nur niit Mühe zu folgen vermag, zugleich
allein das Wie seiner Kunst nicht entscheiden kann, son-
dern daß eben dieses Wie in seiner Steigerung auf ein
Was hindeutet, auf ein Was, das angeschaut und
andern Seelen zur Anschauung gebracht werden soll.
In dem Sinn kann man wohl mit Goethe sagen, daß
da die höchste Kunst sei, „wo der Gegenstand ganz gleich-
gültig" würde, wo „die Kunst rein absolut" und der
„Gegenstand nur das Mittel" wäre; aber man wird so
vorsichtig sein müssen, das Wörtchen Gegenstand hier in
seinen vulgären Gebrauch zu nehmen: eine Frau am
Ofen und die Anschauung dieser Frau am Ofen sind in
sehr verschiedenem Sinn „Gegenstand" und nur mit den:
Gegenstand im letzteren Sinn, also als Anschauung hat
die Kunst zu tun. Aber sie bleibt an diese Anschauung ge-
bunden und muß ihr demütig dienen; sie für ein ornamen-
tales oder sonst ein Gefüge nur gebrauchen, heißt auf das
eigentliche Vorrecht der Kunst verzichten, heißt Kunst-
gewerbe statt Kunst treiben. Diese Einwendung gerade
bei Jtten zu machen, dazu veranlaßt eben die Strenge,
mit der er sich und seine Anschauung dem ornamentalen
Mittel unterwirft; nicht, daß seine Arbeiten kunstgewerb-
Zö
aber auch eine Entschlossenheit,
der alles Spielerische oder gar
Snobistische fcrnliegt. Ihm
gegenüber bleibt als einzige
Möglichkeit einer wirklichen
Kunstkritik — die nicht nach
Magisterweise Zensuren des
eigenen Geschmacks austeilen,
sondern Leistungen aus ihren
besonderen Absichten beurteilen
will — die Grundfrage: gibt
es vor einem Kunstwerk eine
andere Frage als die seines
Stils? Will sagen: ist ein Kunst-
werk um seiner selbst nullen da
oder muß es wie alle sonstigen
Schöpfungen des Menschen-
geistes der Menschheit dienen?
Die Gefabr des l'urt pour
l'urt, das einst so bitzig prokla-
miert wurde, ist erkannt und
beseitigt; auch die sonderlichste
Arbeit der Idee steht im Dienst
der Gesamtbeit und kann in
diesem Dienst nicht über ihren
Schatten springen: die Malerei
null eine Anschauung zum Bild
machen, damit dies in anderen
wieder zur Anschauung werde;
sie ist eine Sprache der Seelen,
aber sie kann der Anschauung,
auf der sie beruht, nicht ent-
behren, weil sie sonst zur Ge-
heimsprache, also mit allem
Eifer doch wieder zu einer
Spielerei würde. So mißliebig
der Stilwille junger Künstler
das Gegenständliche betrachten
mag, irgendwo wird es ein
jeder einsehen müssen, daß
gleich mit dem, was in Berlin, München oder sonst an
ähnlichen Versuchen zum Teil in recht absurder Weise
ans Licht kommt, tut ohne weiteres dar, wie regulierend
sein Einfluß wirkt, der die Erfahrungen seines über-
reichen Wissens und seines meisterlichen Könnens den
Anregungen seines rastlosen Lehreifers beimischt. Er ist
wirklich ein Meister im Sinn der alten Malschulen, der
seine Gehilfen und Lehrlinge zu Teilhabern seiner eigenen
Entwicklung macht. Im übrigen ist hier genügend über
diesen „deutschen Meister der Malkunst" gesprochen
worden, sodaß an dieser Stelle eine Darstellung seiner
Absichten unnötig ist (siehe Februarheft 1915).
Von seinen „Gebilfen" ist Johannes Jtten z. Z.
jedenfalls derjenige, der am meisten zur Auseinander-
setzung mit seinen Theorien zwingt. Sein „Mann mit
gelbem Hut" (Abb. 3) bildet darum mit Recht den Mittel-
punkt des kleinen Saales, der den Bildversuchen im Sinn
der Jüngsten vorbebalten wurde. Es ist eine rücksichts-
lose Scharfe in allem, was er zeigt, eine Vergewaltigung
der Anschauung in Koncpositionsnbsichtcn, der ein Laien-
auge sicherlich nur niit Mühe zu folgen vermag, zugleich
allein das Wie seiner Kunst nicht entscheiden kann, son-
dern daß eben dieses Wie in seiner Steigerung auf ein
Was hindeutet, auf ein Was, das angeschaut und
andern Seelen zur Anschauung gebracht werden soll.
In dem Sinn kann man wohl mit Goethe sagen, daß
da die höchste Kunst sei, „wo der Gegenstand ganz gleich-
gültig" würde, wo „die Kunst rein absolut" und der
„Gegenstand nur das Mittel" wäre; aber man wird so
vorsichtig sein müssen, das Wörtchen Gegenstand hier in
seinen vulgären Gebrauch zu nehmen: eine Frau am
Ofen und die Anschauung dieser Frau am Ofen sind in
sehr verschiedenem Sinn „Gegenstand" und nur mit den:
Gegenstand im letzteren Sinn, also als Anschauung hat
die Kunst zu tun. Aber sie bleibt an diese Anschauung ge-
bunden und muß ihr demütig dienen; sie für ein ornamen-
tales oder sonst ein Gefüge nur gebrauchen, heißt auf das
eigentliche Vorrecht der Kunst verzichten, heißt Kunst-
gewerbe statt Kunst treiben. Diese Einwendung gerade
bei Jtten zu machen, dazu veranlaßt eben die Strenge,
mit der er sich und seine Anschauung dem ornamentalen
Mittel unterwirft; nicht, daß seine Arbeiten kunstgewerb-
Zö