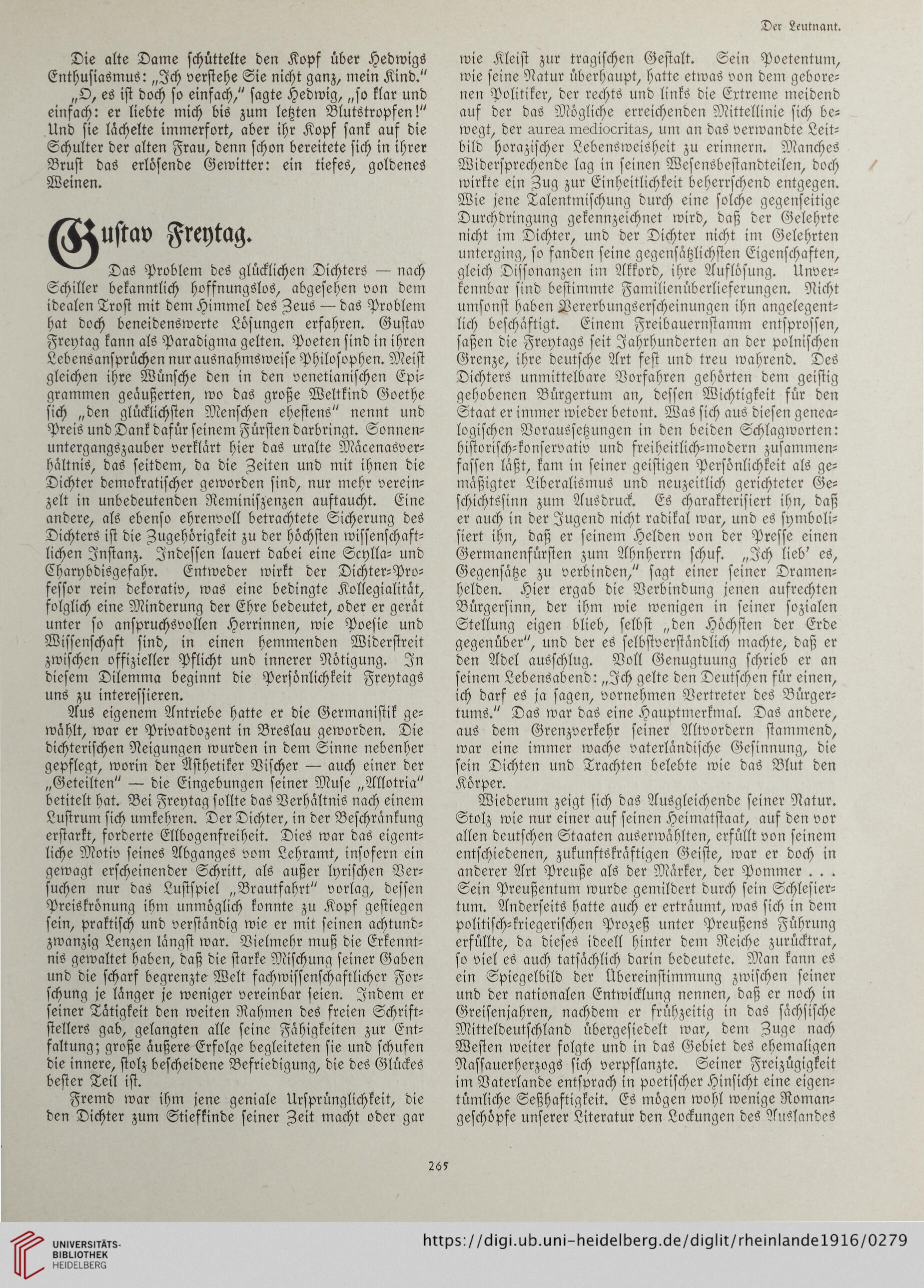Der Leutnant.
Die alte Dame schüttelte den Kopf über Hedwigs
Enthusiasmus: „Ich verstehe Sie nicht ganz, mein Kind."
„O, es ist doch so einfach," sagte Hedwig, „so klar und
einfach: er liebte mich bis zum letzten Blutstropfen!"
Und sie lächelte immerfort, aber ihr Kopf sank auf die
Schulter der alten Frau, denn schon bereitete sich in ihrer
Brust das erlösende Gewitter: ein tiefes, goldenes
Weinen.
ustav Freytag.
Das Problem des glücklichen Dichters — nach
Schiller bekanntlich hoffnungslos, abgesehen von dem
idealen Trost mit dem Himmel des Zeus — das Problem
hat doch beneidenswerte Lösungen erfahren. Gustav
Freytag kann als Paradigma gelten. Poeten sind in ihren
Lebensansprüchen nur ausnahmsweise Philosophen. Meist
gleichen ihre Wünsche den in den venetianischen Epi-
grammen geäußerten, wo das große Weltkind Goethe
sich „den glücklichsten Menschen ehestens" nennt und
Preis und Dank dafür seinem Fürsten darbringt. Sonnen-
untergangszauber verklärt hier das uralte Mäcenasver-
hältnis, das seitdem, da die Zeiten und mit ihnen die
Dichter demokratischer geworden sind, nur mehr verein-
zelt in unbedeutenden Reminiszenzen auftaucht. Eine
andere, als ebenso ehrenvoll betrachtete Sicherung des
Dichters ist die Zugehörigkeit zu der höchsten wissenschaft-
lichen Instanz. Indessen lauert dabei eine Scylla- und
Charybdisgefahr. Entweder wirkt der Dichter-Pro-
fessor rein dekorativ, was eine bedingte Kollegialität,
folglich eine Minderung der Ehre bedeutet, oder er gerät
unter so anspruchsvollen Herrinnen, wie Poesie und
Wissenschaft sind, in einen hemmenden Widerstreit
zwischen offizieller Pflicht und innerer Nötigung. In
diesem Dilemma beginnt die Persönlichkeit Freytags
uns zu interessieren.
Aus eigenem Antriebe hatte er die Germanistik ge-
wählt, war er Privatdozent in Breslau geworden. Die
dichterischen Neigungen wurden in dem Sinne nebenher
gepflegt, worin der Ästhetiker Vischer — auch einer der
„Geteilten" — die Eingebungen seiner Muse „Allotria"
betitelt hat. Bei Freytag sollte das Verhältnis nach einem
Lustrum sich umkehren. Der Dichter, in der Beschränkung
erstarkt, forderte Ellbogenfreiheit. Dies war das eigent-
liche Motiv seines Abganges vom Lehramt, insofern ein
gewagt erscheinender Schritt, als außer lyrischen Ver-
suchen nur das Lustspiel „Brautfahrt" vorlag, dessen
Preiskrönung ihm unmöglich konnte zu Kopf gestiegen
sein, praktisch und verständig wie er mit seinen achtund-
zwanzig Lenzen längst war. Vielmehr muß die Erkennt-
nis gewaltet haben, daß die starke Mischung seiner Gaben
und die scharf begrenzte Welt fachwissenschaftlicher For-
schung je länger je weniger vereinbar seien. Indem er
seiner Tätigkeit den weiten Rahmen des freien Schrift-
stellers gab, gelangten alle seine Fähigkeiten zur Ent-
faltung; große äußere Erfolge begleiteten sie und schufen
die innere, stolz bescheidene Befriedigung, die des Glückes
bester Teil ist.
Fremd war ihm jene geniale Ursprünglichkeit, die
den Dichter zum Stiefkinds seiner Zeit macht oder gar
wie Kleist zur tragischen Gestalt. Sein Poetentum,
wie seine Natur überhaupt, hatte etwas von dem gebore-
nen Politiker, der rechts und links die Extreme meidend
auf der das Mögliche erreichenden Mittellinie sich be-
wegt, der Lursu mscliocritaZ, um an das verwandte Leit-
bild horazischer Lebensweisheit zu erinnern. Manches
Widersprechende lag in seinen Wesensbestandteilen, doch
wirkte ein Zug zur Einheitlichkeit beherrschend entgegen.
Wie jene Talentmischung durch eine solche gegenseitige
Durchdringung gekennzeichnet wird, daß der Gelehrte
nicht im Dichter, und der Dichter nicht im Gelehrten
unterging, so fanden seine gegensätzlichsten Eigenschaften,
gleich Dissonanzen im Akkord, ihre Auflösung. Unver-
kennbar sind bestimmte Familienüberlieferungen. Nicht
umsonst haben Vererbungserscheinungen ihn angelegent-
lich beschäftigt. Einem Freibauernstamm entsprossen,
saßen die Freytags seit Jahrhunderten an der polnischen
Grenze, ihre deutsche Art fest und treu wahrend. Des
Dichters unmittelbare Vorfahren gehörten dem geistig
gehobenen Bürgertum an, dessen Wichtigkeit für den
Staat er immer wieder betont. Was sich aus diesen genea-
logischen Voraussetzungen in den beiden Schlagworten:
historisch-konservativ und freiheitlich-modern zusammen-
fassen läßt, kam in seiner geistigen Persönlichkeit als ge-
mäßigter Liberalismus und neuzeitlich gerichteter Ge-
schichtssinn zum Ausdruck. Es charakterisiert ihn, daß
er auch in der Jugend nicht radikal war, und es symboli-
siert ihn, daß er seinem Helden von der Presse einen
Germanenfürsten zum Ahnherrn schuf. „Ich lieb' es,
Gegensätze zu verbinden," sagt einer seiner Dramen-
helden. Hier ergab die Verbindung jenen aufrechten
Bürgersinn, der ihm wie wenigen in seiner sozialen
Stellung eigen blieb, selbst „den Höchsten der Erde
gegenüber", und der es selbstverständlich machte, daß er
den Adel ausschlug. Voll Genugtuung schrieb er an
seinem Lebensabend: „Ich gelte den Deutschen für einen,
ich darf es ja sagen, vornehmen Vertreter des Bürger-
tums." Das war das eine Hauptmerkmal. Das andere,
aus dem Grenzverkehr seiner Altvordern stammend,
war eine immer wache vaterländische Gesinnung, die
sein Dichten und Trachten belebte wie das Blut den
Körper.
Wiederum zeigt sich das Ausgleichende seiner Natur.
Stolz wie nur einer auf seinen Heimatstaat, auf den vor
allen deutschen Staaten auserwählten, erfüllt von seinem
entschiedenen, zukunftskräftigen Geiste, war er doch in
anderer Art Preuße als der Märker, der Pommer . . .
Sein Preußentum wurde gemildert durch sein Schlesier-
tum. Anderseits hatte auch er erträumt, was sich in dem
politisch-kriegerischen Prozeß unter Preußens Führung
erfüllte, da dieses ideell hinter dem Reiche zurücktrat,
so viel es auch tatsächlich darin bedeutete. Man kann es
ein Spiegelbild der Übereinstimmung zwischen seiner
und der nationalen Entwicklung nennen, daß er noch in
Greisenjahren, nachdem er frühzeitig in das sächsische
Mitteldeutschland übergesiedelt war, dem Zuge nach
Westen weiter folgte und in das Gebiet des ehemaligen
Nassauerherzogs sich verpflanzte. Seiner Freizügigkeit
im Vaterlande entsprach in poetischer Hinsicht eine eigen-
tümliche Seßhaftigkeit. Es mögen wohl wenige Roman-
geschöpfe unserer Literatur den Lockungen des Auslandes
265
Die alte Dame schüttelte den Kopf über Hedwigs
Enthusiasmus: „Ich verstehe Sie nicht ganz, mein Kind."
„O, es ist doch so einfach," sagte Hedwig, „so klar und
einfach: er liebte mich bis zum letzten Blutstropfen!"
Und sie lächelte immerfort, aber ihr Kopf sank auf die
Schulter der alten Frau, denn schon bereitete sich in ihrer
Brust das erlösende Gewitter: ein tiefes, goldenes
Weinen.
ustav Freytag.
Das Problem des glücklichen Dichters — nach
Schiller bekanntlich hoffnungslos, abgesehen von dem
idealen Trost mit dem Himmel des Zeus — das Problem
hat doch beneidenswerte Lösungen erfahren. Gustav
Freytag kann als Paradigma gelten. Poeten sind in ihren
Lebensansprüchen nur ausnahmsweise Philosophen. Meist
gleichen ihre Wünsche den in den venetianischen Epi-
grammen geäußerten, wo das große Weltkind Goethe
sich „den glücklichsten Menschen ehestens" nennt und
Preis und Dank dafür seinem Fürsten darbringt. Sonnen-
untergangszauber verklärt hier das uralte Mäcenasver-
hältnis, das seitdem, da die Zeiten und mit ihnen die
Dichter demokratischer geworden sind, nur mehr verein-
zelt in unbedeutenden Reminiszenzen auftaucht. Eine
andere, als ebenso ehrenvoll betrachtete Sicherung des
Dichters ist die Zugehörigkeit zu der höchsten wissenschaft-
lichen Instanz. Indessen lauert dabei eine Scylla- und
Charybdisgefahr. Entweder wirkt der Dichter-Pro-
fessor rein dekorativ, was eine bedingte Kollegialität,
folglich eine Minderung der Ehre bedeutet, oder er gerät
unter so anspruchsvollen Herrinnen, wie Poesie und
Wissenschaft sind, in einen hemmenden Widerstreit
zwischen offizieller Pflicht und innerer Nötigung. In
diesem Dilemma beginnt die Persönlichkeit Freytags
uns zu interessieren.
Aus eigenem Antriebe hatte er die Germanistik ge-
wählt, war er Privatdozent in Breslau geworden. Die
dichterischen Neigungen wurden in dem Sinne nebenher
gepflegt, worin der Ästhetiker Vischer — auch einer der
„Geteilten" — die Eingebungen seiner Muse „Allotria"
betitelt hat. Bei Freytag sollte das Verhältnis nach einem
Lustrum sich umkehren. Der Dichter, in der Beschränkung
erstarkt, forderte Ellbogenfreiheit. Dies war das eigent-
liche Motiv seines Abganges vom Lehramt, insofern ein
gewagt erscheinender Schritt, als außer lyrischen Ver-
suchen nur das Lustspiel „Brautfahrt" vorlag, dessen
Preiskrönung ihm unmöglich konnte zu Kopf gestiegen
sein, praktisch und verständig wie er mit seinen achtund-
zwanzig Lenzen längst war. Vielmehr muß die Erkennt-
nis gewaltet haben, daß die starke Mischung seiner Gaben
und die scharf begrenzte Welt fachwissenschaftlicher For-
schung je länger je weniger vereinbar seien. Indem er
seiner Tätigkeit den weiten Rahmen des freien Schrift-
stellers gab, gelangten alle seine Fähigkeiten zur Ent-
faltung; große äußere Erfolge begleiteten sie und schufen
die innere, stolz bescheidene Befriedigung, die des Glückes
bester Teil ist.
Fremd war ihm jene geniale Ursprünglichkeit, die
den Dichter zum Stiefkinds seiner Zeit macht oder gar
wie Kleist zur tragischen Gestalt. Sein Poetentum,
wie seine Natur überhaupt, hatte etwas von dem gebore-
nen Politiker, der rechts und links die Extreme meidend
auf der das Mögliche erreichenden Mittellinie sich be-
wegt, der Lursu mscliocritaZ, um an das verwandte Leit-
bild horazischer Lebensweisheit zu erinnern. Manches
Widersprechende lag in seinen Wesensbestandteilen, doch
wirkte ein Zug zur Einheitlichkeit beherrschend entgegen.
Wie jene Talentmischung durch eine solche gegenseitige
Durchdringung gekennzeichnet wird, daß der Gelehrte
nicht im Dichter, und der Dichter nicht im Gelehrten
unterging, so fanden seine gegensätzlichsten Eigenschaften,
gleich Dissonanzen im Akkord, ihre Auflösung. Unver-
kennbar sind bestimmte Familienüberlieferungen. Nicht
umsonst haben Vererbungserscheinungen ihn angelegent-
lich beschäftigt. Einem Freibauernstamm entsprossen,
saßen die Freytags seit Jahrhunderten an der polnischen
Grenze, ihre deutsche Art fest und treu wahrend. Des
Dichters unmittelbare Vorfahren gehörten dem geistig
gehobenen Bürgertum an, dessen Wichtigkeit für den
Staat er immer wieder betont. Was sich aus diesen genea-
logischen Voraussetzungen in den beiden Schlagworten:
historisch-konservativ und freiheitlich-modern zusammen-
fassen läßt, kam in seiner geistigen Persönlichkeit als ge-
mäßigter Liberalismus und neuzeitlich gerichteter Ge-
schichtssinn zum Ausdruck. Es charakterisiert ihn, daß
er auch in der Jugend nicht radikal war, und es symboli-
siert ihn, daß er seinem Helden von der Presse einen
Germanenfürsten zum Ahnherrn schuf. „Ich lieb' es,
Gegensätze zu verbinden," sagt einer seiner Dramen-
helden. Hier ergab die Verbindung jenen aufrechten
Bürgersinn, der ihm wie wenigen in seiner sozialen
Stellung eigen blieb, selbst „den Höchsten der Erde
gegenüber", und der es selbstverständlich machte, daß er
den Adel ausschlug. Voll Genugtuung schrieb er an
seinem Lebensabend: „Ich gelte den Deutschen für einen,
ich darf es ja sagen, vornehmen Vertreter des Bürger-
tums." Das war das eine Hauptmerkmal. Das andere,
aus dem Grenzverkehr seiner Altvordern stammend,
war eine immer wache vaterländische Gesinnung, die
sein Dichten und Trachten belebte wie das Blut den
Körper.
Wiederum zeigt sich das Ausgleichende seiner Natur.
Stolz wie nur einer auf seinen Heimatstaat, auf den vor
allen deutschen Staaten auserwählten, erfüllt von seinem
entschiedenen, zukunftskräftigen Geiste, war er doch in
anderer Art Preuße als der Märker, der Pommer . . .
Sein Preußentum wurde gemildert durch sein Schlesier-
tum. Anderseits hatte auch er erträumt, was sich in dem
politisch-kriegerischen Prozeß unter Preußens Führung
erfüllte, da dieses ideell hinter dem Reiche zurücktrat,
so viel es auch tatsächlich darin bedeutete. Man kann es
ein Spiegelbild der Übereinstimmung zwischen seiner
und der nationalen Entwicklung nennen, daß er noch in
Greisenjahren, nachdem er frühzeitig in das sächsische
Mitteldeutschland übergesiedelt war, dem Zuge nach
Westen weiter folgte und in das Gebiet des ehemaligen
Nassauerherzogs sich verpflanzte. Seiner Freizügigkeit
im Vaterlande entsprach in poetischer Hinsicht eine eigen-
tümliche Seßhaftigkeit. Es mögen wohl wenige Roman-
geschöpfe unserer Literatur den Lockungen des Auslandes
265