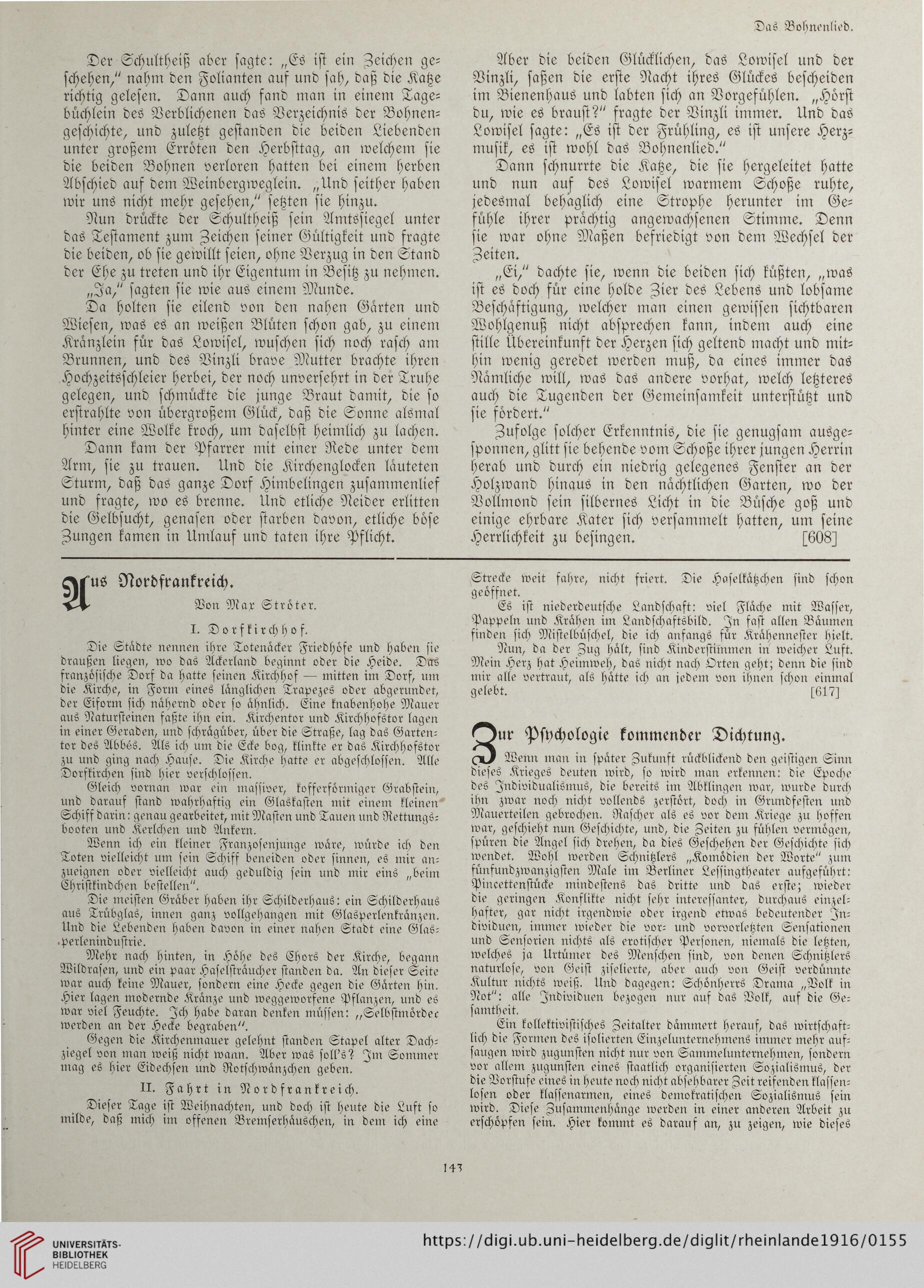Das Bohnenlied.
Der Schultheiß aber sagte: „ES ist ein Zeichen ge-
schehen/ nahm den Folianten auf und sah, daß die Katze
richtig gelesen. Dann auch fand man in einem Tage-
büchlein des Verblichenen das Verzeichnis der Bohnen-
geschichte, und zuletzt gestanden die beiden Liebenden
unter großem Erröten den Herbsttag, an welchem sie
die beiden Bohnen verloren hatten bei einem herben
Abschied auf dem Weinbergweglein. „Und seither haben
wir uns nicht mehr gesehen," setzten sie hinzu.
Nun drückte der Schultheiß sein Amtssiegel unter
das Testament zum Zeichen seiner Gültigkeit und fragte
die beiden, ob sie gewillt seien, ohne Verzug in den Stand
der Ehe zu treten und ihr Eigentum in Besitz zu nehmen.
„Ja/ sagten sie wie aus einem Munde.
Da holten sie eilend von den nahen Gärten und
Wiesen, was es an weißen Blüten schon gab, zu einem
Kränzlein für das Lowisel, wuschen sich noch rasch am
Brunnen, und des Vinzli brave Mutter brachte ihren
Hochzeitsschleier herbei, der noch unversehrt in der Truhe
gelegen, und schmückte die junge Braut damit, die so
erstrahlte von übergroßem Glück, daß die Sonne alsmal
hinter eine Wolke kroch, um daselbst heimlich zu lachen.
Dann kam der Pfarrer mit einer Rede unter dem
Arm, sie zu trauen. Und die Kirchenglocken lauteten
Sturm, daß das ganze Dorf Himbelingen zusammenlief
und fragte, wo es brenne. Und etliche Neider erlitten
die Gelbsucht, genasen oder starben davon, etliche böse
Zungen kamen in Umlauf und taten ihre Pflicht.
Aber die beiden Glücklichen, das Lowisel und der
Vinzli, saßen die erste Nacht ihres Glückes bescheiden
im Bienenhaus und labten sich an Vorgefühlen. „Hörst
du, wie es braust?" fragte der Vinzli immer. Und das
Lowisel sagte: „Es ist der Frühling, es ist unsere Herz-
musik, es ist wohl das Bohnenlied."
Dann schnurrte die Katze, die sie hergeleitet hatte
und nun auf des Lowisel warmem Schoße ruhte,
jedesmal behaglich eine Strophe herunter in: Ge-
fühle ihrer prächtig angewachsenen Stimme. Denn
sie war ohne Maßen befriedigt von dem Wechsel der
Zeiten.
„Ei," dachte sie, wenn die beiden sich küßten, „was
ist es doch für eine holde Zier des Lebens und lobsame
Beschäftigung, welcher inan einen gewissen sichtbaren
Wohlgenuß nicht absprechen kann, indem auch eine
stille Übereinkunft der Herzen sich geltend macht und mit-
hin wenig geredet werden muß, da eines immer das
Nämliche will, was das andere vorhat, welch letzteres
auch die Tugenden der Gemeinsamkeit unterstützt und
sie fördert."
Zufolge solcher Erkenntnis, die sie genugsam ausge-
sponnen, glitt sie behende vom Schoße ihrer jungen Herrin
herab und durch ein niedrig gelegenes Fenster an der
Holzwand hinaus in den nächtlichen Garten, wo der
Vollmond sein silbernes Licht in die Büsche goß und
einige ehrbare Kater sich versammelt hatten, um seine
Herrlichkeit zu besingen. W8^s
Nordfrankreich.
Von Max Ströter.
I. Dorfkirchhof.
Die Städte nennen ihre Totenacker Friedhöfe und haben sie
draußen liegen, wo das Ackerland beginnt oder die Heide. Das
französische Dorf da hatte seinen Kirchhof — mitten im Dorf, um
die Kirche, in Form eines länglichen Trapezes oder abgerundet,
der Eiform sich nähernd oder so ähnlich. Eine knabenhohe Mauer
aus Natursteinen faßte ihn ein. Kirchentor und Kirchhofstor lagen
in einer Geraden, und schrägüber, über die Straße, lag das Garten:
tor des Abbös. Als ich um die Ecke bog, klinkte er das Kirchhofstor
zu und ging nach Hause. Die Kirche hatte er abgeschlossen. Alle
Dorfkirchen sind hier verschlossen.
Gleich vornan war ein massiver, kofferförmiger Grabstein,
und darauf stand wahrhaftig ein Glaskasten mit einem kleinen
Schiff darin: genau gearbeitet, mit Masten und Tauen und Rettungs:
booten und Kerlchen und Ankern.
Wenn ich ein kleiner Franzosenjunge wäre, würde ich den
Toten vielleicht um sein Schiff beneiden oder sinnen, es mir an-
zueignen oder vielleicht auch geduldig sein und mir eins „beim
Christkindchen bestellen".
Die meisten Gräber haben ihr Schilderhaus: ein Schilderhaus
aus Trübglas, innen ganz vollgehangen mit Glasperlenkränzen.
Und die Lebenden haben davon in einer nahen Stadt eine Glas-
.Perlenindustrie.
Mehr nach hinten, in Höhe des Chors der Kirche, begann
Wildrasen, und ein paar Haselsträucher standen da. An dieser Seite
war auch keine Mauer, sondern eine Hecke gegen die Gärten hin.
Hier lagen modernde Kränze und weggeworfene Pflanzen, und es
war viel Feuchte. Ich habe daran denken müssen: „Selbstmörder
werden an der Hecke begraben".
Gegen die Kirchenmauer gelehnt standen Stapel alter Dach-
ziegel von man weiß nicht wann. Aber was soll's? Im Sommer
mag es hier Eidechsen und Rotschwänzchen geben.
II. Fahrt in Nordfrankreich.
Dieser Tage ist Weihnachten, und doch ist heute die Luft so
milde, daß mich im offenen Bremserhäuschen, in dem ich eine
Strecke weit fahre, nicht friert. Die Haselkähchen sind schon
geöffnet.
Es ist niederdeutsche Landschaft: viel Fläche mit Wasser,
Pappeln und Krähen im Landschaftsbild. In fast allen Bäumen
finden sich Mistelbüschel, die ich anfangs für Krähennester hielt.
Nun, da der Zug hält, sind Kinderstimmen in weicher Luft.
Mein Herz hat Heimweh, das nicht nach Orten geht; denn die sind
mir alle vertraut, als hätte ich an jedem von ihnen schon einmal
gelebt. ' f617^
Our Psychologie kommender Dichtung.
Wenn man in später Zukunft rückblickend den geistigen Sinn
dieses Krieges deuten wird, so wird man erkennen: die Epoche
des Individualismus, die bereits im Abklingen war, wurde durch
ihn zwar noch nicht vollends zerstört, doch in Grundfesten und
Mauerteilen gebrochen. Rascher als es vor dem Kriege zu hoffen
war, geschieht nun Geschichte, und, die Zeiten zu fühlen vermögen,
spüren die Angel sich drehen, da dies Geschehen der Geschichte sich
wendet. Wohl werden Schnitzlers „Komödien der Worte" zum
fünfundzwanzigsten Male im Berliner Lessingtheater aufgeführt:
Pincettenstücke mindestens das dritte und das erste; wieder
die geringen Konflikte nicht sehr interessanter, durchaus einzel-
hafter, gar nicht irgendwie oder irgend etwas bedeutender In-
dividuen, immer wieder die vor- und vorvorletzten Sensationen
und Sensorien nichts als erotischer Personen, niemals die letzten,
welches ja Urtümer des Menschen sind, von denen Schnitzlers
naturlose, von Geist ziselierte, aber auch von Geist verdünnte
Kultur nichts weiß. Und dagegen: Schönherrs Drama „Volk in
Not": alle Individuen bezogen nur auf das Volk, auf die Ge-
samtheit.
Ein kollektivistisches Zeitalter dämmert herauf, das wirtschaft-
lich die Formen des isolierten Einzelunternehmens immer mehr auf-
saugen wird zugunsten nicht nur von Sammelunternehmen, sondern
vor allem zugunsten eines staatlich organisierten Sozialismus, der
die Vorstufe eines in heute noch nicht absehbarer Zeit reifenden klassen-
losen oder klassenarmen, eines demokratischen Sozialismus sein
wird. Diese Zusammenhänge werden in einer anderen Arbeit zu
erschöpfen sein. Hier kommt es darauf an, zu zeigen, wie dieses
147
Der Schultheiß aber sagte: „ES ist ein Zeichen ge-
schehen/ nahm den Folianten auf und sah, daß die Katze
richtig gelesen. Dann auch fand man in einem Tage-
büchlein des Verblichenen das Verzeichnis der Bohnen-
geschichte, und zuletzt gestanden die beiden Liebenden
unter großem Erröten den Herbsttag, an welchem sie
die beiden Bohnen verloren hatten bei einem herben
Abschied auf dem Weinbergweglein. „Und seither haben
wir uns nicht mehr gesehen," setzten sie hinzu.
Nun drückte der Schultheiß sein Amtssiegel unter
das Testament zum Zeichen seiner Gültigkeit und fragte
die beiden, ob sie gewillt seien, ohne Verzug in den Stand
der Ehe zu treten und ihr Eigentum in Besitz zu nehmen.
„Ja/ sagten sie wie aus einem Munde.
Da holten sie eilend von den nahen Gärten und
Wiesen, was es an weißen Blüten schon gab, zu einem
Kränzlein für das Lowisel, wuschen sich noch rasch am
Brunnen, und des Vinzli brave Mutter brachte ihren
Hochzeitsschleier herbei, der noch unversehrt in der Truhe
gelegen, und schmückte die junge Braut damit, die so
erstrahlte von übergroßem Glück, daß die Sonne alsmal
hinter eine Wolke kroch, um daselbst heimlich zu lachen.
Dann kam der Pfarrer mit einer Rede unter dem
Arm, sie zu trauen. Und die Kirchenglocken lauteten
Sturm, daß das ganze Dorf Himbelingen zusammenlief
und fragte, wo es brenne. Und etliche Neider erlitten
die Gelbsucht, genasen oder starben davon, etliche böse
Zungen kamen in Umlauf und taten ihre Pflicht.
Aber die beiden Glücklichen, das Lowisel und der
Vinzli, saßen die erste Nacht ihres Glückes bescheiden
im Bienenhaus und labten sich an Vorgefühlen. „Hörst
du, wie es braust?" fragte der Vinzli immer. Und das
Lowisel sagte: „Es ist der Frühling, es ist unsere Herz-
musik, es ist wohl das Bohnenlied."
Dann schnurrte die Katze, die sie hergeleitet hatte
und nun auf des Lowisel warmem Schoße ruhte,
jedesmal behaglich eine Strophe herunter in: Ge-
fühle ihrer prächtig angewachsenen Stimme. Denn
sie war ohne Maßen befriedigt von dem Wechsel der
Zeiten.
„Ei," dachte sie, wenn die beiden sich küßten, „was
ist es doch für eine holde Zier des Lebens und lobsame
Beschäftigung, welcher inan einen gewissen sichtbaren
Wohlgenuß nicht absprechen kann, indem auch eine
stille Übereinkunft der Herzen sich geltend macht und mit-
hin wenig geredet werden muß, da eines immer das
Nämliche will, was das andere vorhat, welch letzteres
auch die Tugenden der Gemeinsamkeit unterstützt und
sie fördert."
Zufolge solcher Erkenntnis, die sie genugsam ausge-
sponnen, glitt sie behende vom Schoße ihrer jungen Herrin
herab und durch ein niedrig gelegenes Fenster an der
Holzwand hinaus in den nächtlichen Garten, wo der
Vollmond sein silbernes Licht in die Büsche goß und
einige ehrbare Kater sich versammelt hatten, um seine
Herrlichkeit zu besingen. W8^s
Nordfrankreich.
Von Max Ströter.
I. Dorfkirchhof.
Die Städte nennen ihre Totenacker Friedhöfe und haben sie
draußen liegen, wo das Ackerland beginnt oder die Heide. Das
französische Dorf da hatte seinen Kirchhof — mitten im Dorf, um
die Kirche, in Form eines länglichen Trapezes oder abgerundet,
der Eiform sich nähernd oder so ähnlich. Eine knabenhohe Mauer
aus Natursteinen faßte ihn ein. Kirchentor und Kirchhofstor lagen
in einer Geraden, und schrägüber, über die Straße, lag das Garten:
tor des Abbös. Als ich um die Ecke bog, klinkte er das Kirchhofstor
zu und ging nach Hause. Die Kirche hatte er abgeschlossen. Alle
Dorfkirchen sind hier verschlossen.
Gleich vornan war ein massiver, kofferförmiger Grabstein,
und darauf stand wahrhaftig ein Glaskasten mit einem kleinen
Schiff darin: genau gearbeitet, mit Masten und Tauen und Rettungs:
booten und Kerlchen und Ankern.
Wenn ich ein kleiner Franzosenjunge wäre, würde ich den
Toten vielleicht um sein Schiff beneiden oder sinnen, es mir an-
zueignen oder vielleicht auch geduldig sein und mir eins „beim
Christkindchen bestellen".
Die meisten Gräber haben ihr Schilderhaus: ein Schilderhaus
aus Trübglas, innen ganz vollgehangen mit Glasperlenkränzen.
Und die Lebenden haben davon in einer nahen Stadt eine Glas-
.Perlenindustrie.
Mehr nach hinten, in Höhe des Chors der Kirche, begann
Wildrasen, und ein paar Haselsträucher standen da. An dieser Seite
war auch keine Mauer, sondern eine Hecke gegen die Gärten hin.
Hier lagen modernde Kränze und weggeworfene Pflanzen, und es
war viel Feuchte. Ich habe daran denken müssen: „Selbstmörder
werden an der Hecke begraben".
Gegen die Kirchenmauer gelehnt standen Stapel alter Dach-
ziegel von man weiß nicht wann. Aber was soll's? Im Sommer
mag es hier Eidechsen und Rotschwänzchen geben.
II. Fahrt in Nordfrankreich.
Dieser Tage ist Weihnachten, und doch ist heute die Luft so
milde, daß mich im offenen Bremserhäuschen, in dem ich eine
Strecke weit fahre, nicht friert. Die Haselkähchen sind schon
geöffnet.
Es ist niederdeutsche Landschaft: viel Fläche mit Wasser,
Pappeln und Krähen im Landschaftsbild. In fast allen Bäumen
finden sich Mistelbüschel, die ich anfangs für Krähennester hielt.
Nun, da der Zug hält, sind Kinderstimmen in weicher Luft.
Mein Herz hat Heimweh, das nicht nach Orten geht; denn die sind
mir alle vertraut, als hätte ich an jedem von ihnen schon einmal
gelebt. ' f617^
Our Psychologie kommender Dichtung.
Wenn man in später Zukunft rückblickend den geistigen Sinn
dieses Krieges deuten wird, so wird man erkennen: die Epoche
des Individualismus, die bereits im Abklingen war, wurde durch
ihn zwar noch nicht vollends zerstört, doch in Grundfesten und
Mauerteilen gebrochen. Rascher als es vor dem Kriege zu hoffen
war, geschieht nun Geschichte, und, die Zeiten zu fühlen vermögen,
spüren die Angel sich drehen, da dies Geschehen der Geschichte sich
wendet. Wohl werden Schnitzlers „Komödien der Worte" zum
fünfundzwanzigsten Male im Berliner Lessingtheater aufgeführt:
Pincettenstücke mindestens das dritte und das erste; wieder
die geringen Konflikte nicht sehr interessanter, durchaus einzel-
hafter, gar nicht irgendwie oder irgend etwas bedeutender In-
dividuen, immer wieder die vor- und vorvorletzten Sensationen
und Sensorien nichts als erotischer Personen, niemals die letzten,
welches ja Urtümer des Menschen sind, von denen Schnitzlers
naturlose, von Geist ziselierte, aber auch von Geist verdünnte
Kultur nichts weiß. Und dagegen: Schönherrs Drama „Volk in
Not": alle Individuen bezogen nur auf das Volk, auf die Ge-
samtheit.
Ein kollektivistisches Zeitalter dämmert herauf, das wirtschaft-
lich die Formen des isolierten Einzelunternehmens immer mehr auf-
saugen wird zugunsten nicht nur von Sammelunternehmen, sondern
vor allem zugunsten eines staatlich organisierten Sozialismus, der
die Vorstufe eines in heute noch nicht absehbarer Zeit reifenden klassen-
losen oder klassenarmen, eines demokratischen Sozialismus sein
wird. Diese Zusammenhänge werden in einer anderen Arbeit zu
erschöpfen sein. Hier kommt es darauf an, zu zeigen, wie dieses
147