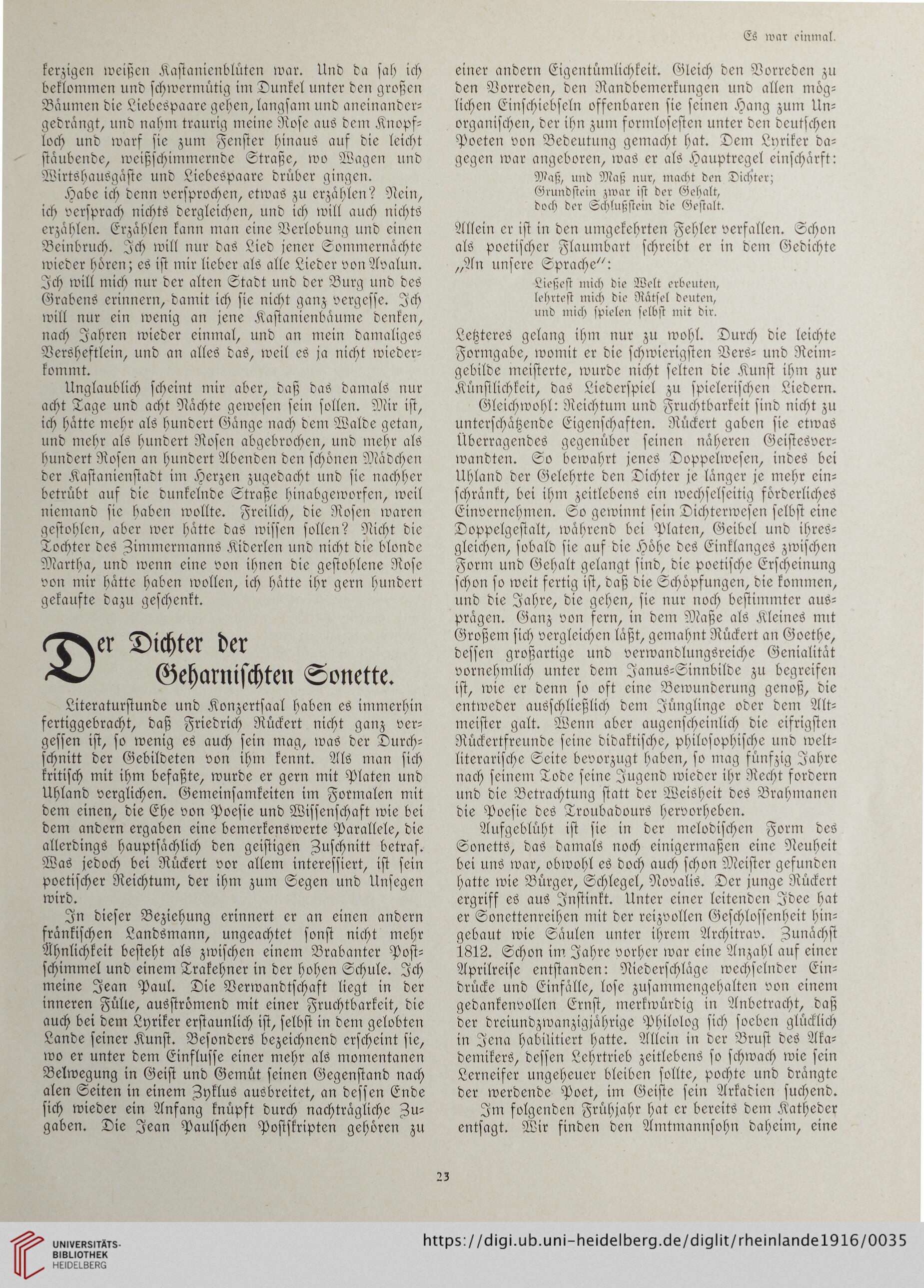Es war einmal.
kerzigen weißen Kastanienblüten war. Und da sab ich
beklommen und schwermütig im Dunkel unter den großen
Baumen die Liebespaare gehen, langsam und aneinander-
gedrängt, und nahm traurig meine Rose aus dem Knopf-
loch und warf sie zum Fenster hinaus auf die leicht
staubende, weißschimmernde Straße, wo Wagen und
Wirtshausgäste und Liebespaare drüber gingen.
Habe ich denn versprochen, etwas zu erzählen? Nein,
ich versprach nichts dergleichen, und ich will auch nichts
erzählen. Erzählen kann man eine Verlobung und einen
Beinbruch. Ich will nur das Lied jener Sommernächte
wieder hören; es ist mir lieber als alle Lieder vonAvalun.
Ich will mich nur der alten Stadt und der Burg und des
Grabens erinnern, damit ich sie nicht ganz vergesse. Ich
will nur ein wenig an jene Kastanienbäume denken,
nach Jahren wieder einmal, und an mein damaliges
Versheftlein, und an alles das, weil es ja nicht wieder-
kommt.
Unglaublich scheint mir aber, daß das damals nur
acht Tage und acht Nächte gewesen sein sollen. Mir ist,
ich hätte mehr als hundert Gänge nach dem Walde getan,
und mehr als hundert Rosen abgebrochen, und mehr als
hundert Rosen an hundert Abenden den schönen Mädchen
der Kastanienstadt im Herzen zugedacht und sie nachher
betrübt auf die dunkelnde Straße hinabgeworfen, weil
niemand sie haben wollte. Freilich, die Rosen waren
gestohlen, aber wer hätte das wissen sollen? Nicht die
Tochter des Zimmermanns Kiderlen und nicht die blonde
Martha, und wenn eine von ihnen die gestohlene Rose
von mir hätte haben wollen, ich hätte ihr gern hundert
gekaufte dazu geschenkt.
er Dichter der
Geharnischten Sonette.
Literaturstunde und Konzertsaal haben es immerhin
fertiggebracht, daß Friedrich Rückert nicht ganz ver-
gessen ist, so wenig es auch sein mag, was der Durch-
schnitt der Gebildeten von ihm kennt. Als man sich
kritisch mit ihm befaßte, wurde er gern mit Platen und
Uhland verglichen. Gemeinsamkeiten im Formalen mit
dem einen, die Ehe von Poesie und Wissenschaft wie bei
dem andern ergaben eine bemerkenswerte Parallele, die
allerdings hauptsächlich den geistigen Zuschnitt betraf.
Was jedoch bei Rückert vor allem interessiert, ist sein
poetischer Reichtum, der ihm zum Segen und Unsegen
wird.
In dieser Beziehung erinnert er an einen andern
fränkischen Landsmann, ungeachtet sonst nicht mehr
Ähnlichkeit besteht als zwischen einem Brabanter Post-
schimmel und einem Trakehner in der hohen Schule. Ich
meine Jean Paul. Die Verwandtschaft liegt in der
inneren Fülle, ausströmend mit einer Fruchtbarkeit, die
auch bei dem Lyriker erstaunlich ist, selbst in dem gelobten
Lande seiner Kunst. Besonders bezeichnend erscheint sie,
wo er unter dem Einflüsse einer mehr als momentanen
Belwegung in Geist und Gemüt seinen Gegenstand nach
alen Seiten in einem Zyklus ausbreitet, an dessen Ende
sich wieder ein Anfang knüpft durch nachträgliche Zu-
gaben. Die Jean Panischen Postskripten gehören zu
einer andern Eigentümlichkeit. Gleich den Vorreden zu
den Vorreden, den Randbemerkungen und allen mög-
lichen Einschiebseln offenbaren sie seinen Hang zum Un-
organischen, der ihn zum formlosesten unter den deutschen
Poeten von Bedeutung gemacht hat. Dem Lunker da-
gegen war angeboren, was er als Hauptregel einschärft:
Maß, und Maß nur, macht den Dichter;
Grundstein zwar ist der Gehalt,
doch der Schlußstein die Gestalt.
Allein er ist in den umgekehrten Fehler verfallen. Schon
als poetischer Flaumbart schreibt er in dem Gedichte
„An unsere Sprache":
Ließest mich die Welt erbeuten,
lehrtest mich die Rätsel deuten,
und mich spielen selbst mit dir.
Letzteres gelang ihm nur zu wohl. Durch die leichte
Formgabe, womit er die schwierigsten Vers- und Reim-
gebilde meisterte, wurde nicht selten die Kunst ihm zur
Künstlichkeit, das Liederspiel zu spielerischen Liedern.
Gleichwohl: Reichtum und Fruchtbarkeit sind nicht zu
unterschätzende Eigenschaften. Rückert gaben sie etwas
Überragendes gegenüber seinen näheren Geistesver-
wandten. So bewahrt jenes Doppelwesen, indes bei
Uhland der Gelehrte den Dichter je länger je mehr ein-
schränkt, bei ihm zeitlebens ein wechselseitig förderliches
Einvernehmen. So gewinnt sein Dichterwesen selbst eine
Doppelgestalt, während bei Platen, Geibel und ihres-
gleichen, sobald sie auf die Höhe des Einklanges zwischen
Form und Gehalt gelangt sind, die poetische Erscheinung
schon so weit fertig ist, daß die Schöpfungen, die kommen,
und die Jahre, die gehen, sie nur noch bestimmter aus-
prägen. Ganz von fern, in dem Maße als Kleines mit
Großem sich vergleichen läßt, gemahnt Rückert an Goethe,
dessen großartige und verwandlungsreiche Genialität
vornehmlich unter dem Janus-Sinnbilde zu begreifen
ist, wie er denn so oft eine Bewunderung genoß, die
entweder ausschließlich dem Jünglinge oder dem Alt-
meister galt. Wenn aber augenscheinlich die eifrigsten
Rückertfreunde seine didaktische, philosophische und welt-
literarische Seite bevorzugt haben, so mag fünfzig Jahre
nach seinem Tode seine Jugend wieder ihr Recht fordern
und die Betrachtung statt der Weisheit des Brahmanen
die Poesie des Troubadours hervorheben.
Aufgeblüht ist sie in der melodischen Form des
Sonetts, das damals noch einigermaßen eine Neuheit
bei uns war, obwohl es doch auch schon Meister gefunden
hatte wie Bürger, Schlegel, Novalis. Der junge Rückert
ergriff es aus Instinkt. Unter einer leitenden Idee hat
er Sonettenreihen mit der reizvollen Geschlossenheit hin-
gebaut wie Säulen unter ihrem Architrav. Zunächst
1812. Schon im Jahre vorher war eine Anzahl auf einer
Aprilreise entstanden: Niederschläge wechselnder Ein-
drücke und Einfälle, lose zusammengehalten von einem
gedankenvollen Ernst, merkwürdig in Anbetracht, daß
der dreiundzwanzigjährige Philolog sich soeben glücklich
in Jena habilitiert hatte. Allein in der Brust des Aka-
demikers, dessen Lehrtrieb zeitlebens so schwach wie sein
Lerneifer ungeheuer bleiben sollte, pochte und drängte
der werdende Poet, im Geiste sein Arkadien suchend.
Im folgenden Frühjahr hat er bereits dem Katheder
entsagt. Wir finden den Amtmannsohn daheim, eine
2Z
kerzigen weißen Kastanienblüten war. Und da sab ich
beklommen und schwermütig im Dunkel unter den großen
Baumen die Liebespaare gehen, langsam und aneinander-
gedrängt, und nahm traurig meine Rose aus dem Knopf-
loch und warf sie zum Fenster hinaus auf die leicht
staubende, weißschimmernde Straße, wo Wagen und
Wirtshausgäste und Liebespaare drüber gingen.
Habe ich denn versprochen, etwas zu erzählen? Nein,
ich versprach nichts dergleichen, und ich will auch nichts
erzählen. Erzählen kann man eine Verlobung und einen
Beinbruch. Ich will nur das Lied jener Sommernächte
wieder hören; es ist mir lieber als alle Lieder vonAvalun.
Ich will mich nur der alten Stadt und der Burg und des
Grabens erinnern, damit ich sie nicht ganz vergesse. Ich
will nur ein wenig an jene Kastanienbäume denken,
nach Jahren wieder einmal, und an mein damaliges
Versheftlein, und an alles das, weil es ja nicht wieder-
kommt.
Unglaublich scheint mir aber, daß das damals nur
acht Tage und acht Nächte gewesen sein sollen. Mir ist,
ich hätte mehr als hundert Gänge nach dem Walde getan,
und mehr als hundert Rosen abgebrochen, und mehr als
hundert Rosen an hundert Abenden den schönen Mädchen
der Kastanienstadt im Herzen zugedacht und sie nachher
betrübt auf die dunkelnde Straße hinabgeworfen, weil
niemand sie haben wollte. Freilich, die Rosen waren
gestohlen, aber wer hätte das wissen sollen? Nicht die
Tochter des Zimmermanns Kiderlen und nicht die blonde
Martha, und wenn eine von ihnen die gestohlene Rose
von mir hätte haben wollen, ich hätte ihr gern hundert
gekaufte dazu geschenkt.
er Dichter der
Geharnischten Sonette.
Literaturstunde und Konzertsaal haben es immerhin
fertiggebracht, daß Friedrich Rückert nicht ganz ver-
gessen ist, so wenig es auch sein mag, was der Durch-
schnitt der Gebildeten von ihm kennt. Als man sich
kritisch mit ihm befaßte, wurde er gern mit Platen und
Uhland verglichen. Gemeinsamkeiten im Formalen mit
dem einen, die Ehe von Poesie und Wissenschaft wie bei
dem andern ergaben eine bemerkenswerte Parallele, die
allerdings hauptsächlich den geistigen Zuschnitt betraf.
Was jedoch bei Rückert vor allem interessiert, ist sein
poetischer Reichtum, der ihm zum Segen und Unsegen
wird.
In dieser Beziehung erinnert er an einen andern
fränkischen Landsmann, ungeachtet sonst nicht mehr
Ähnlichkeit besteht als zwischen einem Brabanter Post-
schimmel und einem Trakehner in der hohen Schule. Ich
meine Jean Paul. Die Verwandtschaft liegt in der
inneren Fülle, ausströmend mit einer Fruchtbarkeit, die
auch bei dem Lyriker erstaunlich ist, selbst in dem gelobten
Lande seiner Kunst. Besonders bezeichnend erscheint sie,
wo er unter dem Einflüsse einer mehr als momentanen
Belwegung in Geist und Gemüt seinen Gegenstand nach
alen Seiten in einem Zyklus ausbreitet, an dessen Ende
sich wieder ein Anfang knüpft durch nachträgliche Zu-
gaben. Die Jean Panischen Postskripten gehören zu
einer andern Eigentümlichkeit. Gleich den Vorreden zu
den Vorreden, den Randbemerkungen und allen mög-
lichen Einschiebseln offenbaren sie seinen Hang zum Un-
organischen, der ihn zum formlosesten unter den deutschen
Poeten von Bedeutung gemacht hat. Dem Lunker da-
gegen war angeboren, was er als Hauptregel einschärft:
Maß, und Maß nur, macht den Dichter;
Grundstein zwar ist der Gehalt,
doch der Schlußstein die Gestalt.
Allein er ist in den umgekehrten Fehler verfallen. Schon
als poetischer Flaumbart schreibt er in dem Gedichte
„An unsere Sprache":
Ließest mich die Welt erbeuten,
lehrtest mich die Rätsel deuten,
und mich spielen selbst mit dir.
Letzteres gelang ihm nur zu wohl. Durch die leichte
Formgabe, womit er die schwierigsten Vers- und Reim-
gebilde meisterte, wurde nicht selten die Kunst ihm zur
Künstlichkeit, das Liederspiel zu spielerischen Liedern.
Gleichwohl: Reichtum und Fruchtbarkeit sind nicht zu
unterschätzende Eigenschaften. Rückert gaben sie etwas
Überragendes gegenüber seinen näheren Geistesver-
wandten. So bewahrt jenes Doppelwesen, indes bei
Uhland der Gelehrte den Dichter je länger je mehr ein-
schränkt, bei ihm zeitlebens ein wechselseitig förderliches
Einvernehmen. So gewinnt sein Dichterwesen selbst eine
Doppelgestalt, während bei Platen, Geibel und ihres-
gleichen, sobald sie auf die Höhe des Einklanges zwischen
Form und Gehalt gelangt sind, die poetische Erscheinung
schon so weit fertig ist, daß die Schöpfungen, die kommen,
und die Jahre, die gehen, sie nur noch bestimmter aus-
prägen. Ganz von fern, in dem Maße als Kleines mit
Großem sich vergleichen läßt, gemahnt Rückert an Goethe,
dessen großartige und verwandlungsreiche Genialität
vornehmlich unter dem Janus-Sinnbilde zu begreifen
ist, wie er denn so oft eine Bewunderung genoß, die
entweder ausschließlich dem Jünglinge oder dem Alt-
meister galt. Wenn aber augenscheinlich die eifrigsten
Rückertfreunde seine didaktische, philosophische und welt-
literarische Seite bevorzugt haben, so mag fünfzig Jahre
nach seinem Tode seine Jugend wieder ihr Recht fordern
und die Betrachtung statt der Weisheit des Brahmanen
die Poesie des Troubadours hervorheben.
Aufgeblüht ist sie in der melodischen Form des
Sonetts, das damals noch einigermaßen eine Neuheit
bei uns war, obwohl es doch auch schon Meister gefunden
hatte wie Bürger, Schlegel, Novalis. Der junge Rückert
ergriff es aus Instinkt. Unter einer leitenden Idee hat
er Sonettenreihen mit der reizvollen Geschlossenheit hin-
gebaut wie Säulen unter ihrem Architrav. Zunächst
1812. Schon im Jahre vorher war eine Anzahl auf einer
Aprilreise entstanden: Niederschläge wechselnder Ein-
drücke und Einfälle, lose zusammengehalten von einem
gedankenvollen Ernst, merkwürdig in Anbetracht, daß
der dreiundzwanzigjährige Philolog sich soeben glücklich
in Jena habilitiert hatte. Allein in der Brust des Aka-
demikers, dessen Lehrtrieb zeitlebens so schwach wie sein
Lerneifer ungeheuer bleiben sollte, pochte und drängte
der werdende Poet, im Geiste sein Arkadien suchend.
Im folgenden Frühjahr hat er bereits dem Katheder
entsagt. Wir finden den Amtmannsohn daheim, eine
2Z