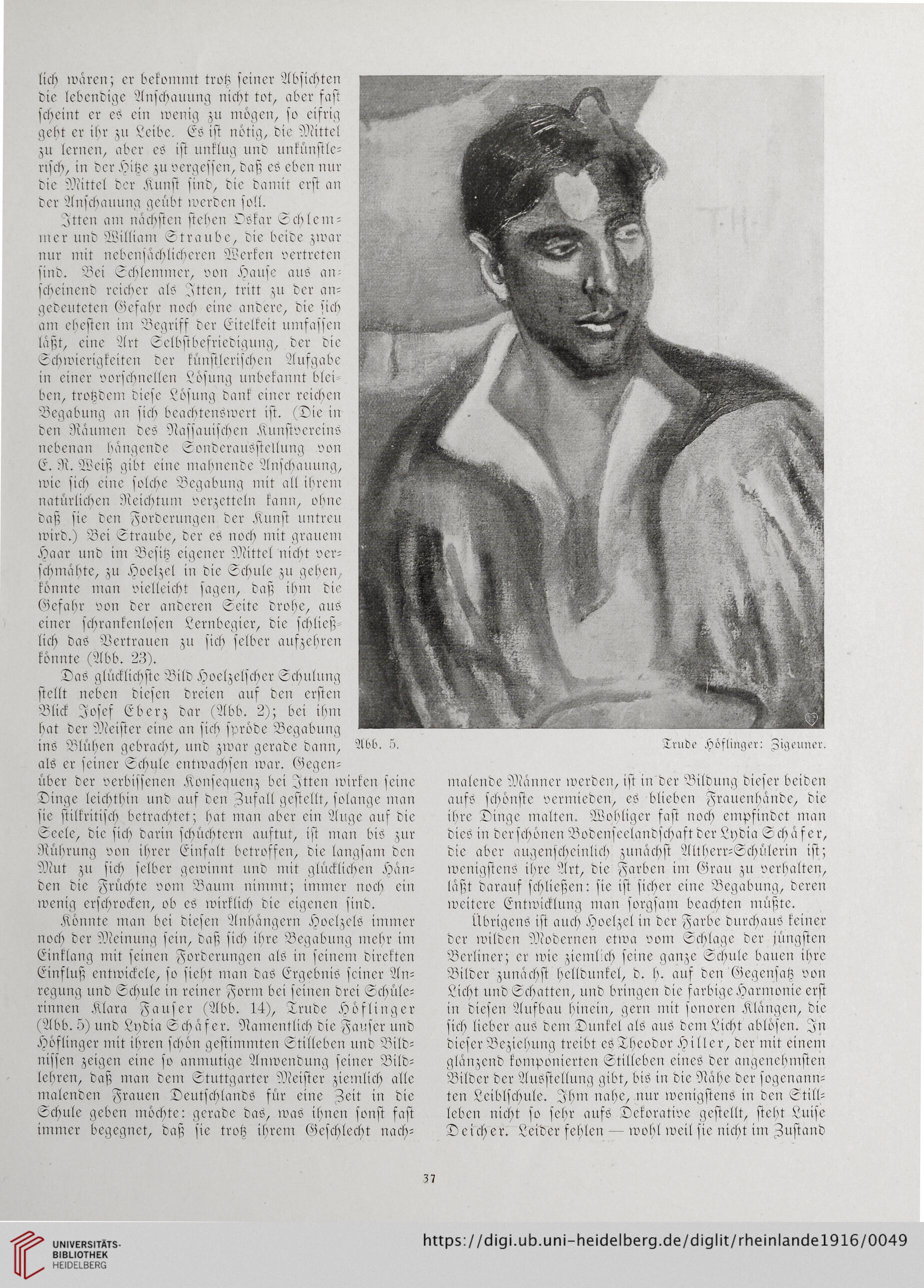Trude Höflinger: Zigeuner.
malende Männer werden, ist in der Bildung dieser beiden
lieh wären; er bekommt trotz seiner Absichten
die lebendige Anschauung nicht tot, aber fast
scheint er es ein wenig zu mögen, so eifrig
geht er ihr zu Leibe. Es ist nötig, die Mittel
zu lernen, aber es ist unklug und unkünstlc-
nsch, in der Hitze zu vergessen, daß es eben nur
die Mittel der Kunst sind, die damit erst an
der Anschauung geübt werden soll.
Ittcn am nächsten sieben Oskar Schlem-
mer und William Straube, die beide zwar
nur mit nebensächlicheren Werken vertreten
sind. Bei Schlemmer, von Hause aus an-
scheinend reicher als Ittcn, tritt zu der an-
gedeuteten Gefahr nocb eine andere, die sich
am ehesten im Begriff der Eitelkeit umfassen
läßt, eine Art Selbstbefriedigung, der die
Schwierigkeiten der künstlerischen Aufgabe
in einer vorschnellen Lösung unbekannt blei-
ben, trotzdem diese Lösung dank einer reichen
Begabung an sich beachtenswert ist. (Die in
den Räumen des Nassauischen Kunstvereins
nebenan hängende Sonderausstctlung von
E. R. Weiß gibt eine mahnende Anschauung,
wie sich eine solche Begabung mit all ihrem
natürlichen Reichtum verzetteln kann, ohne
daß sie den Forderungen der Kunst untreu
wird.) Bei Straube, der es noch mit grauem
Haar und im Besitz eigener Mittel nicht ver-
schmähte, zu Hoelzel in die Schule zu gehen,
könnte man vielleicht sagen, daß ihm die
Gefahr von der anderen Seite drohe, aus
einer schrankenlosen Lernbegier, die schließ-
lich das Vertrauen zu sich selber aufzehren
könnte (Abb. 23).
Das glücklichste Bild Hoelzelscher Schulung
stellt neben diesen dreien auf den ersten
Blick Josef Eberz dar (Abb. 2); bei ihm
hat der Meister eine an sich spröde Begabung
ins Blühen gebracht, und zwar gerade dann, Abb. 5.
als er seiner Schule entwachsen war. Gegen-
über der verbissenen Konsequenz bei Jtten wirken seine
Dinge leichthin und auf den Zufall gestellt, solange man
sie stilkritisch betrachtet; hat man aber ein Auge auf die
Seele, die sich darin schüchtern auftut, ist man bis zur
Rührung von ihrer Einfalt betroffen, die langsam den
Mut zu sich selber gewinnt und mit glücklichen Hän-
den die Früchte vom Baum nimmt; immer noch ein
wenig erschrocken, ob es wirklich die eigenen sind.
Könnte man bei diesen Anhängern Hoelzels immer
noch der Meinung sein, daß sich ihre Begabung mehr im
Einklang mit seinen Forderungen als in seinem direkten
Einfluß entwickele, so sieht man das Ergebnis seiner An-
regung und Schule in reiner Form bei seinen drei Schüle-
rinnen Klara Fauser (Abb. 14), Trude Höflinger
(Abb. 5) und Lydia Schäfer. Namentlich die Fauser und
Höflinger mit ihren schön gestimmten Stilleben und Bild-
nissen zeigen eine so anmutige Anwendung seiner Bild-
lehren, daß man dem Stuttgarter Meister ziemlich alle
malenden Frauen Deutschlands für eine Zeit in die
Schule geben möchte: gerade das, was ihnen sonst fast
immer begegnet, daß sie trotz ihrem Geschlecht nach-
aufs schönste vermieden, es blieben Frauenhande, die
ihre Dinge malten. Wohliger fast noch empfindet man
dies in der schönen Bodenseelandschaft der Lydia Schäfer,
die aber augenscheinlich zunächst Altherr-Schülerin ist;
wenigstens ihre Art, die Farben im Grau zu verhalten,
läßt darauf schließen: sie ist sicher eine Begabung, deren
weitere Entwicklung man sorgsam beachten müßte.
Übrigens ist auch Hoelzel in der Farbe durchaus keiner
der wilden Modernen etwa vom Schlage der jüngsten
Berliner; er wie ziemlüh seine ganze Schule bauen ihre
Bilder zunächst Helldunkel, d. h. auf den Gegensatz von
Licht und Schatten, und bringen die sarbigeHarmonie erst
in diesen Aufbau hinein, gern mit sonoren Klängen, die
sich lieber aus dem Dunkel als aus dem Licht ablösen. In
dieser Beziehung treibt es Theodor Hiller, der mit einem
glänzend komponierten Stilleben eines der angenehmsten
Bilder der Ausstellung gibt, bis in die Nähe der sogenann-
ten Leiblschule. Ihm nahe, nur wenigstens in den Still-
leben nicht so sehr aufs Dekorative gestellt, steht Luise
Deich er. Leider fehlen — wohl weil sie nicht im Zustand