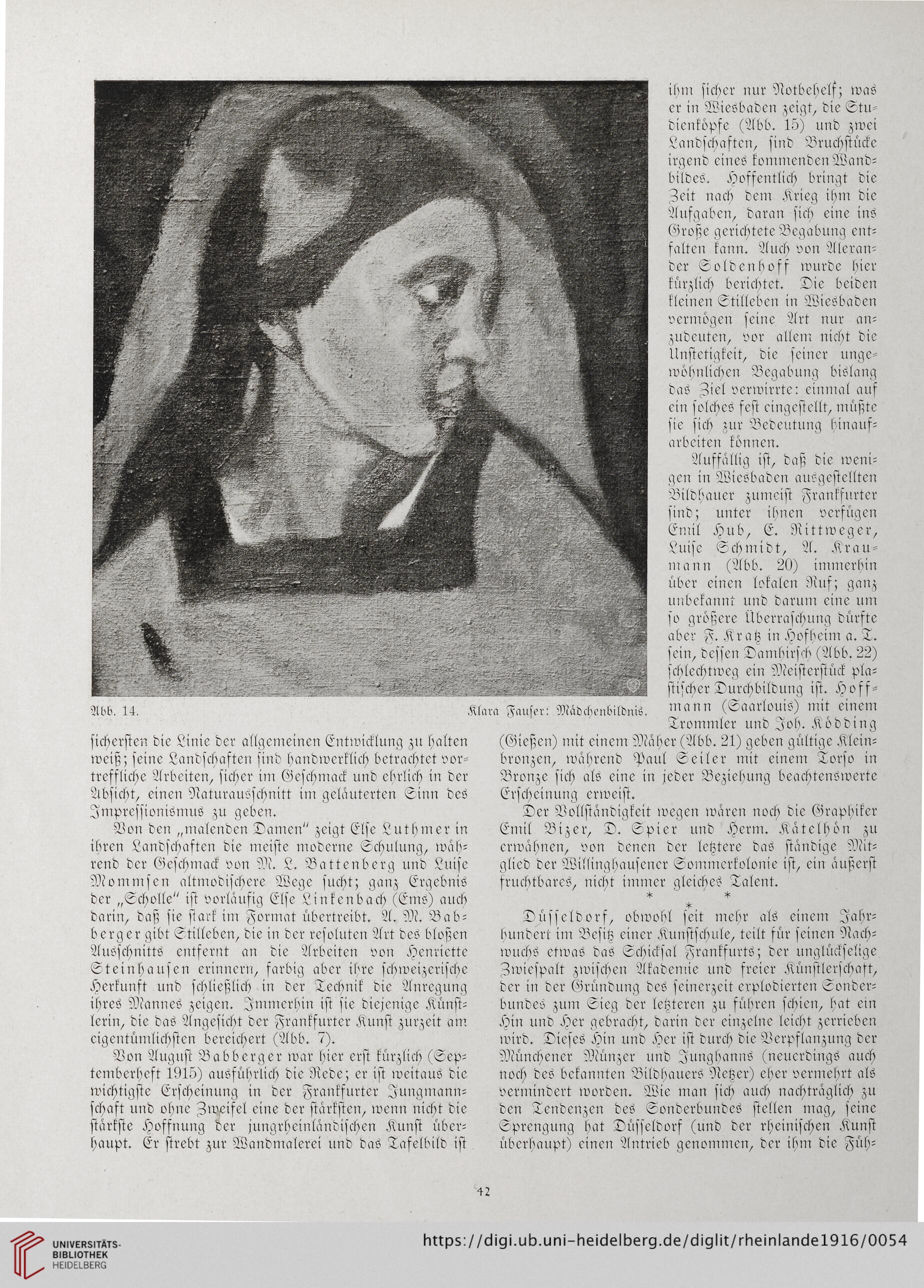Abb. 14. Klara Fauser: Madchenbildnis.
ihm sicher nur Notbehelf; waS
er in Wiesbaden zeigt, die Stu-
dienköpfe (Abb. 15) und zwei
Landschaften, sind Bruchstücke
irgend eines kommenden Wand-
bildes. Hoffentlich bringt die
Zeit nach dem Krieg ihm die
Aufgaben, daran sich eine ins
Große gerichtete Begabung ent-
falten kann. Auch von Alexan-
der Soldenboff wurde hier
kürzlich berichtet. Die beiden
kleinen Stilleben in Wiesbaden
vermögen seine Art nur an-
zudeuten, vor allein, nicht die
Unstetigkeit, die seiner unge-
wöhnlichen Begabung bislang
das Ziel verwirrte: einmal auf
ein solches fest eingestellt, müßte
sie fich zur Bedeutung hinauf-
arbeiten können.
Auffällig ist, daß die weni-
gen in Wiesbaden ausgestellten
Bildhauer zumeist Frankfurter
sind; unter ihnen verfügen
Emil Hub, E. Nittweger,
Luise Schmidt, A. Krau-
mann (Abb. 20) immerhin
über einen lokalen Nuf; ganz
unbekannt und darum eine um
so größere Überraschung dürfte
aber F. Kratz in Hofhcim a. T.
sein, dessen Damhirsch (Abb. 22)
schlechtweg ein Meisterstück pla-
stischer Durchbildung ist. Hoff-
mann (Saarlouis) mit einem
Trommler und Joh. Ködding
sichersten die Linie der allgemeinen Entwicklung zu halten
weiß; seine Landschaften sind handwerklich betrachtet vor-
treffliche Arbeiten, sicher im Geschmack und ehrlich in der
Absicht, einen Naturausschnitt im gelauterten Sinn des
Impressionismus zu geben.
Von den „malenden Damen" zeigt Else Luthmer in
ihren Landschaften die meiste moderne Schulung, wah-
rend der Geschmack von M. L. Battenberg und Luise
Mo ni ms en altmodischere Wege sucht; ganz Ergebnis
der „Scholle" ist vorläufig Else Linkendach (Ems) auch
darin, daß sie stark im Format übertreibt. A. M. Bab-
berg er gibt Stillcben, die in der resoluten Art des bloßen
Ausschnitts entfernt an die Arbeiten von Henriette
Steinhaufen erinnern, farbig aber ihre schweizerische
Herkunft und schließlich in der Technik die Anregung
ihres Mannes zeigen. Immerhin ist sie diejenige Künst-
lerin, die das Angesicht der Frankfurter Kunst zurzeit am
eigentümlichsten bereichert (Abb. 7).
Von August B abberg er war hier erst kürzlich (Sep-
tcmberheft 1915) ausführlich die Rede; er ist weitaus die
wichtigste Erscheinung in der Frankfurter Jungmann-
schaft und ohne Zn^eifel eine der stärksten, wenn nicht die
stärkste Hoffnung der jungrheinländischen Kunst über-
haupt. Er strebt zur Wandmalerei und das Tafelbild ist
(Gießen) mit einem Mäher (Abb. 21) geben gültige Klein-
bronzen, während Paul Seiler mit einem Torso in
Bronze sich als eine in jeder Beziehung beachtenswerte
Erscheinung erweist.
Der Vollständigkeit wegen wären noch die Graphiker
Emil Biz er, D. Spier und Herrn. Kätclhön zu
erwähnen, von denen der letztere das ständige Mit-
glied der Willinghausencr Sommerkolonie ist, ein äußerst
fruchtbares, nicht immer gleiches Talent.
* " *
*
Düsseldorf, obwobl seit mehr als einem Jahr-
hundert im Besitz einer Kunstschule, teilt für seinen Nach-
wuchs etwas das Schicksal Frankfurts; der unglückselige
Zwiespalt zwischen Akademie und freier Künstlerschaft,
der in der Gründung des seinerzeit explodierten Sonder-
bundes zum Sieg der letzteren zu führen schien, hat ein
Hin und Her gebracht, darin der einzelne leicht zerrieben
wird. Dieses Hin und Her ist durch die Verpflanzung der
Münchener Münzer und Junghanns (neuerdings auch
noch des bekannten Bildhauers Netzer) eher vermehrt als
vermindert worden. Wie man sich auch nachträglich zu
den Tendenzen des Sonderbundes stellen mag, seine
Sprengung hat Düsseldorf (und der rheinischen Kunst
überhaupt) einen Antrieb genommen, der ihm die Füh-
42
ihm sicher nur Notbehelf; waS
er in Wiesbaden zeigt, die Stu-
dienköpfe (Abb. 15) und zwei
Landschaften, sind Bruchstücke
irgend eines kommenden Wand-
bildes. Hoffentlich bringt die
Zeit nach dem Krieg ihm die
Aufgaben, daran sich eine ins
Große gerichtete Begabung ent-
falten kann. Auch von Alexan-
der Soldenboff wurde hier
kürzlich berichtet. Die beiden
kleinen Stilleben in Wiesbaden
vermögen seine Art nur an-
zudeuten, vor allein, nicht die
Unstetigkeit, die seiner unge-
wöhnlichen Begabung bislang
das Ziel verwirrte: einmal auf
ein solches fest eingestellt, müßte
sie fich zur Bedeutung hinauf-
arbeiten können.
Auffällig ist, daß die weni-
gen in Wiesbaden ausgestellten
Bildhauer zumeist Frankfurter
sind; unter ihnen verfügen
Emil Hub, E. Nittweger,
Luise Schmidt, A. Krau-
mann (Abb. 20) immerhin
über einen lokalen Nuf; ganz
unbekannt und darum eine um
so größere Überraschung dürfte
aber F. Kratz in Hofhcim a. T.
sein, dessen Damhirsch (Abb. 22)
schlechtweg ein Meisterstück pla-
stischer Durchbildung ist. Hoff-
mann (Saarlouis) mit einem
Trommler und Joh. Ködding
sichersten die Linie der allgemeinen Entwicklung zu halten
weiß; seine Landschaften sind handwerklich betrachtet vor-
treffliche Arbeiten, sicher im Geschmack und ehrlich in der
Absicht, einen Naturausschnitt im gelauterten Sinn des
Impressionismus zu geben.
Von den „malenden Damen" zeigt Else Luthmer in
ihren Landschaften die meiste moderne Schulung, wah-
rend der Geschmack von M. L. Battenberg und Luise
Mo ni ms en altmodischere Wege sucht; ganz Ergebnis
der „Scholle" ist vorläufig Else Linkendach (Ems) auch
darin, daß sie stark im Format übertreibt. A. M. Bab-
berg er gibt Stillcben, die in der resoluten Art des bloßen
Ausschnitts entfernt an die Arbeiten von Henriette
Steinhaufen erinnern, farbig aber ihre schweizerische
Herkunft und schließlich in der Technik die Anregung
ihres Mannes zeigen. Immerhin ist sie diejenige Künst-
lerin, die das Angesicht der Frankfurter Kunst zurzeit am
eigentümlichsten bereichert (Abb. 7).
Von August B abberg er war hier erst kürzlich (Sep-
tcmberheft 1915) ausführlich die Rede; er ist weitaus die
wichtigste Erscheinung in der Frankfurter Jungmann-
schaft und ohne Zn^eifel eine der stärksten, wenn nicht die
stärkste Hoffnung der jungrheinländischen Kunst über-
haupt. Er strebt zur Wandmalerei und das Tafelbild ist
(Gießen) mit einem Mäher (Abb. 21) geben gültige Klein-
bronzen, während Paul Seiler mit einem Torso in
Bronze sich als eine in jeder Beziehung beachtenswerte
Erscheinung erweist.
Der Vollständigkeit wegen wären noch die Graphiker
Emil Biz er, D. Spier und Herrn. Kätclhön zu
erwähnen, von denen der letztere das ständige Mit-
glied der Willinghausencr Sommerkolonie ist, ein äußerst
fruchtbares, nicht immer gleiches Talent.
* " *
*
Düsseldorf, obwobl seit mehr als einem Jahr-
hundert im Besitz einer Kunstschule, teilt für seinen Nach-
wuchs etwas das Schicksal Frankfurts; der unglückselige
Zwiespalt zwischen Akademie und freier Künstlerschaft,
der in der Gründung des seinerzeit explodierten Sonder-
bundes zum Sieg der letzteren zu führen schien, hat ein
Hin und Her gebracht, darin der einzelne leicht zerrieben
wird. Dieses Hin und Her ist durch die Verpflanzung der
Münchener Münzer und Junghanns (neuerdings auch
noch des bekannten Bildhauers Netzer) eher vermehrt als
vermindert worden. Wie man sich auch nachträglich zu
den Tendenzen des Sonderbundes stellen mag, seine
Sprengung hat Düsseldorf (und der rheinischen Kunst
überhaupt) einen Antrieb genommen, der ihm die Füh-
42