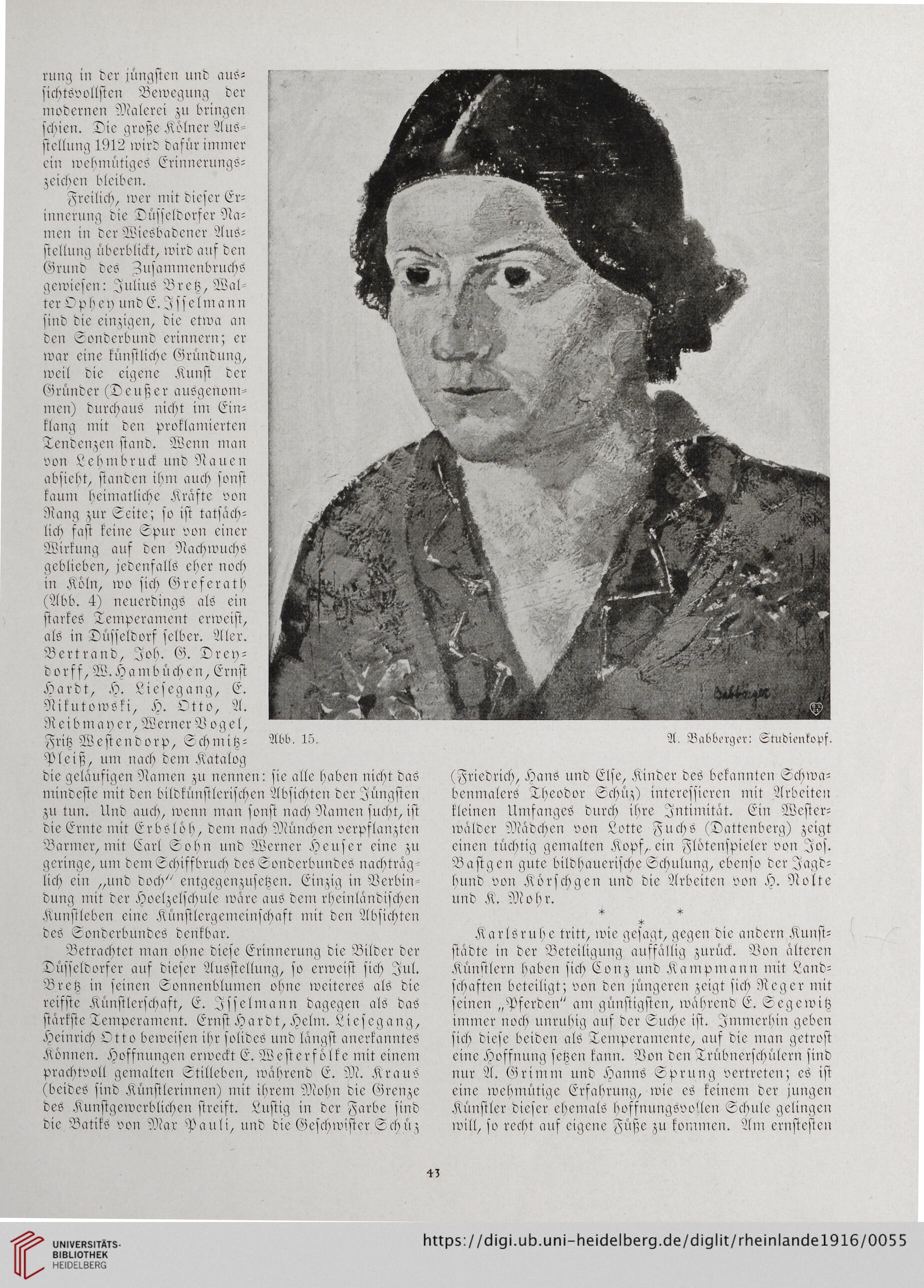rung in der jüngsten und aus-
sicbtsvollsten Bewegung der
modernen Malerei zu bringen
schien. Die große Kölner Aus-
stellung 1912 wird dafür immer
ein wehmütiges Erinnerungs-
zeichen bleiben.
Freilich, wer mit dieser Er-
innerung die Düsseldorfer Na-
men in der Wiesbadener Aus-
stellung überblickt, wird auf den
Grund des Zusammenbruchs
gewiesen: Julius Bretz, Wal-
ter Ophey und E. Isse l m a n n
sind die einzigen, die etwa an
den Sonderbund erinnern; er
war eine künstliche Gründung,
weil die eigene Kunst der
Gründer (Deußer ausgenom-
men) durchaus nicht im Ein-
klang mit den proklamierten
Tendenzen stand. Wenn man
von Lehmbruck und Nauen
absieht, standen ihm auch sonst
kaum heimatliche Kräfte von
Rang zur Seite; so ist tatsäch-
lich fast keine Spur von einer
Wirkung auf den Nachwuchs
geblieben, jedenfalls eher noch
in Köln, wo sich Greferath
(Abb. 4) neuerdings als ein
starkes Temperament erweist,
als in Düsseldorf selber. Alex.
Bertrand, Joh. G. Drey-
d o r f f, W. H a m b ü ch e n, Ernst
Hardt, H. Liesegang, E.
Nikutowski, H. Otto, A.
Neibmayer, Werner Vogel,
Fritz Westendorp, Schmitz-
A. Babberger: Studienkopf.
Pleiß, um nach dem Katalog
die geläufigen Namen zu nennen: sie alle haben nicht das
mindeste mit den bildkünstlerischen Absichten der Jüngsten
zu tun. Und auch, wenn man sonst nach Namen sucht, ist
die Ernte mit Erbslöh, dem nach München verpflanzten
Barmer, mit Carl Sohn und Werner Heuser eine zu
geringe, uni dem Schiffbruch des Sonderbundes nachträg-
lich ein „und doch" entgegenzusetzen. Einzig in Verbin-
dung mit der Hoelzelschule wäre aus dem rheinländischen
Kunstleben eine Künstlergemeinschaft mit den Absichten
des Sonderbundes denkbar.
Betrachtet man ohne diese Erinnerung die Bilder der
Düsseldorfer auf dieser Ausstellung, so erweist sich Jul.
Bretz in seinen Sonnenblumen ohne weiteres als die
reifste Künstlerschaft, E. Jsselmann dagegen als das
stärkste Temperament. Ernst Hardt, Helm. Liesegang,
Heinrich Otto beweisen ihr solides und längst anerkanntes
Können. Hoffnungen erweckt E. Westerfölke nut einem
prachtvoll gemalten Stilleben, während E. M. Kraus
(beides sind Künstlerinnen) mit ihrem Mohn die Grenze
des Kunstgewerblichen streift. Lustig in der Farbe sind
die Batiks von Mar Pauli, rind die Geschwister Schüz
(Friedrich, Hans und Else, Kinder des bekannten Schwa-
benmalers Theodor Schüz) interessieren mit Arbeiten
kleinen Unifanges durch ihre Intimität. Ein Wester-
wälder Mädchen von Lotte Fuchs (Dattenberg) zeigt
einen tüchtig gemalten Kopf,, ein Flötenspieler von Jos.
Bastgen gute bildhauerische Schulung, ebenso der Jagd-
hund von Korschgen und die Arbeiten von H. Nolte
und K. Mohr.
*
*
Karlsruhe tritt, wie gesagt, gegen die andern Kunst-
städte in der Beteiligung auffällig zurück. Von älteren
Künstlern haben sich Conz und Kampmann mit Land-
schaften beteiligt; von den jüngeren zeigt sich Reger mit
seinen „P^rden" am günstigsten, während E. Segewitz
immer noch unruhig auf der Suche ist. Immerhin geben
sich diese beiden als Temperamente, auf die man getrost
eine Hoffnung setzen kann. Von den Trübnerschülern sind
nur A. Grimm rind Hanns Sprung vertreten; es ist
eine wehmütige Erfahrung, wie es keinem der jungen
Künstler dieser ehemals hoffnungsvollen Schule gelingen
will, so recht auf eigene Füße zu kommen. Am ernstesten
sicbtsvollsten Bewegung der
modernen Malerei zu bringen
schien. Die große Kölner Aus-
stellung 1912 wird dafür immer
ein wehmütiges Erinnerungs-
zeichen bleiben.
Freilich, wer mit dieser Er-
innerung die Düsseldorfer Na-
men in der Wiesbadener Aus-
stellung überblickt, wird auf den
Grund des Zusammenbruchs
gewiesen: Julius Bretz, Wal-
ter Ophey und E. Isse l m a n n
sind die einzigen, die etwa an
den Sonderbund erinnern; er
war eine künstliche Gründung,
weil die eigene Kunst der
Gründer (Deußer ausgenom-
men) durchaus nicht im Ein-
klang mit den proklamierten
Tendenzen stand. Wenn man
von Lehmbruck und Nauen
absieht, standen ihm auch sonst
kaum heimatliche Kräfte von
Rang zur Seite; so ist tatsäch-
lich fast keine Spur von einer
Wirkung auf den Nachwuchs
geblieben, jedenfalls eher noch
in Köln, wo sich Greferath
(Abb. 4) neuerdings als ein
starkes Temperament erweist,
als in Düsseldorf selber. Alex.
Bertrand, Joh. G. Drey-
d o r f f, W. H a m b ü ch e n, Ernst
Hardt, H. Liesegang, E.
Nikutowski, H. Otto, A.
Neibmayer, Werner Vogel,
Fritz Westendorp, Schmitz-
A. Babberger: Studienkopf.
Pleiß, um nach dem Katalog
die geläufigen Namen zu nennen: sie alle haben nicht das
mindeste mit den bildkünstlerischen Absichten der Jüngsten
zu tun. Und auch, wenn man sonst nach Namen sucht, ist
die Ernte mit Erbslöh, dem nach München verpflanzten
Barmer, mit Carl Sohn und Werner Heuser eine zu
geringe, uni dem Schiffbruch des Sonderbundes nachträg-
lich ein „und doch" entgegenzusetzen. Einzig in Verbin-
dung mit der Hoelzelschule wäre aus dem rheinländischen
Kunstleben eine Künstlergemeinschaft mit den Absichten
des Sonderbundes denkbar.
Betrachtet man ohne diese Erinnerung die Bilder der
Düsseldorfer auf dieser Ausstellung, so erweist sich Jul.
Bretz in seinen Sonnenblumen ohne weiteres als die
reifste Künstlerschaft, E. Jsselmann dagegen als das
stärkste Temperament. Ernst Hardt, Helm. Liesegang,
Heinrich Otto beweisen ihr solides und längst anerkanntes
Können. Hoffnungen erweckt E. Westerfölke nut einem
prachtvoll gemalten Stilleben, während E. M. Kraus
(beides sind Künstlerinnen) mit ihrem Mohn die Grenze
des Kunstgewerblichen streift. Lustig in der Farbe sind
die Batiks von Mar Pauli, rind die Geschwister Schüz
(Friedrich, Hans und Else, Kinder des bekannten Schwa-
benmalers Theodor Schüz) interessieren mit Arbeiten
kleinen Unifanges durch ihre Intimität. Ein Wester-
wälder Mädchen von Lotte Fuchs (Dattenberg) zeigt
einen tüchtig gemalten Kopf,, ein Flötenspieler von Jos.
Bastgen gute bildhauerische Schulung, ebenso der Jagd-
hund von Korschgen und die Arbeiten von H. Nolte
und K. Mohr.
*
*
Karlsruhe tritt, wie gesagt, gegen die andern Kunst-
städte in der Beteiligung auffällig zurück. Von älteren
Künstlern haben sich Conz und Kampmann mit Land-
schaften beteiligt; von den jüngeren zeigt sich Reger mit
seinen „P^rden" am günstigsten, während E. Segewitz
immer noch unruhig auf der Suche ist. Immerhin geben
sich diese beiden als Temperamente, auf die man getrost
eine Hoffnung setzen kann. Von den Trübnerschülern sind
nur A. Grimm rind Hanns Sprung vertreten; es ist
eine wehmütige Erfahrung, wie es keinem der jungen
Künstler dieser ehemals hoffnungsvollen Schule gelingen
will, so recht auf eigene Füße zu kommen. Am ernstesten