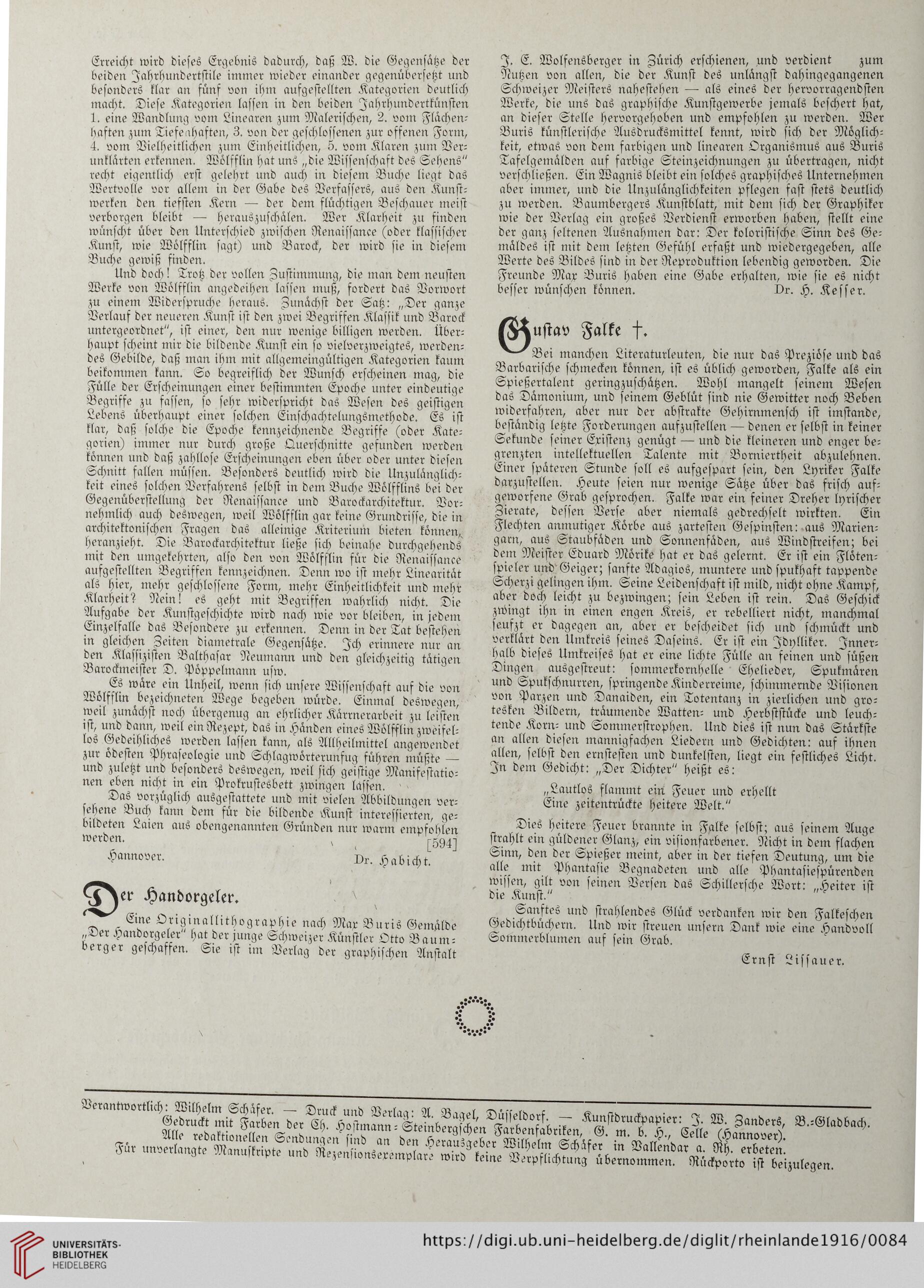Erreicht wird dieses Ergebnis dadurch, daß W. die Gegensätze der
beiden Iabrbundertsiile immer wieder einander gegenübersetzt und
besonders klar an fünf von ihm aufgestellten Kategorien deutlich
macht. Diese Kategorien lassen in den beiden Iahrhundertkünsten
1. eine Wandlung vom Linearen zum Malerischen, 2. vom Flachem
haften zum Tiefeahaften, 3. von der geschlossenen zur offenen Form,
4. vom Vielheitlichen zum Einheitlichen, 5. vom Klaren zum Ver-
unklärten erkennen. Wölfflin hat uns „die Wissenschaft des Sehens"
recht eigentlich erst gelehrt und auch in diesem Buche liegt das
Wertvolle vor allem in der Gabe des Verfassers, aus den Kunst-
werken den tiefsten Kern — der dem flüchtigen Beschauer meist
verborgen bleibt — herauszuschälen. Wer Klarheit zu finden
wünscht über den Unterschied zwischen Renaissance (oder klassischer
Kunst, wie Wölfflin sagt) und Barock, der wird sie in diesem
Buche gewiß finden.
Und doch! Trotz der vollen Zustimmung, die man dem neusten
Werke von Wölfflin angedeihen lassen muß, fordert das Vorwort
zu einem Widerspruche heraus. Zunächst der Satz: „Der ganze
Verlauf der neueren Kunst ist den zwei Begriffen Klassik und Barock
untergeordnet", ist einer, den nur wenige billigen werden. Über-
haupt scheint mir die bildende Kunst ein so vielverzweigtes, werden-
des Gebilde, daß man ihm mit allgemeingültigen Kategorien kaum
beikommen kann. So begreiflich der Wunsch erscheinen mag, die
Fülle der Erscheinungen einer bestimmten Epoche unter eindeutige
Begriffe zu fassen, so sehr widerspricht das Wesen des geistigen
Lebens überhaupt einer solchen Einschachtelungsmethode. Es ist
klar, daß solche die Epoche kennzeichnende Begriffe (oder Kate-
gorien) immer nur durch große Querschnitte gefunden werden
können und daß zahllose Erscheinungen eben über oder unter diesen
Schnitt fallen müssen. Besonders deutlich wird die Unzulänglich-
keit eines solchen Verfahrens selbst in dem Buche Wölfflins bei der
Gegenüberstellung der Renaissance und Barockarchitektur. Vor-
nehmlich auch deswegen, weil Wölfflin gar keine Grundrisse, die in
architektonischen Fragen das alleinige Kriterium bieten können^
heranzieht. Die Barockarchitektur ließe sich beinahe durchgehends
mit den umgekehrten, also den von Wölfslin für die Renaissance
aufgestellten Begriffen kennzeichnen. Denn wo ist mehr Linearität
als hier, mehr geschlossene Form, mehr Einheitlichkeit und meht
Klarheit? Nein! es geht mit Begriffen wahrlich nicht. Die
Aufgabe der Kunstgeschichte wird nach wie vor bleiben, in jedem
Einzelfalle das Besondere zu erkennen. Denn in der Tat bestehen
in gleichen Zeiten diametrale Gegensätze. Ich erinnere nur an
den Klassizisten Balthasar Neumann und den gleichzeitig tätigen
Barockmeister D. Pöppelmann usw.
Es wäre ein Unheil, wenn sich unsere Wissenschaft auf die von
Wölfflin bezeichneten Wege begeben würde. Einmal deswegen,
weil zunächst noch übergenug an ehrlicher Kärrnerarbeit zu leisten
ist, und dann, weil ein Rezept, das in Händen eines Wölfflin zweifel-
los Gedeihliches werden lassen kann, als Allheilmittel angewendet
zur ödesten Phraseologie und Schlagwörterunfug führen müßte —-
und zuletzt und besonders deswegen, weil sich geistige Manifestatio-
nen eben nicht in ein Prokrustesbett zwingen lassen.
Das vorzüglich ausgestattete und mit vielen Abbildungen ver-
sehene Buch kann dem für die bildende Kunst interessierten, ge-
bildeten Laien aus obengenannten Gründen nur warm empfohlen
werden. , , ^594^
Hannover. vr. Habicht.
Handorgeler.
Eine Originallithographie nach Mar Buris Gemälde
„Der Handorgeler" hat der junge Schweizer Künstler Otto Baum-
berger geschaffen. Sie ist im Verlag der graphischen Anstalt
I. E. Wolfensberger in Zürich erschienen, und verdient zum
Nutzen von allen, die der Kunst des unlängst dahingegangenen
Schweizer Meisters nahestehen —- als eines der hervorragendsten
Werke, die uns das graphische Kunstgewerbe jemals beschert hat,
an dieser Stelle hervorgehoben und empfohlen zu werden.. Wer
Buris künstlerische Ausdrucksmittel kennt, wird sich der Möglich-
keit, etwas von dem farbigen und linearen Organismus aus Buris
Tafelgemälden auf farbige Steinzeichnungen zu übertragen, nicht
verschließen. Ein Wagnis bleibt ein solches graphisches Unternehmen
aber immer, und die Unzulänglichkeiten pflegen fast stets deutlich
zu werden. Baumbergers Kunstblatt, mit dem sich der Graphiker
wie der Verlag ein großes Verdienst erworben haben, stellt eine
der ganz seltenen Ausnahmen dar: Der koloristische Sinn des Ge-
mäldes ist mit dem letzten Gefühl erfaßt und wiedergegeben, alle
Werte des Bildes sind in der Reproduktion lebendig geworden. Die
Freunde Max Buris haben eine Gabe erhalten, wie sie es nicht
besser wünschen können. Dr. H. Kesser.
Gustav Falke
^-^Bei manchen Literaturleuten, die nur das Preziöse und das
Barbarische schmecken können, ist es üblich geworden, Falke als ein
Spießertalent geringzuschätzen. Wohl mangelt seinem Wesen
das Dämonium, und seinem Geblüt sind nie Gewitter noch Beben
widerfahren, aber nur der abstrakte Gehirnmensch ist imstande,
beständig letzte Forderungen aufzustellen — denen er selbst in keiner
Sekunde seiner Existenz genügt — und die kleineren und enger be-
grenzten intellektuellen Talente mit Borniertheit abzulehnen.
Einer späteren Stunde soll es aufgespart sein, den Lyriker Falke
darzustellen. Heute seien nur wenige Sätze über das frisch auf-
geworfene Grab gesprochen. Falke war ein feiner Dreher lyrischer
Zierate, dessen Verse aber niemals gedrechselt wirkten. Ein
Flechten anmutiger Körbe aus zartesten Gespinsten: aus Marien-
garn, aus Staubfäden und Sonnenfäden, aus Windstreifen; bei
dem Meister Eduard Mörike hat er das gelernt. Er ist ein Flöten-
spieler und Geiger; sanfte Adagios, muntere und spukhaft tappende
Scherzi gelingen ihm. Seine Leidenschaft ist mild, nicht ohne Kampf,
aber doch leicht zu bezwingen; sein Leben ist rein. Das Geschick
zwingt ihn in einen engen Kreis, er rebelliert nicht, manchmal
seufzt er dagegen an, aber er bescheidet sich und schmückt und
verklärt den Umkreis seines Daseins. Er ist ein Idylliker. Inner-
halb dieses Umkreises hat er eine lichte Fülle an feinen und süßen
Dingen ausgestreut: sommerkornhelle Ehelieder, Spukmären
und Spukschnurren, springende Kinderreime, schimmernde Visionen
von Parzen und Danaiden, ein Totentanz in zierlichen und gro-
tesken Bildern, träumende Watten- und Herbststücke und leuch-
tende Korn- und Sommerstrophen. Und dies ist nun das Stärkste
an allen diesen mannigfachen Liedern und Gedichten: auf ihnen
allen, selbst den ernstesten und dunkelsten, liegt ein festliches Licht.
In dem Gedicht: „Der Dichter" heißt es:
„Lautlos flammt ein Feuer und erhellt
Eine zeitentrückte heitere Welt."
Dies heitere Feuer brannte in Falke selbst; aus seinem Auge
strahlt ein güldener Glanz, ein visionfarbener. Nicht in dem flachen
Sinn, den der Spießer meint, aber in der tiefen Deutung, um die
alle mit Phantasie Begnadeten und alle Phantasiespürenden
wissen, gilt von seinen Versen das Schillersche Wort: „Heiter ist
die Kunst."
Sanftes und strahlendes Glück verdanken wir den Falkeschen
Gedichtbüchern. Und wir streuen unfern Dank wie eine Handvoll
Sommerblumen auf sein Grab.
Ernst Lissauer.
verantwortlich Wilhelm Schäfer. — Druck und Verlag: A. Bagel, Düsseldorf. — Kunstdruckpapier: I. W. Zanders, B.-Gladbach.
Gedruckt nut Farben^der CH. Hostmann - Stembergschen Farbenfabriken, G. m. b. H., Celle (Hannover).
Al e redaktionellen Sendungen smd an den Herausgeber Wilhelm Schäfer in Vallendar a. Rh. erbeten.
,zm unverlangte Manustnpte und Rezensionsexemplare wird keine Verpflichtung übernommen. Rückporto ist beizulegen.
beiden Iabrbundertsiile immer wieder einander gegenübersetzt und
besonders klar an fünf von ihm aufgestellten Kategorien deutlich
macht. Diese Kategorien lassen in den beiden Iahrhundertkünsten
1. eine Wandlung vom Linearen zum Malerischen, 2. vom Flachem
haften zum Tiefeahaften, 3. von der geschlossenen zur offenen Form,
4. vom Vielheitlichen zum Einheitlichen, 5. vom Klaren zum Ver-
unklärten erkennen. Wölfflin hat uns „die Wissenschaft des Sehens"
recht eigentlich erst gelehrt und auch in diesem Buche liegt das
Wertvolle vor allem in der Gabe des Verfassers, aus den Kunst-
werken den tiefsten Kern — der dem flüchtigen Beschauer meist
verborgen bleibt — herauszuschälen. Wer Klarheit zu finden
wünscht über den Unterschied zwischen Renaissance (oder klassischer
Kunst, wie Wölfflin sagt) und Barock, der wird sie in diesem
Buche gewiß finden.
Und doch! Trotz der vollen Zustimmung, die man dem neusten
Werke von Wölfflin angedeihen lassen muß, fordert das Vorwort
zu einem Widerspruche heraus. Zunächst der Satz: „Der ganze
Verlauf der neueren Kunst ist den zwei Begriffen Klassik und Barock
untergeordnet", ist einer, den nur wenige billigen werden. Über-
haupt scheint mir die bildende Kunst ein so vielverzweigtes, werden-
des Gebilde, daß man ihm mit allgemeingültigen Kategorien kaum
beikommen kann. So begreiflich der Wunsch erscheinen mag, die
Fülle der Erscheinungen einer bestimmten Epoche unter eindeutige
Begriffe zu fassen, so sehr widerspricht das Wesen des geistigen
Lebens überhaupt einer solchen Einschachtelungsmethode. Es ist
klar, daß solche die Epoche kennzeichnende Begriffe (oder Kate-
gorien) immer nur durch große Querschnitte gefunden werden
können und daß zahllose Erscheinungen eben über oder unter diesen
Schnitt fallen müssen. Besonders deutlich wird die Unzulänglich-
keit eines solchen Verfahrens selbst in dem Buche Wölfflins bei der
Gegenüberstellung der Renaissance und Barockarchitektur. Vor-
nehmlich auch deswegen, weil Wölfflin gar keine Grundrisse, die in
architektonischen Fragen das alleinige Kriterium bieten können^
heranzieht. Die Barockarchitektur ließe sich beinahe durchgehends
mit den umgekehrten, also den von Wölfslin für die Renaissance
aufgestellten Begriffen kennzeichnen. Denn wo ist mehr Linearität
als hier, mehr geschlossene Form, mehr Einheitlichkeit und meht
Klarheit? Nein! es geht mit Begriffen wahrlich nicht. Die
Aufgabe der Kunstgeschichte wird nach wie vor bleiben, in jedem
Einzelfalle das Besondere zu erkennen. Denn in der Tat bestehen
in gleichen Zeiten diametrale Gegensätze. Ich erinnere nur an
den Klassizisten Balthasar Neumann und den gleichzeitig tätigen
Barockmeister D. Pöppelmann usw.
Es wäre ein Unheil, wenn sich unsere Wissenschaft auf die von
Wölfflin bezeichneten Wege begeben würde. Einmal deswegen,
weil zunächst noch übergenug an ehrlicher Kärrnerarbeit zu leisten
ist, und dann, weil ein Rezept, das in Händen eines Wölfflin zweifel-
los Gedeihliches werden lassen kann, als Allheilmittel angewendet
zur ödesten Phraseologie und Schlagwörterunfug führen müßte —-
und zuletzt und besonders deswegen, weil sich geistige Manifestatio-
nen eben nicht in ein Prokrustesbett zwingen lassen.
Das vorzüglich ausgestattete und mit vielen Abbildungen ver-
sehene Buch kann dem für die bildende Kunst interessierten, ge-
bildeten Laien aus obengenannten Gründen nur warm empfohlen
werden. , , ^594^
Hannover. vr. Habicht.
Handorgeler.
Eine Originallithographie nach Mar Buris Gemälde
„Der Handorgeler" hat der junge Schweizer Künstler Otto Baum-
berger geschaffen. Sie ist im Verlag der graphischen Anstalt
I. E. Wolfensberger in Zürich erschienen, und verdient zum
Nutzen von allen, die der Kunst des unlängst dahingegangenen
Schweizer Meisters nahestehen —- als eines der hervorragendsten
Werke, die uns das graphische Kunstgewerbe jemals beschert hat,
an dieser Stelle hervorgehoben und empfohlen zu werden.. Wer
Buris künstlerische Ausdrucksmittel kennt, wird sich der Möglich-
keit, etwas von dem farbigen und linearen Organismus aus Buris
Tafelgemälden auf farbige Steinzeichnungen zu übertragen, nicht
verschließen. Ein Wagnis bleibt ein solches graphisches Unternehmen
aber immer, und die Unzulänglichkeiten pflegen fast stets deutlich
zu werden. Baumbergers Kunstblatt, mit dem sich der Graphiker
wie der Verlag ein großes Verdienst erworben haben, stellt eine
der ganz seltenen Ausnahmen dar: Der koloristische Sinn des Ge-
mäldes ist mit dem letzten Gefühl erfaßt und wiedergegeben, alle
Werte des Bildes sind in der Reproduktion lebendig geworden. Die
Freunde Max Buris haben eine Gabe erhalten, wie sie es nicht
besser wünschen können. Dr. H. Kesser.
Gustav Falke
^-^Bei manchen Literaturleuten, die nur das Preziöse und das
Barbarische schmecken können, ist es üblich geworden, Falke als ein
Spießertalent geringzuschätzen. Wohl mangelt seinem Wesen
das Dämonium, und seinem Geblüt sind nie Gewitter noch Beben
widerfahren, aber nur der abstrakte Gehirnmensch ist imstande,
beständig letzte Forderungen aufzustellen — denen er selbst in keiner
Sekunde seiner Existenz genügt — und die kleineren und enger be-
grenzten intellektuellen Talente mit Borniertheit abzulehnen.
Einer späteren Stunde soll es aufgespart sein, den Lyriker Falke
darzustellen. Heute seien nur wenige Sätze über das frisch auf-
geworfene Grab gesprochen. Falke war ein feiner Dreher lyrischer
Zierate, dessen Verse aber niemals gedrechselt wirkten. Ein
Flechten anmutiger Körbe aus zartesten Gespinsten: aus Marien-
garn, aus Staubfäden und Sonnenfäden, aus Windstreifen; bei
dem Meister Eduard Mörike hat er das gelernt. Er ist ein Flöten-
spieler und Geiger; sanfte Adagios, muntere und spukhaft tappende
Scherzi gelingen ihm. Seine Leidenschaft ist mild, nicht ohne Kampf,
aber doch leicht zu bezwingen; sein Leben ist rein. Das Geschick
zwingt ihn in einen engen Kreis, er rebelliert nicht, manchmal
seufzt er dagegen an, aber er bescheidet sich und schmückt und
verklärt den Umkreis seines Daseins. Er ist ein Idylliker. Inner-
halb dieses Umkreises hat er eine lichte Fülle an feinen und süßen
Dingen ausgestreut: sommerkornhelle Ehelieder, Spukmären
und Spukschnurren, springende Kinderreime, schimmernde Visionen
von Parzen und Danaiden, ein Totentanz in zierlichen und gro-
tesken Bildern, träumende Watten- und Herbststücke und leuch-
tende Korn- und Sommerstrophen. Und dies ist nun das Stärkste
an allen diesen mannigfachen Liedern und Gedichten: auf ihnen
allen, selbst den ernstesten und dunkelsten, liegt ein festliches Licht.
In dem Gedicht: „Der Dichter" heißt es:
„Lautlos flammt ein Feuer und erhellt
Eine zeitentrückte heitere Welt."
Dies heitere Feuer brannte in Falke selbst; aus seinem Auge
strahlt ein güldener Glanz, ein visionfarbener. Nicht in dem flachen
Sinn, den der Spießer meint, aber in der tiefen Deutung, um die
alle mit Phantasie Begnadeten und alle Phantasiespürenden
wissen, gilt von seinen Versen das Schillersche Wort: „Heiter ist
die Kunst."
Sanftes und strahlendes Glück verdanken wir den Falkeschen
Gedichtbüchern. Und wir streuen unfern Dank wie eine Handvoll
Sommerblumen auf sein Grab.
Ernst Lissauer.
verantwortlich Wilhelm Schäfer. — Druck und Verlag: A. Bagel, Düsseldorf. — Kunstdruckpapier: I. W. Zanders, B.-Gladbach.
Gedruckt nut Farben^der CH. Hostmann - Stembergschen Farbenfabriken, G. m. b. H., Celle (Hannover).
Al e redaktionellen Sendungen smd an den Herausgeber Wilhelm Schäfer in Vallendar a. Rh. erbeten.
,zm unverlangte Manustnpte und Rezensionsexemplare wird keine Verpflichtung übernommen. Rückporto ist beizulegen.