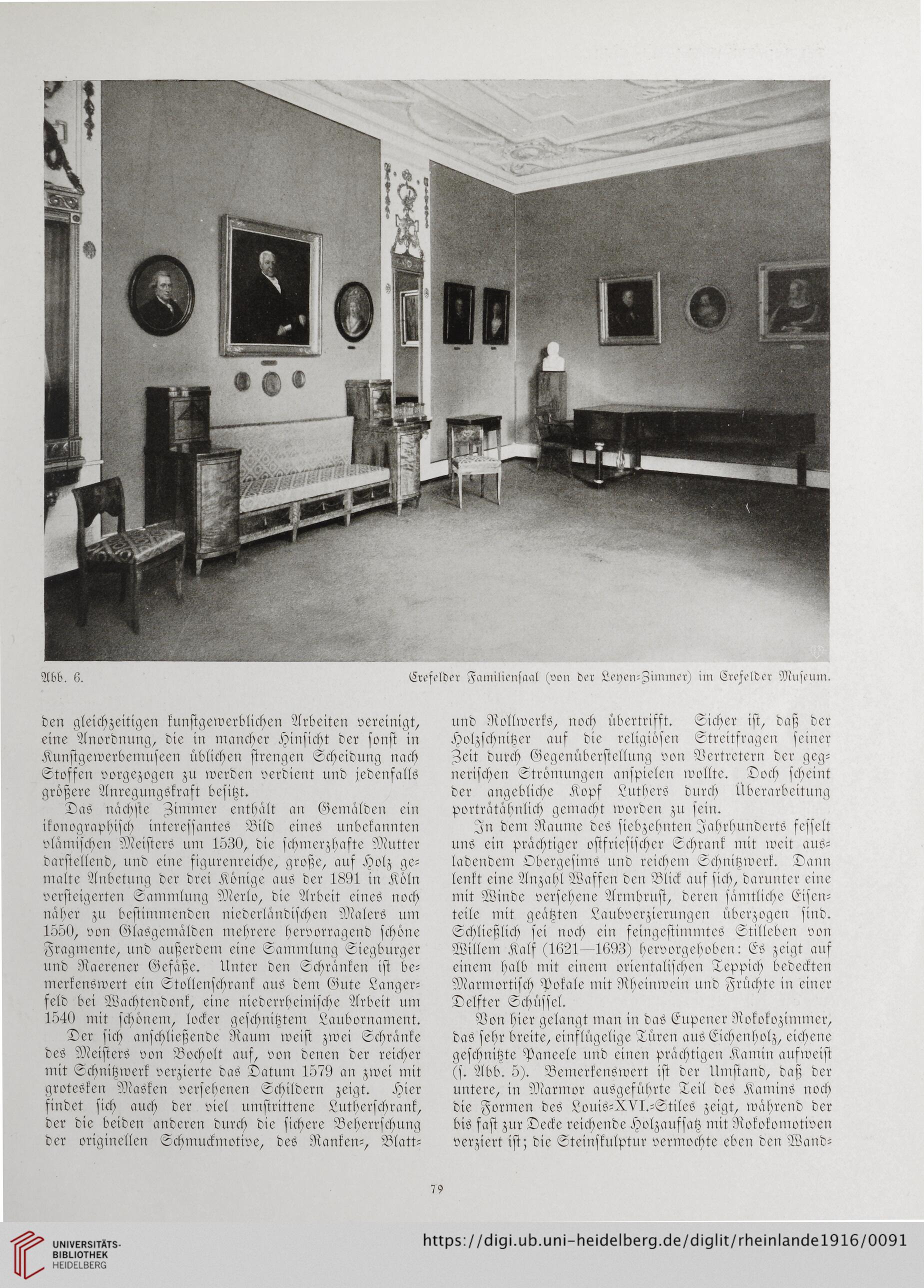Abb. 6. Crefelder Familiensaal (von der Leyen-Zimmer) im Crefelder Museum.
den gleichzeitigen kunstgewerblichen Arbeiten vereinigt,
eine Anordnung, die in mancher Hinsicht der sonst in
Kunstgewerbemuseen üblichen strengen Scheidung nach
Stoffen vorgezogen zu werden verdient und jedenfalls
größere Anregungskraft besitzt.
Das nächste Zimmer enthält an Gemälden ein
ikonographisch interessantes Bild eines unbekannten
vlämischen Meisters uni 1530, die schmerzhafte Mutter
darstellend, und eine figurenreiche, große, auf Holz ge-
malte Anbetung der drei Könige aus der 1891 in Köln
versteigerten Sammlung Merlo, die Arbeit eines noch
näher zu bestimmenden niederländischen Malers um
1550, von Glasgemälden mehrere hervorragend schöne
Fragmente, und außerdem eine Sammlung Siegburger
und Raerener Gefäße. Unter den Schränken ist be-
merkenswert ein Stollenschrank aus dem Gute Länger-
feld bei Wachtendonk, eine niederrheinische Arbeit um
1540 mit schönem, locker geschnitztem Laubornament.
Der sich anschließende Raum weist zwei Schränke
des Meisters von Bocholt auf, von denen der reicher
mit Schnitzwerk verzierte das Datum 1579 an zwei mit
grotesken Masken versehenen Schildern zeigt. Hier
findet sich auch der viel umstrittene Lutherschrank,
der die beiden anderen durch die sichere Beherrschung
der originellen Schmuckmotive, des Ranken-, Blatt-
und Rollwerks, noch übertrifft. Sicher ist, daß der
Holzschnitzer auf die religiösen Streitfragen seiner
Zeit durch Gegenüberstellung von Vertretern der geg-
nerischen Strömungen anspielen wollte. Doch scheint
der angebliche Kopf Luthers durch Überarbeitung
porträtähnlich gemacht worden zu sein.
In dem Raume des siebzehnten Jahrhunderts fesselt
uns ein prächtiger ostfriesischer Schrank mit weit aus-
ladenden! Obergesims und reichem Schnitzwerk. Dann
lenkt eine Anzahl Waffen den Blick auf sich, darunter eine
mit Winde versehene Armbrust, deren sämtliche Eisen-
teile mit geätzten Laubverzierungen überzogen sind.
Schließlich sei noch ein feingestimmtes Stillcben von
Willem Kalf (1621—1693) hervorgehoben: Es zeigt auf
einem halb mit einem orientalischen Teppich bedeckten
Marmortisch Pokale mit Rheinwein und Früchte in einer
Delfter Schüssel.
Von hier gelangt man in das Eupener Nokokozimmer,
das sehr breite, einflügelige Türen aus Eichenholz, eichene
geschnitzte Paneele und einen prächtigen Kamin aufweist
(s. Abb. 5). Bemerkenswert ist der Umstand, daß der
untere, in Marmor ausgeführte Teil des Kamins noch
die Formen des Louis-XVI.-Stiles zeigt, während der
bis fast zur Decke reichende Holzaufsatz mit Nokokomotiven
verziert ist; die Steinskulptur vermochte eben den Wand-
den gleichzeitigen kunstgewerblichen Arbeiten vereinigt,
eine Anordnung, die in mancher Hinsicht der sonst in
Kunstgewerbemuseen üblichen strengen Scheidung nach
Stoffen vorgezogen zu werden verdient und jedenfalls
größere Anregungskraft besitzt.
Das nächste Zimmer enthält an Gemälden ein
ikonographisch interessantes Bild eines unbekannten
vlämischen Meisters uni 1530, die schmerzhafte Mutter
darstellend, und eine figurenreiche, große, auf Holz ge-
malte Anbetung der drei Könige aus der 1891 in Köln
versteigerten Sammlung Merlo, die Arbeit eines noch
näher zu bestimmenden niederländischen Malers um
1550, von Glasgemälden mehrere hervorragend schöne
Fragmente, und außerdem eine Sammlung Siegburger
und Raerener Gefäße. Unter den Schränken ist be-
merkenswert ein Stollenschrank aus dem Gute Länger-
feld bei Wachtendonk, eine niederrheinische Arbeit um
1540 mit schönem, locker geschnitztem Laubornament.
Der sich anschließende Raum weist zwei Schränke
des Meisters von Bocholt auf, von denen der reicher
mit Schnitzwerk verzierte das Datum 1579 an zwei mit
grotesken Masken versehenen Schildern zeigt. Hier
findet sich auch der viel umstrittene Lutherschrank,
der die beiden anderen durch die sichere Beherrschung
der originellen Schmuckmotive, des Ranken-, Blatt-
und Rollwerks, noch übertrifft. Sicher ist, daß der
Holzschnitzer auf die religiösen Streitfragen seiner
Zeit durch Gegenüberstellung von Vertretern der geg-
nerischen Strömungen anspielen wollte. Doch scheint
der angebliche Kopf Luthers durch Überarbeitung
porträtähnlich gemacht worden zu sein.
In dem Raume des siebzehnten Jahrhunderts fesselt
uns ein prächtiger ostfriesischer Schrank mit weit aus-
ladenden! Obergesims und reichem Schnitzwerk. Dann
lenkt eine Anzahl Waffen den Blick auf sich, darunter eine
mit Winde versehene Armbrust, deren sämtliche Eisen-
teile mit geätzten Laubverzierungen überzogen sind.
Schließlich sei noch ein feingestimmtes Stillcben von
Willem Kalf (1621—1693) hervorgehoben: Es zeigt auf
einem halb mit einem orientalischen Teppich bedeckten
Marmortisch Pokale mit Rheinwein und Früchte in einer
Delfter Schüssel.
Von hier gelangt man in das Eupener Nokokozimmer,
das sehr breite, einflügelige Türen aus Eichenholz, eichene
geschnitzte Paneele und einen prächtigen Kamin aufweist
(s. Abb. 5). Bemerkenswert ist der Umstand, daß der
untere, in Marmor ausgeführte Teil des Kamins noch
die Formen des Louis-XVI.-Stiles zeigt, während der
bis fast zur Decke reichende Holzaufsatz mit Nokokomotiven
verziert ist; die Steinskulptur vermochte eben den Wand-