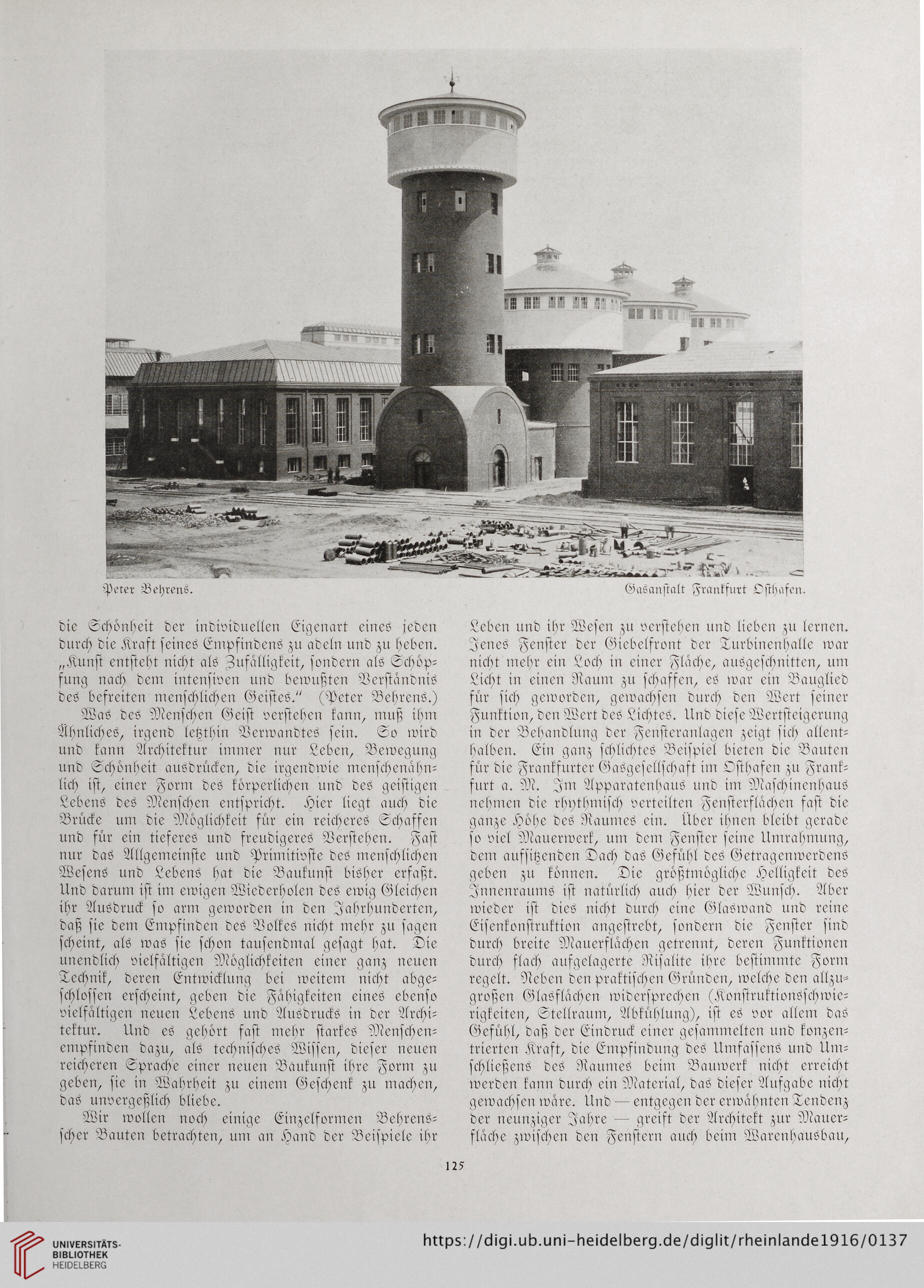die Schönheit der individuellen Eigenart eines jeden
durch die Kraft seines Empfindens zu adeln und zu heben.
„Kunst entsteht nicht als -Zufälligkeit, sondern als Schöp-
fung nach dem intensiven und bewußten Verständnis
des befreiten menschlichen Geistes." (Peter Behrens.)
Was des Menschen Geist verstehen kann, muß ihm
Ähnliches, irgend letzthin Verwandtes sein. So wird
und kann Architektur immer nur Leben, Bewegung
und Schönheit ausdrücken, die irgendwie menschenähn-
lich ist, einer Form des körperlichen und des geistigen
Lebens des Menschen entspricht. Hier liegt auch die
Brücke um die Möglichkeit für ein reicheres Schaffen
und für ein tieferes und freudigeres Verstehen. Fast
nur das Allgemeinste und Primitivste des menschlichen
Wesens und Lebens hat die Baukunst bisher erfaßt.
Und darum ist im ewigen Wiederholen des ewig Gleichen
ihr Ausdruck so arm geworden in den Jahrhunderten,
daß sie dem Empfinden des Volkes nicht mehr zu sagen
scheint, als was sie schon tausendmal gesagt hat. Die
unendlich vielfältigen Möglichkeiten einer ganz neuen
Technik, deren Entwicklung bei weitern nicht abge-
schlossen erscheint, geben die Fähigkeiten eines ebenso
vielfältigen neuen Lebens und Ausdrucks in der Archi-
tektur. Und es gehört fast mehr starkes Menschen-
empfinden dazu, als technisches Wissen, dieser neuen
reicheren Sprache einer neuen Baukunst ihre Form zu
geben, sie in Wahrheit zu einem Geschenk zu machen,
das unvergeßlich bliebe.
Wir wollen noch einige Einzelformen Behrens-
scher Bauten betrachten, um an Hand der Beispiele ihr
Leben und ihr Wesen zu verstehen und lieben zu lernen.
Jenes Fenster der Giebelfront der Turbinenhalle war
nicht mehr ein Loch in einer Fläche, ausgeschnitten, um
Licht in einen Nauru zu schaffen, es war ein Bauglied
für sich geworden, gewachsen durch den Wert seiner
Funktion, den Wert des Lichtes. Und diese Wertsteigerung
in der Behandlung der Fensteranlagen zeigt sich allent-
halben. Ein ganz schlichtes Beispiel bieten die Bauten
für die Frankfurter Gasgesellschaft im Osthafen zu Frank-
furt a. M. Im Apparatenhaus und im Maschinenhaus
nehmen die rhythmisch verteilten Fensterflächen fast die
ganze Höhe des Raumes ein. Über ihnen bleibt gerade
so viel Mauerwerk, um dem Fenster seine Umrahmung,
dem aufsitzenden Dach das Gefühl des Getragenwerdens
geben zu können. Die größtmögliche Helligkeit des
Jnncnraums ist natürlich auch hier der Wunsch. Aber
wieder ist dies nicht durch eine Glaswand und reine
Eisenkonstruktion angestrebt, sondern die Fenster sind
durch breite Mauerflächen getrennt, deren Funktionen
durch flach aufgelagerte Risalite ihre bestimmte Form
regelt. Neben den praktischen Gründen, welche den allzu-
großen Glasflächen widersprechen (Konstruktionsschwie-
rigkciten, Stellraum, Abkühlung), ist es vor allem das
Gefühl, daß der Eindruck einer gesammelten und konzen-
trierten Kraft, die Empfindung des Umfassens und Um-
schließens des Raumes beim Bauwerk nicht erreicht
werden kann durch ein Material, das dieser Aufgabe nicht
gewachsen wäre. Und — entgegen der erwähnten Tendenz
der neunziger Jahre — greift der Architekt zur Mauer-
fläche zwischen den Fenstern auch beim Warenhausbau,
125