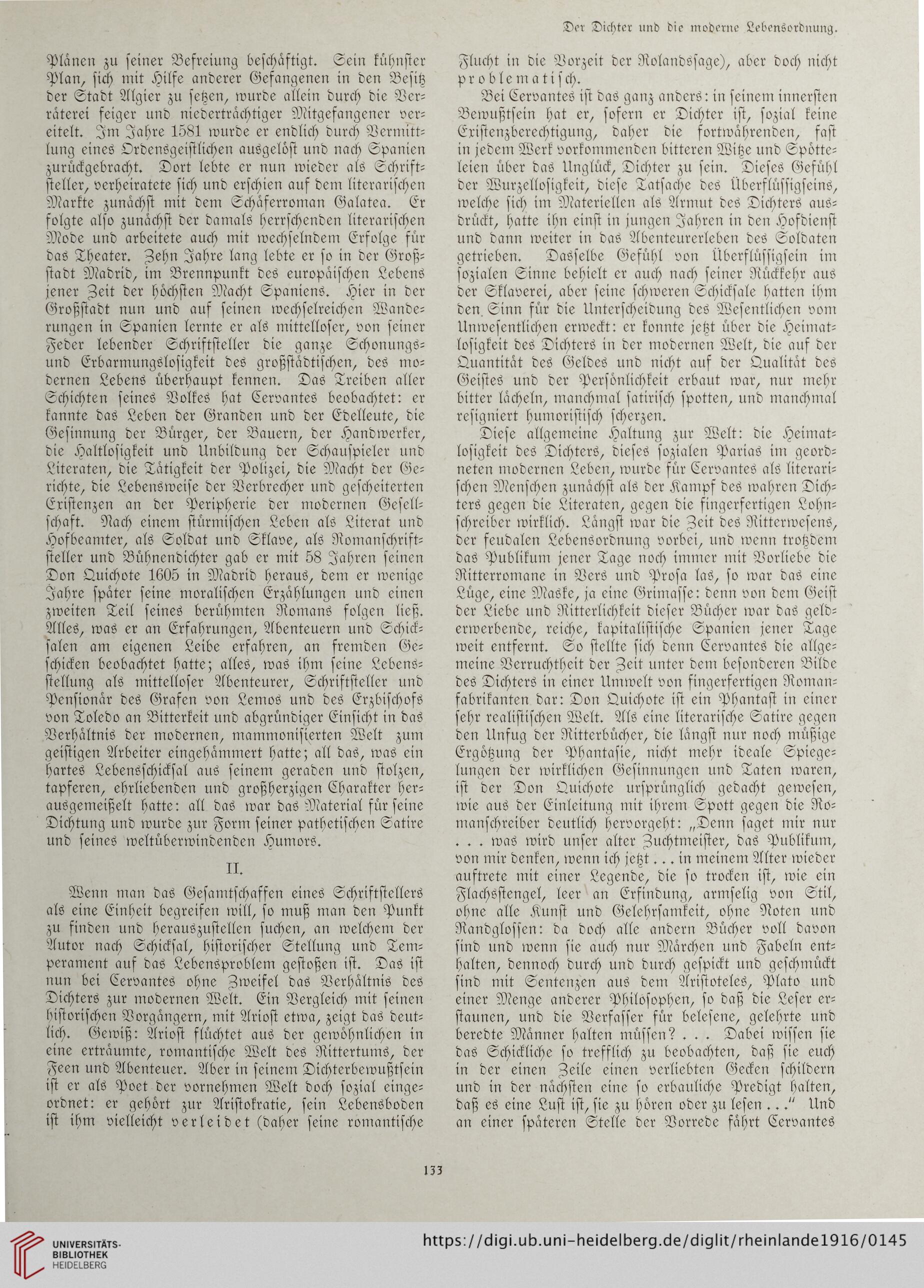Der Dichter und die moderne Lebensordnung.
Plänen zu seiner Befreiung beschäftigt. Sein kühnster
Plan, sich mit Hilfe anderer Gefangenen in den Besitz
der Stadt Algier zu setzen, wurde allein durch die Ver-
räterei feiger und niederträchtiger Mitgefangener ver-
eitelt. Im Jahre 1581 wurde er endlich durch Vermitt-
lung eines Ordensgeistlichen ausgelöst und nach Spanien
zurückgebracht. Dort lebte er nun wieder als Schrift-
steller, verheiratete sich und erschien auf dem literarischen
Markte zunächst mit dem Schäferroman Galatea. Er
folgte also zunächst der damals herrschenden literarischen
Mode und arbeitete auch mit wechselndem Erfolge für
das Theater. Zehn Jahre lang lebte er so in der Groß-
stadt Madrid, im Brennpunkt des europäischen Lebens
jener Zeit der höchsten Macht Spaniens. Hier in der
Großstadt nun und auf seinen wechselreichen Wande-
rungen in Spanien lernte er als mittelloser, von seiner
Feder lebender Schriftsteller die ganze Schonungs-
und Erbarmungslosigkeit des großstädtischen, des mo-
dernen Lebens überhaupt kennen. Das Treiben aller
Schichten seines Volkes hat Cervantes beobachtet: er-
kannte das Leben der Granden und der Edelleute, die
Gesinnung der Bürger, der Bauern, der Handwerker,
die Haltlosigkeit und Unbildung der Schauspieler und
Literaten, die Tätigkeit der Polizei, die Macht der Ge-
richte, die Lebensweise der Verbrecher und gescheiterten
Existenzen an der Peripherie der modernen Gesell-
schaft. Nach einem stürmischen Leben als Literat und
Hofbeamter, als Soldat und Sklave, als Nomanschrift-
steller und Bühnendichter gab er mit 58 Jahren seinen
Don Quichote 1605 in Madrid heraus, dem er wenige
Jahre später seine moralischen Erzählungen und einen
zweiten Teil seines berühmten Romans folgen ließ.
Alles, was er an Erfahrungen, Abenteuern und Schick-
salen am eigenen Leibe erfahren, an fremden Ge-
schicken beobachtet hatte; alles, was ihm seine Lebens-
stellung als mittelloser Abenteurer, Schriftsteller und
Pensionär des Grafen von Lemos und des Erzbischofs
von Toledo an Bitterkeit und abgründiger Einsicht in das
Verhältnis der modernen, mammonisierten Welt zum
geistigen Arbeiter eingehämmert hatte; all das, was ein
hartes Lebensschicksal aus seinem geraden und stolzen,
tapferen, ehrliebenden und großherzigen Charakter her-
ausgemeißelt hatte: all das war das Material für seine
Dichtung und wurde zur Form seiner pathetischen Satire
und seines weltüberwindenden Humors.
II.
Wenn man das Gesamtschaffen eines Schriftstellers
als eine Einheit begreifen will, so muß man den Punkt
zu finden und herauszustellen suchen, an welchem der
Autor nach Schicksal, historischer Stellung und Tem-
perament auf das Lebensproblem gestoßen ist. Das ist
nun bei Cervantes ohne Zweifel das Verhältnis des
Dichters zur modernen Welt. Ein Vergleich mit seinen
historischen Vorgängern, mit Ariost etwa, zeigt das deut-
lich. Gewiß: Ariost flüchtet aus der gewöhnlichen in
eine erträumte, romantische Welt des Rittertums, der
Feen und Abenteuer. Aber in seinem Dichterbewußtsein
ist er als Poet der vornehmen Welt doch sozial einge-
ordnet: er gehört zur Aristokratie, sein Lebensboden
ist ihm vielleicht verleidet (daher seine romantische
IZZ
Flucht in die Vorzeit der Rolandssage), aber doch nicht
problematisch.
Bei Cervantes ist das ganz anders: in seinem innersten
Bewußtsein hat er, sofern er Dichter ist, sozial keine
Existenzberechtigung, daher die fortwährenden, fast
in jedem Werk vorkommenden bitteren Witze und Spötte-
leien über das Unglück, Dichter zu sein. Dieses Gefühl
der Wurzellosigkeit, diese Tatsache des Überflüssigseins,
welche sich im Materiellen als Armut des Dichters aus-
drückt, hatte ihn einst in jungen Jahren in den Hofdienst
und dann weiter in das Abenteurerleben des Soldaten
getrieben. Dasselbe Gefühl von Überflüssigsein im
sozialen Sinne behielt er auch nach seiner Rückkehr aus
der Sklaverei, aber seine schweren Schicksale hatten ihm
den. Sinn für die Unterscheidung des Wesentlichen von:
Unwesentlichen erweckt: er konnte jetzt über die Heimat-
losigkeit des Dichters in der modernen Welt, die auf der
Quantität des Geldes und nicht auf der Qualität des
Geistes und der Persönlichkeit erbaut war, nur mehr-
bitter lächeln, manchmal satirisch spotten, und manchmal
resigniert humoristisch scherzen.
Diese allgemeine Haltung zur Welt: die Heimat-
losigkeit des Dichters, dieses sozialen Parias im geord-
neten modernen Leben, wurde für Cervantes als literari-
schen Menschen zunächst als der Kampf des wahren Dich-
ters gegen die Literaten, gegen die fingerfertigen Lohn-
schreiber wirklich. Längst war die Zeit des Ritterwesens,
der feudalen Lebensordnung vorbei, und wenn trotzdem
das Publikum jener Tage noch immer nut Vorliebe die
Nitterromane in Vers und Prosa las, so war das eine
Lüge, eine Maske, ja eine Grimasse: denn von dem Geist
der Liebe und Ritterlichkeit dieser Bücher war das geld-
erwerbende, reiche, kapitalistische Spanien jener Tage
weit entfernt. So stellte sich denn Cervantes die allge-
meine Verruchtheit der Zeit unter dem besonderen Bilde
des Dichters in einer Umwelt von fingerfertigen Noman-
fabrikanten dar: Don Quichote ist ein Phantast in einer
sehr realistischen Welt. Als eine literarische Satire gegen
den Unfug der Ritterbücher, die längst nur noch müßige
Ergötzung der Phantasie, nicht mehr ideale Spiege-
lungen der wirklichen Gesinnungen und Taten waren,
ist der Don Quichote ursprünglich gedacht gewesen,
wie aus der Einleitung mit ihrem Spott gegen die Ro-
manschreiber deutlich hervorgeht: „Denn saget mir nur
. . . was wird unser alter Zuchtmeister, das Publikum,
von mir denken, wenn ich jetzt... in meinem Alter wieder
auftrete mit einer Legende, die so trocken ist, wie ein
Flachsstengel, leer an Erfindung, armselig von Stil,
ohne alle Kunst und Gelehrsamkeit, ohne Noten und
Randglossen: da doch alle andern Bücher voll davon
sind und wenn sie auch nur Märchen und Fabeln ent-
halten, dennoch durch und durch gespickt und geschmückt
sind mit Sentenzen aus dem Aristoteles, Plato und
einer Menge anderer Philosophen, so daß die Leser er-
staunen, und die Verfasser für belesene, gelehrte und
beredte Männer halten müssen? . . . Dabei wissen sie
das Schickliche so trefflich zu beobachten, daß sie euch
in der einen Zeile einen verliebten Gecken schildern
und in der nächsten eine so erbauliche Predigt ballen,
daß es eine Lust ist, sie zu hören oder zu lesen ..." Und
an einer späteren Stelle der Vorrede fährt Cervantes
Plänen zu seiner Befreiung beschäftigt. Sein kühnster
Plan, sich mit Hilfe anderer Gefangenen in den Besitz
der Stadt Algier zu setzen, wurde allein durch die Ver-
räterei feiger und niederträchtiger Mitgefangener ver-
eitelt. Im Jahre 1581 wurde er endlich durch Vermitt-
lung eines Ordensgeistlichen ausgelöst und nach Spanien
zurückgebracht. Dort lebte er nun wieder als Schrift-
steller, verheiratete sich und erschien auf dem literarischen
Markte zunächst mit dem Schäferroman Galatea. Er
folgte also zunächst der damals herrschenden literarischen
Mode und arbeitete auch mit wechselndem Erfolge für
das Theater. Zehn Jahre lang lebte er so in der Groß-
stadt Madrid, im Brennpunkt des europäischen Lebens
jener Zeit der höchsten Macht Spaniens. Hier in der
Großstadt nun und auf seinen wechselreichen Wande-
rungen in Spanien lernte er als mittelloser, von seiner
Feder lebender Schriftsteller die ganze Schonungs-
und Erbarmungslosigkeit des großstädtischen, des mo-
dernen Lebens überhaupt kennen. Das Treiben aller
Schichten seines Volkes hat Cervantes beobachtet: er-
kannte das Leben der Granden und der Edelleute, die
Gesinnung der Bürger, der Bauern, der Handwerker,
die Haltlosigkeit und Unbildung der Schauspieler und
Literaten, die Tätigkeit der Polizei, die Macht der Ge-
richte, die Lebensweise der Verbrecher und gescheiterten
Existenzen an der Peripherie der modernen Gesell-
schaft. Nach einem stürmischen Leben als Literat und
Hofbeamter, als Soldat und Sklave, als Nomanschrift-
steller und Bühnendichter gab er mit 58 Jahren seinen
Don Quichote 1605 in Madrid heraus, dem er wenige
Jahre später seine moralischen Erzählungen und einen
zweiten Teil seines berühmten Romans folgen ließ.
Alles, was er an Erfahrungen, Abenteuern und Schick-
salen am eigenen Leibe erfahren, an fremden Ge-
schicken beobachtet hatte; alles, was ihm seine Lebens-
stellung als mittelloser Abenteurer, Schriftsteller und
Pensionär des Grafen von Lemos und des Erzbischofs
von Toledo an Bitterkeit und abgründiger Einsicht in das
Verhältnis der modernen, mammonisierten Welt zum
geistigen Arbeiter eingehämmert hatte; all das, was ein
hartes Lebensschicksal aus seinem geraden und stolzen,
tapferen, ehrliebenden und großherzigen Charakter her-
ausgemeißelt hatte: all das war das Material für seine
Dichtung und wurde zur Form seiner pathetischen Satire
und seines weltüberwindenden Humors.
II.
Wenn man das Gesamtschaffen eines Schriftstellers
als eine Einheit begreifen will, so muß man den Punkt
zu finden und herauszustellen suchen, an welchem der
Autor nach Schicksal, historischer Stellung und Tem-
perament auf das Lebensproblem gestoßen ist. Das ist
nun bei Cervantes ohne Zweifel das Verhältnis des
Dichters zur modernen Welt. Ein Vergleich mit seinen
historischen Vorgängern, mit Ariost etwa, zeigt das deut-
lich. Gewiß: Ariost flüchtet aus der gewöhnlichen in
eine erträumte, romantische Welt des Rittertums, der
Feen und Abenteuer. Aber in seinem Dichterbewußtsein
ist er als Poet der vornehmen Welt doch sozial einge-
ordnet: er gehört zur Aristokratie, sein Lebensboden
ist ihm vielleicht verleidet (daher seine romantische
IZZ
Flucht in die Vorzeit der Rolandssage), aber doch nicht
problematisch.
Bei Cervantes ist das ganz anders: in seinem innersten
Bewußtsein hat er, sofern er Dichter ist, sozial keine
Existenzberechtigung, daher die fortwährenden, fast
in jedem Werk vorkommenden bitteren Witze und Spötte-
leien über das Unglück, Dichter zu sein. Dieses Gefühl
der Wurzellosigkeit, diese Tatsache des Überflüssigseins,
welche sich im Materiellen als Armut des Dichters aus-
drückt, hatte ihn einst in jungen Jahren in den Hofdienst
und dann weiter in das Abenteurerleben des Soldaten
getrieben. Dasselbe Gefühl von Überflüssigsein im
sozialen Sinne behielt er auch nach seiner Rückkehr aus
der Sklaverei, aber seine schweren Schicksale hatten ihm
den. Sinn für die Unterscheidung des Wesentlichen von:
Unwesentlichen erweckt: er konnte jetzt über die Heimat-
losigkeit des Dichters in der modernen Welt, die auf der
Quantität des Geldes und nicht auf der Qualität des
Geistes und der Persönlichkeit erbaut war, nur mehr-
bitter lächeln, manchmal satirisch spotten, und manchmal
resigniert humoristisch scherzen.
Diese allgemeine Haltung zur Welt: die Heimat-
losigkeit des Dichters, dieses sozialen Parias im geord-
neten modernen Leben, wurde für Cervantes als literari-
schen Menschen zunächst als der Kampf des wahren Dich-
ters gegen die Literaten, gegen die fingerfertigen Lohn-
schreiber wirklich. Längst war die Zeit des Ritterwesens,
der feudalen Lebensordnung vorbei, und wenn trotzdem
das Publikum jener Tage noch immer nut Vorliebe die
Nitterromane in Vers und Prosa las, so war das eine
Lüge, eine Maske, ja eine Grimasse: denn von dem Geist
der Liebe und Ritterlichkeit dieser Bücher war das geld-
erwerbende, reiche, kapitalistische Spanien jener Tage
weit entfernt. So stellte sich denn Cervantes die allge-
meine Verruchtheit der Zeit unter dem besonderen Bilde
des Dichters in einer Umwelt von fingerfertigen Noman-
fabrikanten dar: Don Quichote ist ein Phantast in einer
sehr realistischen Welt. Als eine literarische Satire gegen
den Unfug der Ritterbücher, die längst nur noch müßige
Ergötzung der Phantasie, nicht mehr ideale Spiege-
lungen der wirklichen Gesinnungen und Taten waren,
ist der Don Quichote ursprünglich gedacht gewesen,
wie aus der Einleitung mit ihrem Spott gegen die Ro-
manschreiber deutlich hervorgeht: „Denn saget mir nur
. . . was wird unser alter Zuchtmeister, das Publikum,
von mir denken, wenn ich jetzt... in meinem Alter wieder
auftrete mit einer Legende, die so trocken ist, wie ein
Flachsstengel, leer an Erfindung, armselig von Stil,
ohne alle Kunst und Gelehrsamkeit, ohne Noten und
Randglossen: da doch alle andern Bücher voll davon
sind und wenn sie auch nur Märchen und Fabeln ent-
halten, dennoch durch und durch gespickt und geschmückt
sind mit Sentenzen aus dem Aristoteles, Plato und
einer Menge anderer Philosophen, so daß die Leser er-
staunen, und die Verfasser für belesene, gelehrte und
beredte Männer halten müssen? . . . Dabei wissen sie
das Schickliche so trefflich zu beobachten, daß sie euch
in der einen Zeile einen verliebten Gecken schildern
und in der nächsten eine so erbauliche Predigt ballen,
daß es eine Lust ist, sie zu hören oder zu lesen ..." Und
an einer späteren Stelle der Vorrede fährt Cervantes