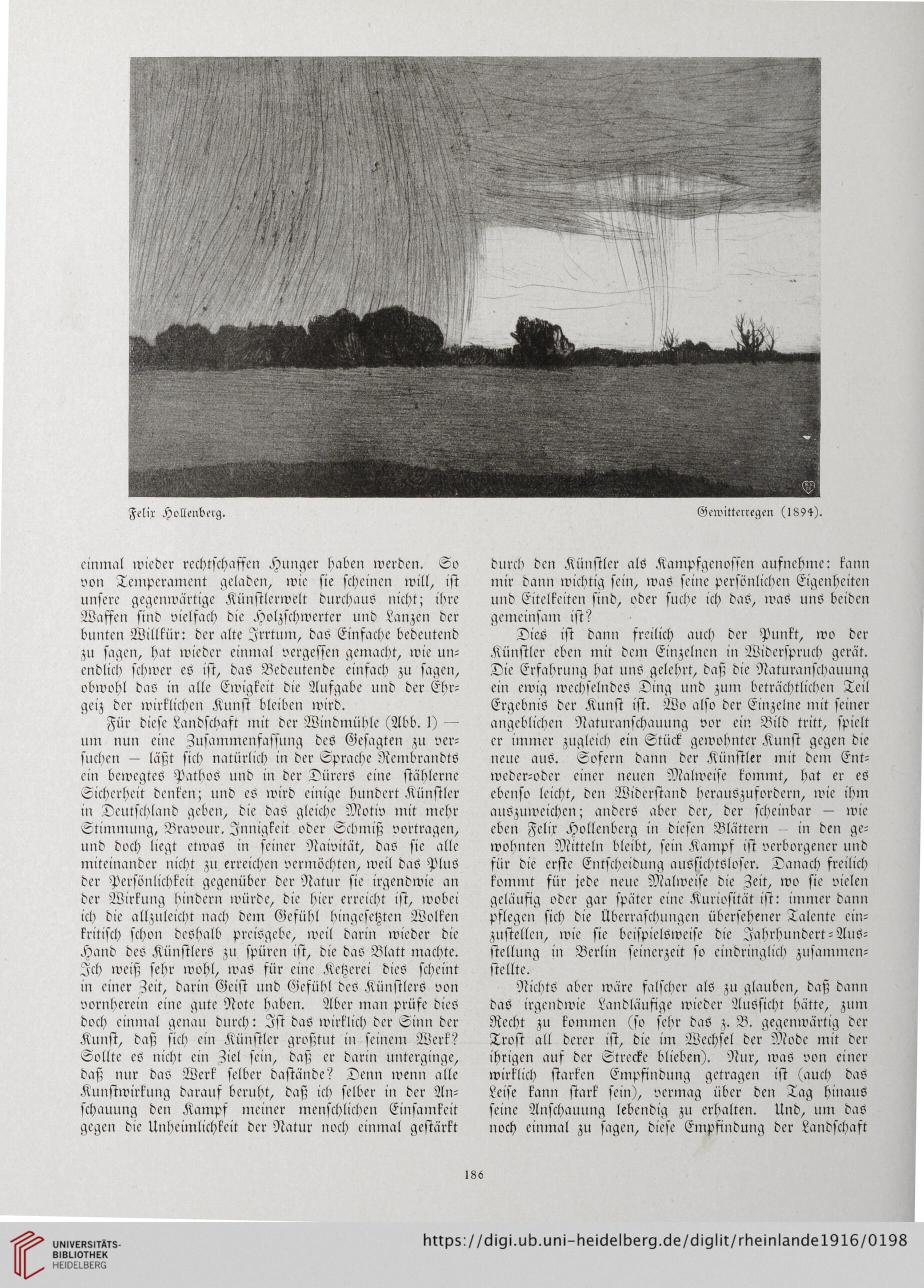Felix Hollenberg. Gewitterregen (1894).
einmal wieder rechtschaffen Hunger haben werden. So
von Temperament geladen, wie sie scheinen will, ist
unsere gegenwärtige Künstlerwelt durchaus nicht; ihre
Waffen sind vielfach die Holzschwerter und Lanzen der
bunten Willkür: der alte Irrtum, das Einfache bedeutend
zu sagen, hat wieder einmal vergessen gemacht, wie un-
endlich schwer es ist, das Bedeutende einfach zu sagen,
obwohl das in alle Ewigkeit die Aufgabe und der Ehr-
geiz der wirklichen Kunst bleiben wird.
Für diese Landschaft mit der Windmüble (Abb. 1) —
um nun eine Zusammenfassung des Gesagten zu ver-
suchen — läßt sich natürlich in der Sprache Rembrandts
ein bewegtes Pathos und in der Dürers eine stählerne
Sicherheit denken; und es wird einige hundert Künstler
in Deutschland geben, die daS gleiche Motiv mit mehr
Stimmung, Bravour. Innigkeit oder Schmiß vortragen,
und doch liegt etwas in seiner Naivität, das sie alle
miteinander nicht zu erreichen vermöchten, weil das PluS
der Persönlichkeit gegenüber der Natur sic irgendwie an
der Wirkung hindern würde, die hier erreicht ist, wobei
ich die allzuleicht nach dem Gefühl hingesctzten Wolken
kritisch schon deshalb preisgebe, weil darin wieder die
Hand des Künstlers zu spüren ist, die das Blatt machte.
Ich weiß sehr wohl, was für eine Ketzerei dies scheint
in einer Zeit, darin Geist und Gefühl deö Künstlers von
vornherein eine gute Note haben. Aber man prüfe dies
doch einmal genau durch: Ist das wirklich der Sinn der
Kunst, daß sich ein Künstler großtut in seinem Werk?
Sollte es nicht ein Ziel sein, daß er darin unterginge,
daß nur daS Werk selber dastände? Denn wenn alle
Kunstwirkung darauf beruht, daß ich selber in der An-
schauung den Kampf meiner menschlichen Einsamkeit
gegen die Unheimlichkeit der Natur noch einmal gestärkt
186
durch den Künstler als Kampfgenossen aufnehme: kann
mir dann wichtig sein, was seine persönlichen Eigenheiten
und Eitelkeiten sind, oder suche ich das, was uns beiden
gemeinsam ist?
Dies ist dann freilich auch der Punkt, wo der
Künstler eben mit dem Einzelnen in Widerspruch gerät.
Die Erfahrung hat uns gelehrt, daß die Naturanschauung
ein ewig wechselndes Ding und zum beträchtlichen Teil
Ergebnis der Kunst ist. Wo also der Einzelne mit seiner
angeblichen Naturanschauung vor ein Bild tritt, spielt
er immer zugleich ein Stück gewohnter Kunst gegen die
neue aus. Sofern dann der Künstler mit dem Ent-
weder-oder einer neuen Malweise kommt, hat er es
ebenso leicht, den Widerstand herauszufordern, wie ihm
auszuweichcn; anders aber der, der scheinbar — wie
eben Fclir Hollenbcrg in diesen Blättern - in den ge-
wohnten Mitteln bleibt, sein Kampf ist verborgener und
für die erste Entscheidung aussichtsloser. Danach freilich
kommt für jede neue Malweise die Zeit, wo sie vielen
geläufig oder gar später eine Kuriosität ist: immer dann
pflegen sich die Überraschungen übersehener Talente ein-
zustellcn, wie sie beispielsweise die Jahrhundert-Aus-
stellung in Berlin seinerzeit so eindringlich zusammen-
stellte.
Nichts aber wäre falscher als zu glauben, daß dann
das irgendwie Landläufige wieder Aussicht hätte, zum
Recht zu kommen (so sehr das z. B. gegenwärtig der
Trost all derer ist, die im Wechsel der Mode mit der
ihrigen auf der Strecke blieben). Nur, was von einer
wirklich starken Empfindung getragen ist (auch das
Leise kann stark sein), vermag über den Tag hinaus
seine Anschauung lebendig zu erhalten. Und, um das
noch einmal zu sagen, diese Empfindung der Landschaft
einmal wieder rechtschaffen Hunger haben werden. So
von Temperament geladen, wie sie scheinen will, ist
unsere gegenwärtige Künstlerwelt durchaus nicht; ihre
Waffen sind vielfach die Holzschwerter und Lanzen der
bunten Willkür: der alte Irrtum, das Einfache bedeutend
zu sagen, hat wieder einmal vergessen gemacht, wie un-
endlich schwer es ist, das Bedeutende einfach zu sagen,
obwohl das in alle Ewigkeit die Aufgabe und der Ehr-
geiz der wirklichen Kunst bleiben wird.
Für diese Landschaft mit der Windmüble (Abb. 1) —
um nun eine Zusammenfassung des Gesagten zu ver-
suchen — läßt sich natürlich in der Sprache Rembrandts
ein bewegtes Pathos und in der Dürers eine stählerne
Sicherheit denken; und es wird einige hundert Künstler
in Deutschland geben, die daS gleiche Motiv mit mehr
Stimmung, Bravour. Innigkeit oder Schmiß vortragen,
und doch liegt etwas in seiner Naivität, das sie alle
miteinander nicht zu erreichen vermöchten, weil das PluS
der Persönlichkeit gegenüber der Natur sic irgendwie an
der Wirkung hindern würde, die hier erreicht ist, wobei
ich die allzuleicht nach dem Gefühl hingesctzten Wolken
kritisch schon deshalb preisgebe, weil darin wieder die
Hand des Künstlers zu spüren ist, die das Blatt machte.
Ich weiß sehr wohl, was für eine Ketzerei dies scheint
in einer Zeit, darin Geist und Gefühl deö Künstlers von
vornherein eine gute Note haben. Aber man prüfe dies
doch einmal genau durch: Ist das wirklich der Sinn der
Kunst, daß sich ein Künstler großtut in seinem Werk?
Sollte es nicht ein Ziel sein, daß er darin unterginge,
daß nur daS Werk selber dastände? Denn wenn alle
Kunstwirkung darauf beruht, daß ich selber in der An-
schauung den Kampf meiner menschlichen Einsamkeit
gegen die Unheimlichkeit der Natur noch einmal gestärkt
186
durch den Künstler als Kampfgenossen aufnehme: kann
mir dann wichtig sein, was seine persönlichen Eigenheiten
und Eitelkeiten sind, oder suche ich das, was uns beiden
gemeinsam ist?
Dies ist dann freilich auch der Punkt, wo der
Künstler eben mit dem Einzelnen in Widerspruch gerät.
Die Erfahrung hat uns gelehrt, daß die Naturanschauung
ein ewig wechselndes Ding und zum beträchtlichen Teil
Ergebnis der Kunst ist. Wo also der Einzelne mit seiner
angeblichen Naturanschauung vor ein Bild tritt, spielt
er immer zugleich ein Stück gewohnter Kunst gegen die
neue aus. Sofern dann der Künstler mit dem Ent-
weder-oder einer neuen Malweise kommt, hat er es
ebenso leicht, den Widerstand herauszufordern, wie ihm
auszuweichcn; anders aber der, der scheinbar — wie
eben Fclir Hollenbcrg in diesen Blättern - in den ge-
wohnten Mitteln bleibt, sein Kampf ist verborgener und
für die erste Entscheidung aussichtsloser. Danach freilich
kommt für jede neue Malweise die Zeit, wo sie vielen
geläufig oder gar später eine Kuriosität ist: immer dann
pflegen sich die Überraschungen übersehener Talente ein-
zustellcn, wie sie beispielsweise die Jahrhundert-Aus-
stellung in Berlin seinerzeit so eindringlich zusammen-
stellte.
Nichts aber wäre falscher als zu glauben, daß dann
das irgendwie Landläufige wieder Aussicht hätte, zum
Recht zu kommen (so sehr das z. B. gegenwärtig der
Trost all derer ist, die im Wechsel der Mode mit der
ihrigen auf der Strecke blieben). Nur, was von einer
wirklich starken Empfindung getragen ist (auch das
Leise kann stark sein), vermag über den Tag hinaus
seine Anschauung lebendig zu erhalten. Und, um das
noch einmal zu sagen, diese Empfindung der Landschaft