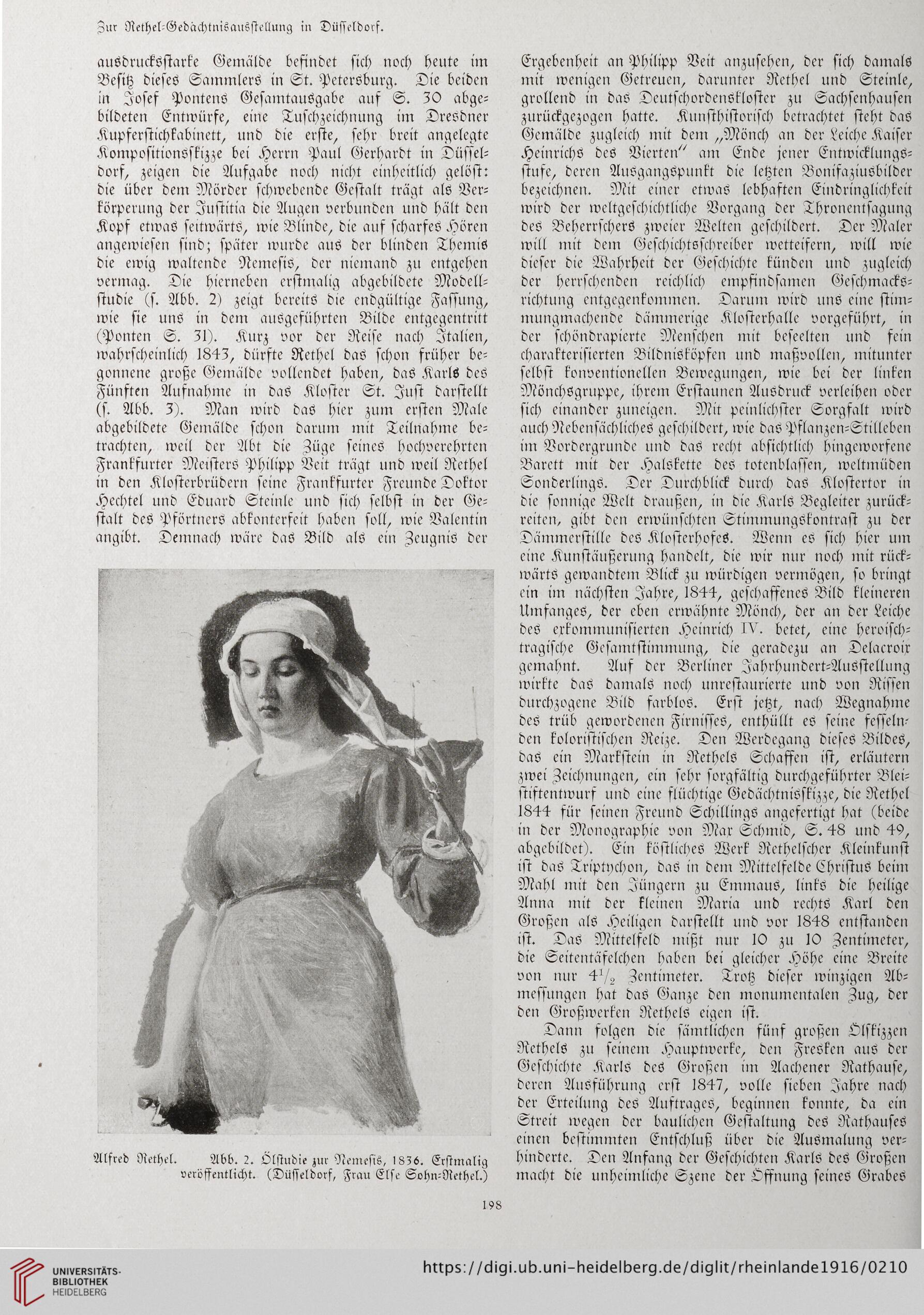Zur Nethel-Gedachtmsausstellung in Düsseldorf.
ausdrucksstarke Gemälde befiudet sich noch heute im
Besitz dieses Sammlers in St. Petersburg. Die beiden
in Josef Pontens Gesamtausgabe aus S. ZO abge-
bildeten Entwürfe, eine Tuschzeichnung im Dresdner
Kupferstichkabinett, und die erste, sehr breit angelegte
Kompositionsskizze bei Herrn Paul Gerhardt in Düssel-
dorf, zeigen die Aufgabe noch nicht einheitlich gelöst:
die über dem Mörder schwebende Gestalt trägt als Ver-
körperung der Justitia die Augen verbunden und hält den
Kopf etwas seitwärts, wie Blinde, die auf scharfes Hören
angewiesen sind; später wurde aus der blinden Themis
die ewig waltende Nemesis, der niemand zu entgehen
vermag. Die hicrneben erstmalig abgebildete Modell-
studie (s. Abb. 2) zeigt bereits die endgültige Fassung,
wie sie uns in dem ausgesührten Bilde entgegentritt
(Ponten S. ZI). Kurz vor der Reise nach Italien,
wahrscheinlich 184Z, dürfte Rethel das schon früher be-
gonnene große Gemälde vollendet haben, das Karls des
Fünften Ausnahme in das Kloster St. Just darstellt
(s. Abb. Z). Man wird das hier zum ersten Male
abgebildete Gemälde schon darum mit Teilnahme be-
trachten, weil der Abt die Züge seines hochverehrten
Frankfurter Meisters Philipp Veit trägt und weil Rethel
in den Klosterbrüdern seine Frankfurter Freunde Doktor
Hechtel und Eduard Stcinle und sich selbst in der Ge-
stalt des Pförtners abkonterfeit haben soll, wie Valentin
angibt. Demnach wäre das Bild als ein Zeugnis der
Alfred Nethel. Abb. 2. Ölstudie zur Nemesis, 18Z6. Erstmalig
veröffentlicht. (Düsseldorf, Frau Else SohmNethel.)
Ergebenheit an Philipp Veit anzusehen, der sich damals
mit wenigen Getreuen, darunter Nethel und Steinle,
grollend in das Deutschordenskloster zu Sachsenhausen
zurückgezogen hatte. Kunsthistorisch betrachtet steht das
Gemälde zugleich mit dem „Mönch an der Leiche Kaiser
Heinrichs des Vierteil" am Ende jener Entwicklungs-
stufe, deren Ausgangspunkt die letzten Bonisaziusbilder
bezeichnen. Mit einer etwas lebhaften Eindringlichkeit
wird der weltgeschichtliche Vorgang der Thronentsagung
des Beherrschers zweier Welten geschildert. Der Maler
will mit dem Geschichtsscbrciber wetteifern, will wie
dieser die Wahrheit der Geschichte künden und zugleich
der herrschenden reichlich empfindsamen Geschmacks-
richtung entgegenkommen. Darum wird uns eine stim-
mungmachende dämmerige Klosterhallc vorgeführt, in
der schöndrapierte Menschen nut beseelteil lind fein
charakterisierten Bildnisköpfen und maßvollen, mitunter
selbst konventionellen Bewegungen, wie bei der linken
MönchSgruppe, ihrem Erstaunen Ausdruck verleihen oder
sich einander zuneigen. Mit peinlichster Sorgfalt wird
auch Nebensächliches geschildert, wie das Pflanzen-Stilleben
im Vordergründe und das recht absichtlich hingeworsene
Barett mit der Halskette des totenblassen, wcltmüden
Sonderlings. Der Durchblick durch das Klostcrtor in
die sonnige Welt draußen, in die Karls Begleiter zurück-
reiten, gibt den erwünschten Stiminungskontrast zu der
Dänlmerstille des Klosterhoses. Wenn es sich hier um
eine Kunstäußerung handelt, die wir nur noch mit rück-
wärts gewandtem Blick zu würdigen vermögen, so bringt
ein im nächsten Jahre, 1844, geschaffenes Bild kleineren
Umfanges, der eben erwähnte Mönch, der an der Leiche
des erkommunisierten Heinrich IV. betet, eine heroisch-
tragische Gesamtstimmung, die geradezu an Delacroir
gemahnt. Aus der Berliner Iahrhuildert-Ausstellung
wirkte das damals noch unrestaurierte lind von Rissen
durchzogene Bild farblos. Erst jetzt, nach Wegnahme
des trüb gewordenen Firmstes, enthüllt es seine fesseln-
den koloristischen Reize. Den Werdegang dieses Bildes,
das ein Markstein in Rethcls Schaffen ist, erläutern
zwei Zeichnungen, ein sehr sorgfältig durchgeführter Blei-
stiftentwurs und eine flüchtige Gedächtnisskizze, die Rethel
1844 für seinen Freund Schillings angefertigt hat (beide
in der Monographie von Mar Schmid, S. 48 und 49,
abgebildet). Ein köstliches Werk Rethelscher Kleinkunst
ist das Triptychon, das in dem Mittelfelde Christus beim
Mahl mit den Jüngern zu Emmaus, links die heilige
Anna mit der kleinen Maria und rechts Karl den
Großen als Heiligen darstellt und vor 1848 entstanden
ist. Das Mittelfeld mißt nur IO zu IO Zentimeter,
die Seitentäfelchen haben bei gleicher Höhe eine Breite
von nur sil-ff? Zentimeter. Trotz dieser winzigen Ab-
messungen hat das Ganze den monumentalen Zug, der
den Großwerken RethelS eigen ist.
Dann folgen die sämtlichen fünf großen Ölskizzen
RethelS zu seinem Hauptwerke, den Fresken aus der
Geschichte Karls des Großen im Aachener Rathause,
deren Ausführung erst 1847, volle sieben Jahre nach
der Erteilung des Auftrages, beginnen konnte, da ein
Streit wegen der baulichen Gestaltung des Rathauses
einen bestimmten Entschluß über die Ausmalung ver-
hinderte. Den Anfang der Geschichten Karls des Großen
macht die unheimliche Szene der Öffnung seines Grabes
1-8
ausdrucksstarke Gemälde befiudet sich noch heute im
Besitz dieses Sammlers in St. Petersburg. Die beiden
in Josef Pontens Gesamtausgabe aus S. ZO abge-
bildeten Entwürfe, eine Tuschzeichnung im Dresdner
Kupferstichkabinett, und die erste, sehr breit angelegte
Kompositionsskizze bei Herrn Paul Gerhardt in Düssel-
dorf, zeigen die Aufgabe noch nicht einheitlich gelöst:
die über dem Mörder schwebende Gestalt trägt als Ver-
körperung der Justitia die Augen verbunden und hält den
Kopf etwas seitwärts, wie Blinde, die auf scharfes Hören
angewiesen sind; später wurde aus der blinden Themis
die ewig waltende Nemesis, der niemand zu entgehen
vermag. Die hicrneben erstmalig abgebildete Modell-
studie (s. Abb. 2) zeigt bereits die endgültige Fassung,
wie sie uns in dem ausgesührten Bilde entgegentritt
(Ponten S. ZI). Kurz vor der Reise nach Italien,
wahrscheinlich 184Z, dürfte Rethel das schon früher be-
gonnene große Gemälde vollendet haben, das Karls des
Fünften Ausnahme in das Kloster St. Just darstellt
(s. Abb. Z). Man wird das hier zum ersten Male
abgebildete Gemälde schon darum mit Teilnahme be-
trachten, weil der Abt die Züge seines hochverehrten
Frankfurter Meisters Philipp Veit trägt und weil Rethel
in den Klosterbrüdern seine Frankfurter Freunde Doktor
Hechtel und Eduard Stcinle und sich selbst in der Ge-
stalt des Pförtners abkonterfeit haben soll, wie Valentin
angibt. Demnach wäre das Bild als ein Zeugnis der
Alfred Nethel. Abb. 2. Ölstudie zur Nemesis, 18Z6. Erstmalig
veröffentlicht. (Düsseldorf, Frau Else SohmNethel.)
Ergebenheit an Philipp Veit anzusehen, der sich damals
mit wenigen Getreuen, darunter Nethel und Steinle,
grollend in das Deutschordenskloster zu Sachsenhausen
zurückgezogen hatte. Kunsthistorisch betrachtet steht das
Gemälde zugleich mit dem „Mönch an der Leiche Kaiser
Heinrichs des Vierteil" am Ende jener Entwicklungs-
stufe, deren Ausgangspunkt die letzten Bonisaziusbilder
bezeichnen. Mit einer etwas lebhaften Eindringlichkeit
wird der weltgeschichtliche Vorgang der Thronentsagung
des Beherrschers zweier Welten geschildert. Der Maler
will mit dem Geschichtsscbrciber wetteifern, will wie
dieser die Wahrheit der Geschichte künden und zugleich
der herrschenden reichlich empfindsamen Geschmacks-
richtung entgegenkommen. Darum wird uns eine stim-
mungmachende dämmerige Klosterhallc vorgeführt, in
der schöndrapierte Menschen nut beseelteil lind fein
charakterisierten Bildnisköpfen und maßvollen, mitunter
selbst konventionellen Bewegungen, wie bei der linken
MönchSgruppe, ihrem Erstaunen Ausdruck verleihen oder
sich einander zuneigen. Mit peinlichster Sorgfalt wird
auch Nebensächliches geschildert, wie das Pflanzen-Stilleben
im Vordergründe und das recht absichtlich hingeworsene
Barett mit der Halskette des totenblassen, wcltmüden
Sonderlings. Der Durchblick durch das Klostcrtor in
die sonnige Welt draußen, in die Karls Begleiter zurück-
reiten, gibt den erwünschten Stiminungskontrast zu der
Dänlmerstille des Klosterhoses. Wenn es sich hier um
eine Kunstäußerung handelt, die wir nur noch mit rück-
wärts gewandtem Blick zu würdigen vermögen, so bringt
ein im nächsten Jahre, 1844, geschaffenes Bild kleineren
Umfanges, der eben erwähnte Mönch, der an der Leiche
des erkommunisierten Heinrich IV. betet, eine heroisch-
tragische Gesamtstimmung, die geradezu an Delacroir
gemahnt. Aus der Berliner Iahrhuildert-Ausstellung
wirkte das damals noch unrestaurierte lind von Rissen
durchzogene Bild farblos. Erst jetzt, nach Wegnahme
des trüb gewordenen Firmstes, enthüllt es seine fesseln-
den koloristischen Reize. Den Werdegang dieses Bildes,
das ein Markstein in Rethcls Schaffen ist, erläutern
zwei Zeichnungen, ein sehr sorgfältig durchgeführter Blei-
stiftentwurs und eine flüchtige Gedächtnisskizze, die Rethel
1844 für seinen Freund Schillings angefertigt hat (beide
in der Monographie von Mar Schmid, S. 48 und 49,
abgebildet). Ein köstliches Werk Rethelscher Kleinkunst
ist das Triptychon, das in dem Mittelfelde Christus beim
Mahl mit den Jüngern zu Emmaus, links die heilige
Anna mit der kleinen Maria und rechts Karl den
Großen als Heiligen darstellt und vor 1848 entstanden
ist. Das Mittelfeld mißt nur IO zu IO Zentimeter,
die Seitentäfelchen haben bei gleicher Höhe eine Breite
von nur sil-ff? Zentimeter. Trotz dieser winzigen Ab-
messungen hat das Ganze den monumentalen Zug, der
den Großwerken RethelS eigen ist.
Dann folgen die sämtlichen fünf großen Ölskizzen
RethelS zu seinem Hauptwerke, den Fresken aus der
Geschichte Karls des Großen im Aachener Rathause,
deren Ausführung erst 1847, volle sieben Jahre nach
der Erteilung des Auftrages, beginnen konnte, da ein
Streit wegen der baulichen Gestaltung des Rathauses
einen bestimmten Entschluß über die Ausmalung ver-
hinderte. Den Anfang der Geschichten Karls des Großen
macht die unheimliche Szene der Öffnung seines Grabes
1-8