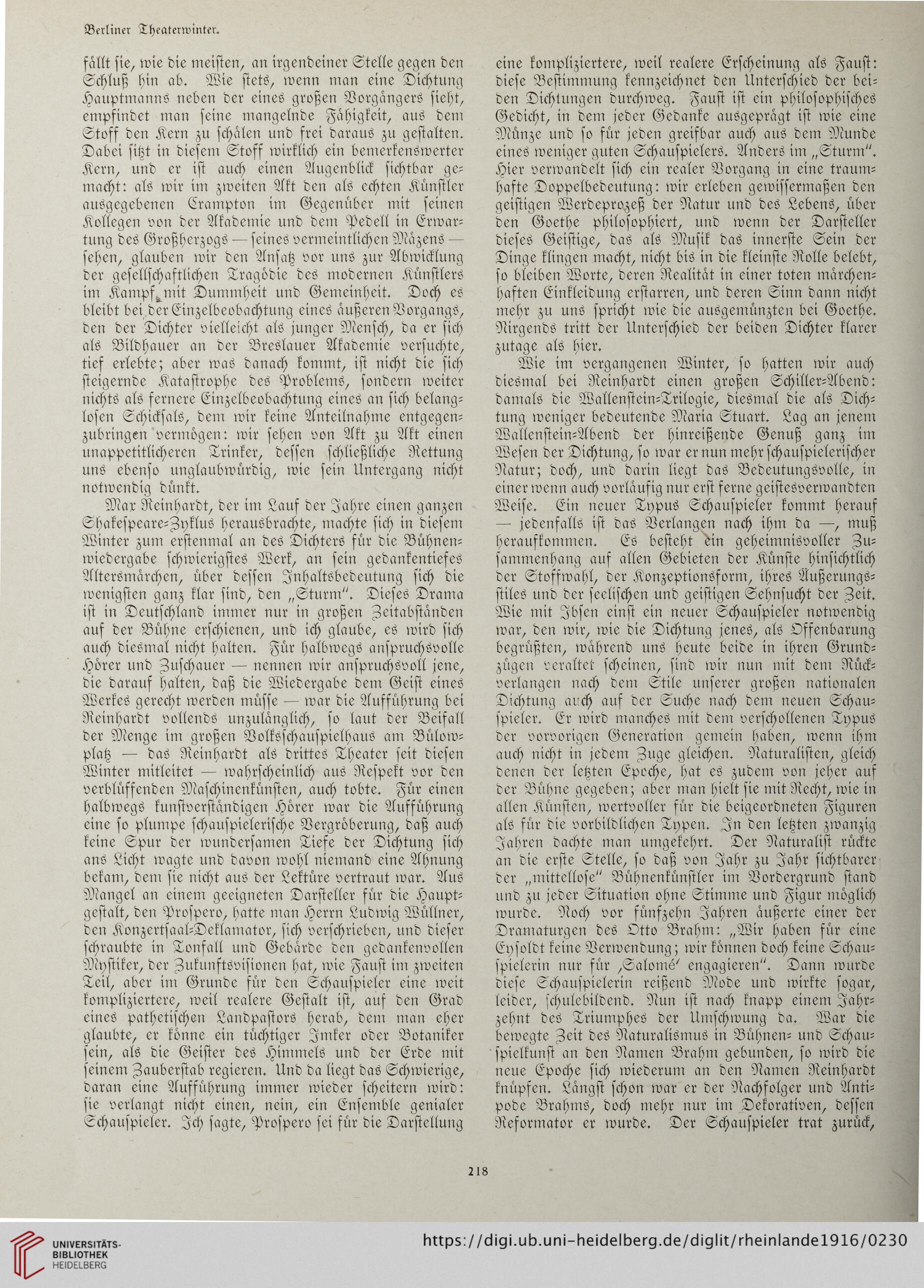Berliner Theaterwinter.
fällt sie, wie die meisten, all irgendeiner Stelle gegen den
Schluß hin ab. Wie stets, wenn man eine Dichtung
Hauptmanns neben der eines großen Vorgängers sieht,
empfindet man seine mangelnde Fähigkeit, aus dem
Stoff den Kern zu schälen und frei daraus zu gestalten.
Dabei sitzt in diesem Stoff wirklich ein bemerkenswerter
Kern, und er ist auch einen Augenblick sichtbar ge-
macht: als wir im zweiten Akt den als echten Künstler
ausgegebenen Crampton im Gegenüber mit seinen
Kollegen von der Akademie und dem Pedell in Erwar-
tung des Großhcrzogs — seines vermeintlichen Mäzens —
sehen, glauben wir den Ansatz vor uns zur Abwicklung
der gesellschaftlichen Tragödie des modernen Künstlers
im Kampf^mit Dummheit und Gemeinheit. Doch es
bleibt bei der Einzelbeobachtung eines äußeren Vorgangs,
den der Dichter vielleicht als junger Mensch, da er sich
als Bildhauer an der Breslauer Akademie versuchte,
tief erlebte; aber was danach kommt, ist nicht die sich
steigernde Katastrophe des Problems, sondern weiter
nichts als fernere Einzelbeobachtung eines an sich belang-
losen Schicksals, dem wir keine Anteilnahme entgegen-
zubringen vermögen: wir sehen von Akt zu Akt einen
unappetitlicheren Trinker, dessen schließliche Rettung
uns ebenso unglaubwürdig, wie sein Untergang nicht
notwendig dünkt.
Mar Reinhardt, der im Lauf der Jahre einen ganzen
Shakespeare-Ayklus herausbrachte, machte sich in diesen:
Winter zum erstenmal an des Dichters für die Bühnen-
wiedergabe schwierigstes Werk, an sein gedankentiefes
Altersmärchen, über dessen Jnhaltsbedeutung sich die
wenigsten ganz klar sind, den „Sturm". Dieses Drama
ist in Deutschland immer nur in großen Aeitabständen
auf der Bühne erschienen, und ich glaube, es wird sich
auch diesmal nicht halten. Für Halbwegs anspruchsvolle
Hörer und Anschauer — nennen wir anspruchsvoll jene,
die darauf halten, daß die Wiedergabe dem Geist eines
Werkes gerecht werden müsse — war die Aufführung bei
Reinhardt vollends unzulänglich, so laut der Beifall
der Menge im großen Volksschauspielhaus am Bülow-
platz — das Reinhardt als drittes Theater seit diesen
Winter mitleitet — wahrscheinlich aus Respekt vor den
verblüffenden Maschinenkünsten, auch tobte. Für einen
Halbwegs kunstverständigen Hörer war die Aufführung
eine so plumpe schauspielerische Vergröberung, daß auch
keine Spur der wundersamen Tiefe der Dichtung sich
ans Licht wagte und davon wohl niemand eine Ahnung
bekam, dem sie nicht aus der Lektüre vertraut war. Aus
Mangel an einem geeigneten Darsteller für die Haupt-
gestalt, den Prospero, hatte man Herrn Ludwig Wüllncr,
den Konzertsaal-Deklamator, sich verschrieben, und dieser
schraubte in Tonfall und Gebärde den gedankenvollen
Mystiker, der Aukunftsvisionen hat, wie Faust im zweiten
Teil, aber im Grunde für den Schauspieler eine weit
kompliziertere, weil realere Gestalt ist, auf den Grad
eines pathetischen Landpastors herab, dem man eher
glaubte, er könne ein tüchtiger Imker oder Botaniker-
sein, als die Geister des Himmels und der Erde mit
seinem Aauberstab regieren. Und da liegt das Schwierige,
daran eine Aufführung immer wieder scheitern wird:
sie verlangt nicht einen, nein, ein Ensemble genialer
Schauspieler. Ich sagte, Prospero sei für die Darstellung
eine kompliziertere, weil realere Erscheinung als Faust:
diese Bestimmung kennzeichnet den Unterschied der bei-
den Dichtungen durchweg. Faust ist ein philosophisches
Gedicht, in den: jeder Gedanke ausgeprägt ist wie eine
Münze und so für jeden greifbar auch aus dem Munde
eines weniger guten Schauspielers. Anders im „Sturm".
Hier verwandelt sich ein realer Vorgang in eine traum-
hafte Doppelbedeutung: wir erleben gewissermaßen den
geistigen Werdeprozeß der Natur und des Lebens, über
den Goethe philosophiert, und wenn der Darsteller
dieses Geistige, das als Musik das innerste Sein der
Dinge klingen macht, nicht bis in die kleinste Rolle belebt,
so bleiben Worte, deren Realität in einer toten märchen-
haften Einkleidung erstarren, und deren Sinn dann nicht
mehr zu uns spricht wie die ausgemünzten bei Goethe.
Nirgends tritt der Unterschied der beiden Dichter klarer
zutage als hier.
Wie im vergangenen Winter, so hatten wir auch
diesmal bei Reinhardt einen großen Schiller-Abend:
damals die Wallenstein-Trilogie, diesmal die als Dich-
tung weniger bedeutende Maria Stuart. Lag an jenen:
Wallenstein-Abend der hinreißende Genuß ganz im
Wesen der Dichtung, so war er nun mehr schauspielerischer
Natur; doch, und darin liegt das Bedeutungsvolle, in
einer wenn auch vorläufig nur erst ferne geistesverwandten
Weise. Ein neuer Typus Schauspieler kommt herauf
— jedenfalls ist das Verlangen nach ihn: da —, muß
heraufkommen. Es besteht bin geheimnisvoller Zu-
sammenhang auf allen Gebieten der Künste hinsichtlich
der Stoffwahl, der Konzeptionsform, ihres Äußerungs-
stiles und der seelischen und geistigen Sehnsucht der Zeit.
Wie nut Ibsen einst ein neuer Schauspieler notwendig
war, den wir, wie die Dichtung jenes, als Offenbarung
begrüßten, während uns heute beide in ihren Grund-
zügen veraltet scheinen, sind wir nun mit den: Rück-
verlangen nach den: Stile unserer großen nationalen
Dichtung auch auf der Suche nach dem neuen Schau-
spieler. Er wird manches mit den: verschollenen Typus
der vorvorigen Generation gemein haben, wenn ihm
auch nicht in jeden: Auge gleichen. Naturalisten, gleich
denen der letzten Epoche, hat es zudem von jeher auf
der Bühne gegeben; aber man hielt sie mit Recht, wie in
allen Künsten, wertvoller für die beigeordneten Figuren
als für die vorbildlichen Typen. ,Jn den letzten zwanzig
Jahren dachte man umgekehrt. Der Naturalist rückte
an die erste Stelle, so daß von Jahr zu Jahr sichtbarer
der „mittellose" Bühnenkünstler in: Vordergrund stand
und zu jeder Situation ohne Stimme und Figur möglich
wurde. Noch vor fünfzehn Jahren äußerte einer der
Dramaturgen des Otto Brahm: „Wir haben für eine
Eysoldt keine Verwendung; wir können doch keine Schau-
spielerin nur für,Salon:s^ engagieren". Dann wurde
diese Schauspielerin reißend Mode und wirkte sogar,
leider, schulebildend. Nun ist nach knapp einem Jahr-
zehnt des Triumphes der Umschwung da. War die
bewegte Aeit des Naturalismus in Bühnen- und Schau-
spielkunst an den Namen Brahm gebunden, so wird die
neue Epoche sich wiederum an den Namen Reinhardt
knüpfen. Längst schon war er der Nachfolger und Anti-
pode Brahms, doch mehr nur in: Dekorativen, dessen
Reformator er wurde. Der Schauspieler trat zurück,
218
fällt sie, wie die meisten, all irgendeiner Stelle gegen den
Schluß hin ab. Wie stets, wenn man eine Dichtung
Hauptmanns neben der eines großen Vorgängers sieht,
empfindet man seine mangelnde Fähigkeit, aus dem
Stoff den Kern zu schälen und frei daraus zu gestalten.
Dabei sitzt in diesem Stoff wirklich ein bemerkenswerter
Kern, und er ist auch einen Augenblick sichtbar ge-
macht: als wir im zweiten Akt den als echten Künstler
ausgegebenen Crampton im Gegenüber mit seinen
Kollegen von der Akademie und dem Pedell in Erwar-
tung des Großhcrzogs — seines vermeintlichen Mäzens —
sehen, glauben wir den Ansatz vor uns zur Abwicklung
der gesellschaftlichen Tragödie des modernen Künstlers
im Kampf^mit Dummheit und Gemeinheit. Doch es
bleibt bei der Einzelbeobachtung eines äußeren Vorgangs,
den der Dichter vielleicht als junger Mensch, da er sich
als Bildhauer an der Breslauer Akademie versuchte,
tief erlebte; aber was danach kommt, ist nicht die sich
steigernde Katastrophe des Problems, sondern weiter
nichts als fernere Einzelbeobachtung eines an sich belang-
losen Schicksals, dem wir keine Anteilnahme entgegen-
zubringen vermögen: wir sehen von Akt zu Akt einen
unappetitlicheren Trinker, dessen schließliche Rettung
uns ebenso unglaubwürdig, wie sein Untergang nicht
notwendig dünkt.
Mar Reinhardt, der im Lauf der Jahre einen ganzen
Shakespeare-Ayklus herausbrachte, machte sich in diesen:
Winter zum erstenmal an des Dichters für die Bühnen-
wiedergabe schwierigstes Werk, an sein gedankentiefes
Altersmärchen, über dessen Jnhaltsbedeutung sich die
wenigsten ganz klar sind, den „Sturm". Dieses Drama
ist in Deutschland immer nur in großen Aeitabständen
auf der Bühne erschienen, und ich glaube, es wird sich
auch diesmal nicht halten. Für Halbwegs anspruchsvolle
Hörer und Anschauer — nennen wir anspruchsvoll jene,
die darauf halten, daß die Wiedergabe dem Geist eines
Werkes gerecht werden müsse — war die Aufführung bei
Reinhardt vollends unzulänglich, so laut der Beifall
der Menge im großen Volksschauspielhaus am Bülow-
platz — das Reinhardt als drittes Theater seit diesen
Winter mitleitet — wahrscheinlich aus Respekt vor den
verblüffenden Maschinenkünsten, auch tobte. Für einen
Halbwegs kunstverständigen Hörer war die Aufführung
eine so plumpe schauspielerische Vergröberung, daß auch
keine Spur der wundersamen Tiefe der Dichtung sich
ans Licht wagte und davon wohl niemand eine Ahnung
bekam, dem sie nicht aus der Lektüre vertraut war. Aus
Mangel an einem geeigneten Darsteller für die Haupt-
gestalt, den Prospero, hatte man Herrn Ludwig Wüllncr,
den Konzertsaal-Deklamator, sich verschrieben, und dieser
schraubte in Tonfall und Gebärde den gedankenvollen
Mystiker, der Aukunftsvisionen hat, wie Faust im zweiten
Teil, aber im Grunde für den Schauspieler eine weit
kompliziertere, weil realere Gestalt ist, auf den Grad
eines pathetischen Landpastors herab, dem man eher
glaubte, er könne ein tüchtiger Imker oder Botaniker-
sein, als die Geister des Himmels und der Erde mit
seinem Aauberstab regieren. Und da liegt das Schwierige,
daran eine Aufführung immer wieder scheitern wird:
sie verlangt nicht einen, nein, ein Ensemble genialer
Schauspieler. Ich sagte, Prospero sei für die Darstellung
eine kompliziertere, weil realere Erscheinung als Faust:
diese Bestimmung kennzeichnet den Unterschied der bei-
den Dichtungen durchweg. Faust ist ein philosophisches
Gedicht, in den: jeder Gedanke ausgeprägt ist wie eine
Münze und so für jeden greifbar auch aus dem Munde
eines weniger guten Schauspielers. Anders im „Sturm".
Hier verwandelt sich ein realer Vorgang in eine traum-
hafte Doppelbedeutung: wir erleben gewissermaßen den
geistigen Werdeprozeß der Natur und des Lebens, über
den Goethe philosophiert, und wenn der Darsteller
dieses Geistige, das als Musik das innerste Sein der
Dinge klingen macht, nicht bis in die kleinste Rolle belebt,
so bleiben Worte, deren Realität in einer toten märchen-
haften Einkleidung erstarren, und deren Sinn dann nicht
mehr zu uns spricht wie die ausgemünzten bei Goethe.
Nirgends tritt der Unterschied der beiden Dichter klarer
zutage als hier.
Wie im vergangenen Winter, so hatten wir auch
diesmal bei Reinhardt einen großen Schiller-Abend:
damals die Wallenstein-Trilogie, diesmal die als Dich-
tung weniger bedeutende Maria Stuart. Lag an jenen:
Wallenstein-Abend der hinreißende Genuß ganz im
Wesen der Dichtung, so war er nun mehr schauspielerischer
Natur; doch, und darin liegt das Bedeutungsvolle, in
einer wenn auch vorläufig nur erst ferne geistesverwandten
Weise. Ein neuer Typus Schauspieler kommt herauf
— jedenfalls ist das Verlangen nach ihn: da —, muß
heraufkommen. Es besteht bin geheimnisvoller Zu-
sammenhang auf allen Gebieten der Künste hinsichtlich
der Stoffwahl, der Konzeptionsform, ihres Äußerungs-
stiles und der seelischen und geistigen Sehnsucht der Zeit.
Wie nut Ibsen einst ein neuer Schauspieler notwendig
war, den wir, wie die Dichtung jenes, als Offenbarung
begrüßten, während uns heute beide in ihren Grund-
zügen veraltet scheinen, sind wir nun mit den: Rück-
verlangen nach den: Stile unserer großen nationalen
Dichtung auch auf der Suche nach dem neuen Schau-
spieler. Er wird manches mit den: verschollenen Typus
der vorvorigen Generation gemein haben, wenn ihm
auch nicht in jeden: Auge gleichen. Naturalisten, gleich
denen der letzten Epoche, hat es zudem von jeher auf
der Bühne gegeben; aber man hielt sie mit Recht, wie in
allen Künsten, wertvoller für die beigeordneten Figuren
als für die vorbildlichen Typen. ,Jn den letzten zwanzig
Jahren dachte man umgekehrt. Der Naturalist rückte
an die erste Stelle, so daß von Jahr zu Jahr sichtbarer
der „mittellose" Bühnenkünstler in: Vordergrund stand
und zu jeder Situation ohne Stimme und Figur möglich
wurde. Noch vor fünfzehn Jahren äußerte einer der
Dramaturgen des Otto Brahm: „Wir haben für eine
Eysoldt keine Verwendung; wir können doch keine Schau-
spielerin nur für,Salon:s^ engagieren". Dann wurde
diese Schauspielerin reißend Mode und wirkte sogar,
leider, schulebildend. Nun ist nach knapp einem Jahr-
zehnt des Triumphes der Umschwung da. War die
bewegte Aeit des Naturalismus in Bühnen- und Schau-
spielkunst an den Namen Brahm gebunden, so wird die
neue Epoche sich wiederum an den Namen Reinhardt
knüpfen. Längst schon war er der Nachfolger und Anti-
pode Brahms, doch mehr nur in: Dekorativen, dessen
Reformator er wurde. Der Schauspieler trat zurück,
218