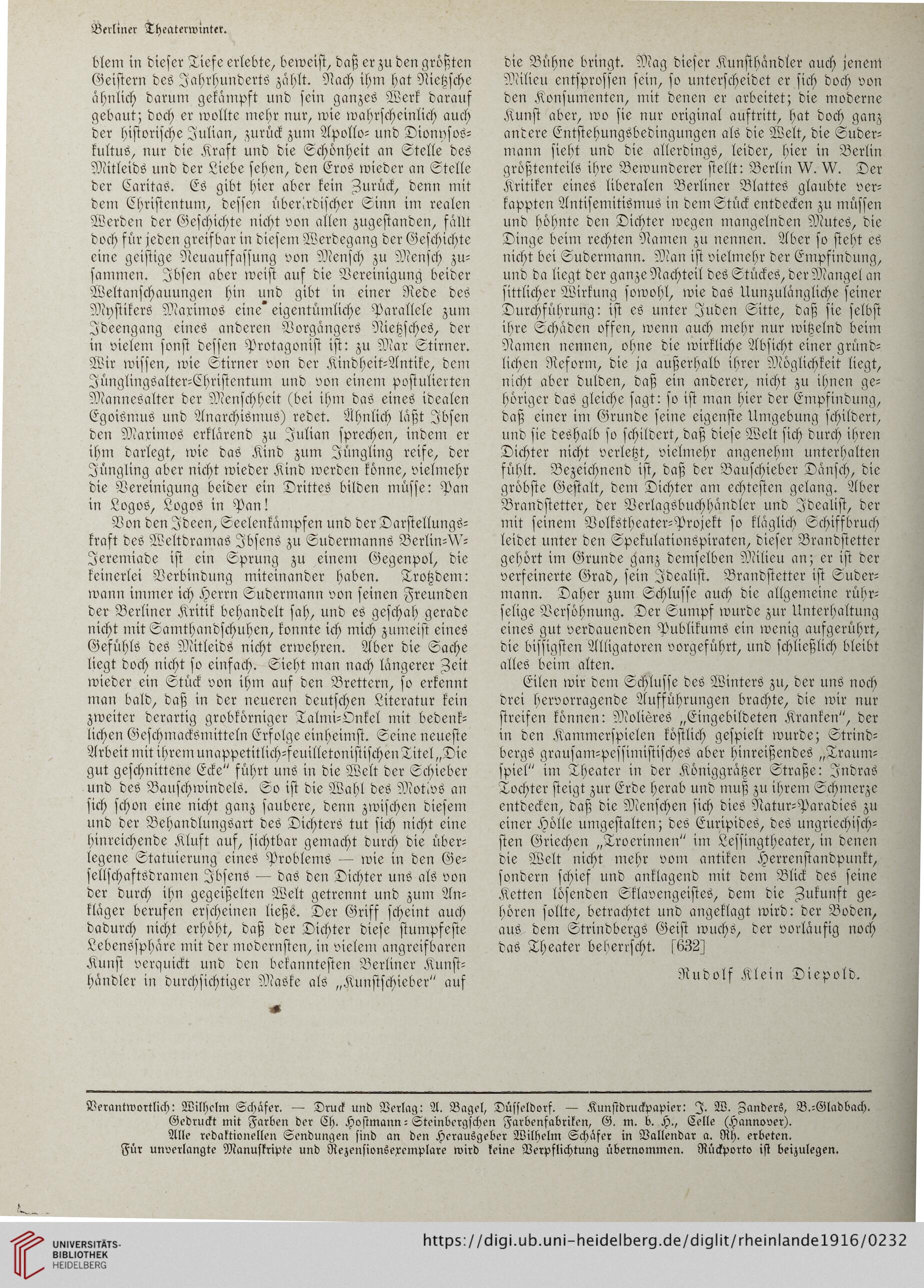Berliner Theaterwinter.
blem in dieser Tiefe erlebte, beweist, daß er zu den größten
Geistern des Jahrhunderts zahlt. Nach ihm hat Nietzsche
ähnlich darum gekämpft und sein ganzes Werk darauf
gebaut; doch er wollte mehr nur, wie wahrscheinlich auch
der historische Julian, zurück zum Apollo- und Dionysos-
kultus, nur die Kraft und die Schönheit an Stelle des
Mitleids und der Liebe sehen, den Eros wieder an Stelle
der Caritas. Es gibt hier aber kein Zurück, denn mit
dem Christentum, dessen überirdischer Sinn im realen
Werden der Geschichte nicht von allen zugestanden, fällt
doch für jeden greifbar in diesem Werdegang der Geschichte
eine geistige Neuauffassung von Mensch zu Mensch zu-
sammen. Ibsen aber weist auf die Vereinigung beider
Weltanschauungen hin und gibt in einer Rede des
Mystikers Marimos eine' eigentümliche Parallele zum
Jdeengang eines anderen Vorgängers Nietzsches, der
in vielem sonst dessen Protagonist ist: zu Mar Stirner.
Wir wissen, wie Stirner von der Kindheit-Antike, den:
Jünglingsalter-Christentum und von einem postulierten
Mannesalter der Menschheit (bei ihn: das eines idealen
Egoismus und Anarchismus) redet. Ähnlich läßt Ibsen
den Marimos erklärend zu Julian sprechen, indem er
ihn: darlegt, wie das Kind zum Jüngling reife, der
Jüngling aber nicht wieder Kind werden könne, vielmehr
die Vereinigung beider ein Drittes bilden müsse: Pan
in Logos, Logos in Pan!
Von den Ideen, Seelenkämpfen und der Darstellungs-
kraft des Wettdramas Ibsens zu Sudermanns Berliu-LL-
Jeremiade ist ein Sprung zu einem Gegenpol, die
keinerlei Verbindung miteinander haben. Trotzdem:
wann immer ich Herrn Sudermann von seinen Freunden
der Berliner Kritik behandelt sah, und es geschah gerade
nicht mit Samthandschuhen, konnte ich mich zumeist eines
Gefühls des Mitleids nicht erwehren. Aber die Sache
liegt doch nicht so einfach. Sieht man nach längerer Zeit
wieder ein Stück von ihm auf den Breitern, so erkennt
man bald, daß in der neueren deutschen Literatur kein
zweiter derartig grobkörniger Talmi-Onkel mit bedenk-
lichen Geschmacksmitteln Erfolge einheimst. Seine neueste
Arbeit nut ihrem unappetitlich-feuilletonistischen Titel „Die
gut geschnittene Ecke" führt uns in die Welt der Schieber
und des Bauschwindels. So ist die Wahl des Motivs an
sich schon eine nicht ganz saubere, denn zwischen diesem
und der Behandlungsart des Dichters tut sich nicht eine
hinreichende Kluft auf, sichtbar gemacht durch die über-
legene Statuierung eines Problems — wie in den Ge-
sellschaftsdramen Ibsens — das den Dichter uns als von
der durch ihn gegeißelten Welt getrennt und zum An-
kläger berufen erscheinen ließe. Der Griff scheint auch
dadurch nicht erhöht, daß der Dichter diese stumpfeste
Lebenssphäre nut der modernsten, in vielen: angreifbaren
Kunst verquickt und den bekanntesten Berliner Kunst-
händler in durchsichtiger Maske als „Kunstschieber" auf
die Bühne bringt. Mag dieser Kunsthändler auch jenem
Milieu entsprossen sein, so unterscheidet er sich doch von
den Konsumenten, mit denen er arbeitet; die moderne
Kunst aber, wo sie nur original auftritt, hat doch ganz
andere Entstehungsbedingungen als die Welt, die Suder-
mann sieht und die allerdings, leider, hier in Berlin
größtenteils ihre Bewunderer stellt: Berlin LL. VL. Der
Kritiker eines liberalen Berliner Blattes glaubte ver-
kappten Antisemitismus in dem Stück entdecken zu müssen
und höhnte den Dichter wegen mangelnden Mutes, die
Dinge beim rechten Namen zu nennen. Aber so steht es
nicht bei Sudermann. Man ist vielmehr der Empfindung,
und da liegt der ganze Nachteil des Stückes, der Mangel an
sittlicher Wirkung sowohl, wie das Uunzulängliche seiner
Durchführung: ist es unter Juden Sitte, daß sie selbst
ihre Schäden offen, wenn auch mehr nur witzelnd beim
Namen nennen, ohne die wirkliche Absicht einer gründ-
lichen Reform, die ja außerhalb ihrer Möglichkeit liegt,
nicht aber dulden, daß ein anderer, nicht zu ihnen ge-
höriger das gleiche sagt: so ist inan hier der Empfindung,
daß einer in: Grunde seine eigenste Umgebung schildert,
und sie deshalb so schildert, daß diese Welt sich durch ihren
Dichter nicht verletzt, vielmehr angenehm unterhalten
fühlt. Bezeichnend ist, daß der Bauschieber Dänsch, die
gröbste Gestalt, den: Dichter an: echtesten gelang. Aber
Brandstetter, der Verlagsbuchhändler und Idealist, der
mit seinen: Volkstheater-Projekt so kläglich Schiffbruch
leidet unter den Spekulationspiraten, dieser Brandstetter
gehört in: Grunde ganz demselben Milieu an; er ist der
verfeinerte Grad, sein Idealist. Brandstetter ist Suder-
mann. Daher zum Schlüsse auch die allgemeine rühr-
selige Versöhnung. Der Sumpf wurde zur Unterhaltung
eines gut verdauenden Publikums ein wenig aufgerührt,
die bissigsten Alligatoren vorgeführt, und schließlich bleibt
alles beim alten.
Eilen wir dem Schlüsse des Winters zu, der uns noch
drei hervorragende Aufführungen brachte, die wir nur
streifen können: Molieres „Eingebildeten Kranken", der
in den Kaiumerspielen köstlich gespielt wurde; Strind-
bergs grausam-pessimistisches aber hinreißendes „Traum-
spiel" im Theater in der Königgrätzer Straße: Indras
Tochter steigt zur Erde herab und muß zu ihrem Schmerze
entdecken, daß die Menschen sich dies Natur-Paradies zu
einer Hölle umgestalten; des Euripides, des ungriechisch-
sten Griechen „Troerinnen" im Lessingtheater, in denen
die Wett nicht mehr vom antiken Herrenstandpunkt,
sondern schief und anklagend mit dem Blick des seine
Ketten lösenden Sklavengeistes, dem die Zukunft ge-
hören sollte, betrachtet und angeklagt wird: der Boden,
aus dem Strindbergs Geist wuchs, der vorläufig noch
das Theater beherrscht. s632ss
Rudolf Klein Diepold.
Verantwortlich: Wilhelm Scbäfer. — Druck und Verlag: A. Bagel, Düsseldorf. — Kunstdruckpapier: I. W. Zanders, B.-Gladbach.
Gedruckt mit Farben der CH. Hostmann - Steinbcrgschen Farbenfabriken, G. m. b. H., Celle (Hannover).
Alle redaktionellen Sendungen sind an den Herausgeber Wilhelm Schäfer in Vallendar a. Rh. erbeten.
Für unverlangte Manuskripte und Rezensionsexemplare wird keine Verpflichtung übernommen. Rückporto ist beizulegen.
blem in dieser Tiefe erlebte, beweist, daß er zu den größten
Geistern des Jahrhunderts zahlt. Nach ihm hat Nietzsche
ähnlich darum gekämpft und sein ganzes Werk darauf
gebaut; doch er wollte mehr nur, wie wahrscheinlich auch
der historische Julian, zurück zum Apollo- und Dionysos-
kultus, nur die Kraft und die Schönheit an Stelle des
Mitleids und der Liebe sehen, den Eros wieder an Stelle
der Caritas. Es gibt hier aber kein Zurück, denn mit
dem Christentum, dessen überirdischer Sinn im realen
Werden der Geschichte nicht von allen zugestanden, fällt
doch für jeden greifbar in diesem Werdegang der Geschichte
eine geistige Neuauffassung von Mensch zu Mensch zu-
sammen. Ibsen aber weist auf die Vereinigung beider
Weltanschauungen hin und gibt in einer Rede des
Mystikers Marimos eine' eigentümliche Parallele zum
Jdeengang eines anderen Vorgängers Nietzsches, der
in vielem sonst dessen Protagonist ist: zu Mar Stirner.
Wir wissen, wie Stirner von der Kindheit-Antike, den:
Jünglingsalter-Christentum und von einem postulierten
Mannesalter der Menschheit (bei ihn: das eines idealen
Egoismus und Anarchismus) redet. Ähnlich läßt Ibsen
den Marimos erklärend zu Julian sprechen, indem er
ihn: darlegt, wie das Kind zum Jüngling reife, der
Jüngling aber nicht wieder Kind werden könne, vielmehr
die Vereinigung beider ein Drittes bilden müsse: Pan
in Logos, Logos in Pan!
Von den Ideen, Seelenkämpfen und der Darstellungs-
kraft des Wettdramas Ibsens zu Sudermanns Berliu-LL-
Jeremiade ist ein Sprung zu einem Gegenpol, die
keinerlei Verbindung miteinander haben. Trotzdem:
wann immer ich Herrn Sudermann von seinen Freunden
der Berliner Kritik behandelt sah, und es geschah gerade
nicht mit Samthandschuhen, konnte ich mich zumeist eines
Gefühls des Mitleids nicht erwehren. Aber die Sache
liegt doch nicht so einfach. Sieht man nach längerer Zeit
wieder ein Stück von ihm auf den Breitern, so erkennt
man bald, daß in der neueren deutschen Literatur kein
zweiter derartig grobkörniger Talmi-Onkel mit bedenk-
lichen Geschmacksmitteln Erfolge einheimst. Seine neueste
Arbeit nut ihrem unappetitlich-feuilletonistischen Titel „Die
gut geschnittene Ecke" führt uns in die Welt der Schieber
und des Bauschwindels. So ist die Wahl des Motivs an
sich schon eine nicht ganz saubere, denn zwischen diesem
und der Behandlungsart des Dichters tut sich nicht eine
hinreichende Kluft auf, sichtbar gemacht durch die über-
legene Statuierung eines Problems — wie in den Ge-
sellschaftsdramen Ibsens — das den Dichter uns als von
der durch ihn gegeißelten Welt getrennt und zum An-
kläger berufen erscheinen ließe. Der Griff scheint auch
dadurch nicht erhöht, daß der Dichter diese stumpfeste
Lebenssphäre nut der modernsten, in vielen: angreifbaren
Kunst verquickt und den bekanntesten Berliner Kunst-
händler in durchsichtiger Maske als „Kunstschieber" auf
die Bühne bringt. Mag dieser Kunsthändler auch jenem
Milieu entsprossen sein, so unterscheidet er sich doch von
den Konsumenten, mit denen er arbeitet; die moderne
Kunst aber, wo sie nur original auftritt, hat doch ganz
andere Entstehungsbedingungen als die Welt, die Suder-
mann sieht und die allerdings, leider, hier in Berlin
größtenteils ihre Bewunderer stellt: Berlin LL. VL. Der
Kritiker eines liberalen Berliner Blattes glaubte ver-
kappten Antisemitismus in dem Stück entdecken zu müssen
und höhnte den Dichter wegen mangelnden Mutes, die
Dinge beim rechten Namen zu nennen. Aber so steht es
nicht bei Sudermann. Man ist vielmehr der Empfindung,
und da liegt der ganze Nachteil des Stückes, der Mangel an
sittlicher Wirkung sowohl, wie das Uunzulängliche seiner
Durchführung: ist es unter Juden Sitte, daß sie selbst
ihre Schäden offen, wenn auch mehr nur witzelnd beim
Namen nennen, ohne die wirkliche Absicht einer gründ-
lichen Reform, die ja außerhalb ihrer Möglichkeit liegt,
nicht aber dulden, daß ein anderer, nicht zu ihnen ge-
höriger das gleiche sagt: so ist inan hier der Empfindung,
daß einer in: Grunde seine eigenste Umgebung schildert,
und sie deshalb so schildert, daß diese Welt sich durch ihren
Dichter nicht verletzt, vielmehr angenehm unterhalten
fühlt. Bezeichnend ist, daß der Bauschieber Dänsch, die
gröbste Gestalt, den: Dichter an: echtesten gelang. Aber
Brandstetter, der Verlagsbuchhändler und Idealist, der
mit seinen: Volkstheater-Projekt so kläglich Schiffbruch
leidet unter den Spekulationspiraten, dieser Brandstetter
gehört in: Grunde ganz demselben Milieu an; er ist der
verfeinerte Grad, sein Idealist. Brandstetter ist Suder-
mann. Daher zum Schlüsse auch die allgemeine rühr-
selige Versöhnung. Der Sumpf wurde zur Unterhaltung
eines gut verdauenden Publikums ein wenig aufgerührt,
die bissigsten Alligatoren vorgeführt, und schließlich bleibt
alles beim alten.
Eilen wir dem Schlüsse des Winters zu, der uns noch
drei hervorragende Aufführungen brachte, die wir nur
streifen können: Molieres „Eingebildeten Kranken", der
in den Kaiumerspielen köstlich gespielt wurde; Strind-
bergs grausam-pessimistisches aber hinreißendes „Traum-
spiel" im Theater in der Königgrätzer Straße: Indras
Tochter steigt zur Erde herab und muß zu ihrem Schmerze
entdecken, daß die Menschen sich dies Natur-Paradies zu
einer Hölle umgestalten; des Euripides, des ungriechisch-
sten Griechen „Troerinnen" im Lessingtheater, in denen
die Wett nicht mehr vom antiken Herrenstandpunkt,
sondern schief und anklagend mit dem Blick des seine
Ketten lösenden Sklavengeistes, dem die Zukunft ge-
hören sollte, betrachtet und angeklagt wird: der Boden,
aus dem Strindbergs Geist wuchs, der vorläufig noch
das Theater beherrscht. s632ss
Rudolf Klein Diepold.
Verantwortlich: Wilhelm Scbäfer. — Druck und Verlag: A. Bagel, Düsseldorf. — Kunstdruckpapier: I. W. Zanders, B.-Gladbach.
Gedruckt mit Farben der CH. Hostmann - Steinbcrgschen Farbenfabriken, G. m. b. H., Celle (Hannover).
Alle redaktionellen Sendungen sind an den Herausgeber Wilhelm Schäfer in Vallendar a. Rh. erbeten.
Für unverlangte Manuskripte und Rezensionsexemplare wird keine Verpflichtung übernommen. Rückporto ist beizulegen.