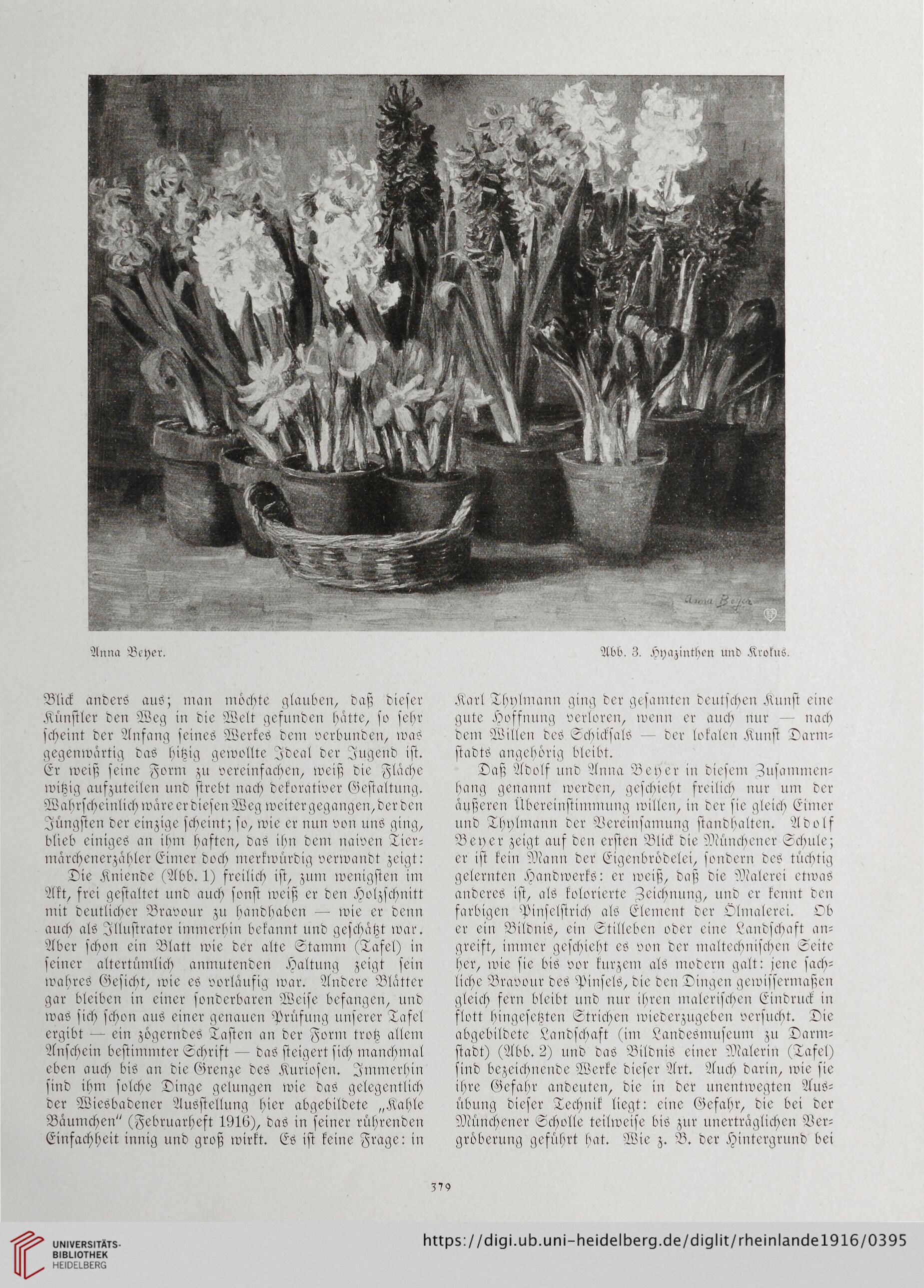Anna Beyer.
Abb. 3. Hyazinthen und Krokus.
Bück anders aus; man möchte glauben, daß dieser
Künstler den Weg in die Welt gefunden hatte, so sehr
scheint der Anfang seines Werkes dem verbunden, was
gegenwärtig das hitzig gewollte Ideal der Jugend ist.
Er weiß seine Form zu vereinfachen, weiß die Flache
witzig aufzuteilen und strebt nach dekorativer Gestaltung.
Wahrscheinlich wäre er diesen Weg weiter gegangen, der den
Jüngsten der einzige scheint; so, wie er nun von uns ging,
blieb einiges an ihm haften, das ihn dem naiven Tier-
märchenerzähler Eimer doch merkwürdig verwandt zeigt:
Die Kniende (Abb. 1) freilich ist, zum wenigsten im
Akt, frei gestaltet und auch sonst weiß er den Holzschnitt
mit deutlicher Bravour zu handhaben — wie er denn
auch als Illustrator immerhin bekannt und geschätzt war.
Aber schon ein Blatt wie der alte Stamm (Tafel) in
seiner altertümlich anmutenden Haltung zeigt sein
wahres Gesicht, wie es vorläufig war. Andere Blätter
gar bleiben in einer sonderbaren Weise befangen, und
was sich schon aus einer genauen Prüfung unserer Tafel
ergibt — ein zögerndes Tasten an der Form trotz allem
Anschein bestimmter Schrift — das steigert sich manchmal
eben auch bis an die Grenze des Kuriosen. Immerhin
sind ihm solche Dinge gelungen wie das gelegentlich
der Wiesbadener Ausstellung hier abgebildete „Kahle
Bäumchen" (Februarheft 1916), das in seiner rührenden
Einfachheit innig und groß wirkt. Es ist keine Frage: in
Karl Thylmann ging der gesamten deutschen Kunst eine
gute Hoffnung verloren, wenn er auch nur — nach
dem Willen des Schicksals — der lokalen Kunst Darm-
stadts angehörig bleibt.
Daß Adolf und Anna Beyer in diesem Zusammen-
hang genannt werden, geschieht freilich nur um der
äußeren Übereinstimmung willen, in der sie gleich Eimer
und Thylmann der Vereinsamung standhalten. Adolf
Beyer zeigt auf den ersten Blick die Münchener Schule;
er ist kein Mann der Eigenbrötelei, sondern des tüchtig
gelernten Handwerks: er weiß, daß die Malerei etwas
anderes ist, als kolorierte Aeichnung, und er kennt den
farbigen Pinselstrich als Element der Ölmalerei. Ob
er ein Bildnis, ein Stilleben oder eine Landschaft an-
greift, immer geschieht es von der maltechnischen Seite
her, wie sie bis vor kurzem als modern galt: jene sach-
liche Bravour des Pinsels, die den Dingen gewissermaßen
gleich fern bleibt und nur ihren malerischen Eindruck in
flott hingesetzten Strichen wiederzugeben versucht. Die
abgebildete Landschaft (im Landesmuseum zu Darm-
stadt) (Abb. 2) und das Bildnis einer Malerin (Tafel)
sind bezeichnende Werke dieser Art. Auch darin, wie sie
ihre Gefahr andeuten, die in der unentwegten Aus-
übung dieser Technik liegt: eine Gefahr, die bei der
Münchener Scholle teilweise bis zur unerträglichen Ver-
gröberung geführt hat. Wie z. B. der Hintergrund bei