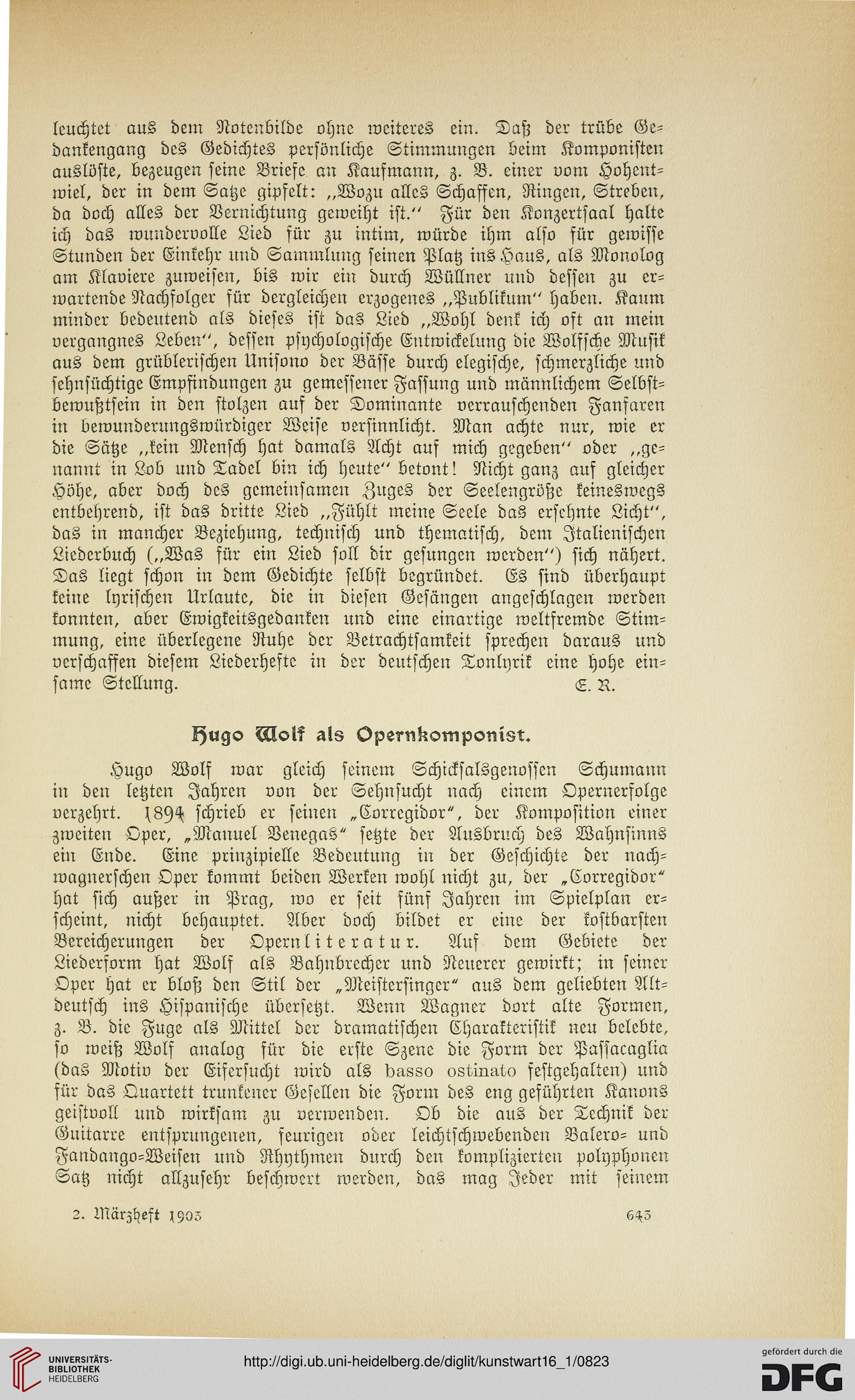leuchtet aus dem Notenbilde ohne weiteres ein. Daß der trübe Ge-
dankengang des Gedichtes persönliche Stimmungen üeim Komponisten
auslöste, bezeugen seine Briese an Kaufmann, z. B. einer oom Hohent-
wiel, der in dem Satze gipfelt: „Wozu alles Schaffen, Ringen, Streben,
da doch alles der Vernichtung geweiht ist." Für den Konzertsaal halte
ich das wundervolle Lied sür zu intim, würde ihm also sür gewisse
Stunden der Einkehr und Sammlung seinen Platz ins Haus, als Monolog
am Klaviere zuweisen, bis wir ein durch Wüllner und dessen zu er-
wartende Nachfolger sür dergleichen erzogenes „Publikum" haben. Kaum
minder bedeutend als dieses ist das Lied „Wohl denk ich oft an mein
oergangnes Leben", dessen psychologische Entwickelung die Wolfsche Musik
aus dem grüblerischen Unisono der Bässe durch elegische, schmerzliche und
sehnsüchtige Empfindungen zu gemessener Fassung und männlichem Selbst-
bewußtsein in den stolzen auf der Dominante verrauschenden Fansaren
in bewunderungswürdiger Weise oersinnlicht. Man achte nur, wie er
die Sätze „kein Mensch hat damals Acht auf mich gegeben" oder „ge-
nannt in Lob und Tadel bin ich heute" betont! Nicht ganz auf gleicher
Höhe, aber doch des gemeinsamen Zuges der Seelengröße keineswegs
entbehrend, ist das dritte Lied „Fühlt meine Seele das ersehnte Licht",
das in mancher Beziehung, technisch und thematisch, dem Jtalienischen
Liederbuch („Was für ein Lied foll dir gesungen werden") fich nähert.
Das liegt schon in dem Gedichte selbst begründet. Es sind überhaupt
keine lyrischen Urlaute, die in diesen Gesängen angeschlagen werden
konnten, aber Ewigkeitsgedanken und eine einartige weltfremde Stim-
mung, eine überlegene Ruhe der Betrachtsamkeit sprechen daraus und
verschaffen diesem Liederhefte in der deutschen Tonlprik eine hohe ein-
same Stellung. S. R.
?)ugO Molk als Opsrnkornponisr.
Hugo Wolf war gleich seinem Schicksalsgenosfen Schumann
in den letzten Jahren von der Sehnsucht nach einem Opernerfolge
verzehrt. (89^ schrieb er seinen „Corregidor", der Komposition einer
zweiten Oper, „Manuel Venegas" setzte der Ausbruch des Wahnsinns
ein Ende. Eine prinzipielle Bedeutung in der Geschichte der nach-
wagnerschen Oper kommt beiden Werken wohl nicht zu, der „Corregidor"
hat sich außer in Prag, wo er seit fünf Jahren im Spielplan er-
fcheint, nicht behauptet. Aber doch bildet er eine der kostbarsten
Bereicherungen der Opern l i t e r a t u r. Auf dem Gebiete der
Liederform hat Wolf als Bahnbrecher und Neuerer gewirkt; in seiner
Oper hat er bloß den Stil der „Meisterfinger" aus dem geliebten Alt-
deutsch ins Hispanische übersetzt. Wenn Wagner dort alte Formen,
z. B. die Fuge als Mittel der dramatischen Charakteristik neu belebte,
so weiß Wolf analog für die erste Szene die Form der Passacaglia
(das Motiv der Eifersucht wird als ba8so o8tiuato festgehalten) und
für das Quartett trunkener Gesellen die Form des eng geführten Kanons
geistvoll und wirksam zu oerwenden. Ob die aus der Technik der
Guitarre entsprungenen, feurigen oder leichtschrvebenden Balero- und
Fandango-Weisen und Rhythmen durch den komplizierten polyphonen
Satz nicht allzusehr beschwert werden, das mag Jeder mit seinem
2. lNärzheft ttzos
6^5
dankengang des Gedichtes persönliche Stimmungen üeim Komponisten
auslöste, bezeugen seine Briese an Kaufmann, z. B. einer oom Hohent-
wiel, der in dem Satze gipfelt: „Wozu alles Schaffen, Ringen, Streben,
da doch alles der Vernichtung geweiht ist." Für den Konzertsaal halte
ich das wundervolle Lied sür zu intim, würde ihm also sür gewisse
Stunden der Einkehr und Sammlung seinen Platz ins Haus, als Monolog
am Klaviere zuweisen, bis wir ein durch Wüllner und dessen zu er-
wartende Nachfolger sür dergleichen erzogenes „Publikum" haben. Kaum
minder bedeutend als dieses ist das Lied „Wohl denk ich oft an mein
oergangnes Leben", dessen psychologische Entwickelung die Wolfsche Musik
aus dem grüblerischen Unisono der Bässe durch elegische, schmerzliche und
sehnsüchtige Empfindungen zu gemessener Fassung und männlichem Selbst-
bewußtsein in den stolzen auf der Dominante verrauschenden Fansaren
in bewunderungswürdiger Weise oersinnlicht. Man achte nur, wie er
die Sätze „kein Mensch hat damals Acht auf mich gegeben" oder „ge-
nannt in Lob und Tadel bin ich heute" betont! Nicht ganz auf gleicher
Höhe, aber doch des gemeinsamen Zuges der Seelengröße keineswegs
entbehrend, ist das dritte Lied „Fühlt meine Seele das ersehnte Licht",
das in mancher Beziehung, technisch und thematisch, dem Jtalienischen
Liederbuch („Was für ein Lied foll dir gesungen werden") fich nähert.
Das liegt schon in dem Gedichte selbst begründet. Es sind überhaupt
keine lyrischen Urlaute, die in diesen Gesängen angeschlagen werden
konnten, aber Ewigkeitsgedanken und eine einartige weltfremde Stim-
mung, eine überlegene Ruhe der Betrachtsamkeit sprechen daraus und
verschaffen diesem Liederhefte in der deutschen Tonlprik eine hohe ein-
same Stellung. S. R.
?)ugO Molk als Opsrnkornponisr.
Hugo Wolf war gleich seinem Schicksalsgenosfen Schumann
in den letzten Jahren von der Sehnsucht nach einem Opernerfolge
verzehrt. (89^ schrieb er seinen „Corregidor", der Komposition einer
zweiten Oper, „Manuel Venegas" setzte der Ausbruch des Wahnsinns
ein Ende. Eine prinzipielle Bedeutung in der Geschichte der nach-
wagnerschen Oper kommt beiden Werken wohl nicht zu, der „Corregidor"
hat sich außer in Prag, wo er seit fünf Jahren im Spielplan er-
fcheint, nicht behauptet. Aber doch bildet er eine der kostbarsten
Bereicherungen der Opern l i t e r a t u r. Auf dem Gebiete der
Liederform hat Wolf als Bahnbrecher und Neuerer gewirkt; in seiner
Oper hat er bloß den Stil der „Meisterfinger" aus dem geliebten Alt-
deutsch ins Hispanische übersetzt. Wenn Wagner dort alte Formen,
z. B. die Fuge als Mittel der dramatischen Charakteristik neu belebte,
so weiß Wolf analog für die erste Szene die Form der Passacaglia
(das Motiv der Eifersucht wird als ba8so o8tiuato festgehalten) und
für das Quartett trunkener Gesellen die Form des eng geführten Kanons
geistvoll und wirksam zu oerwenden. Ob die aus der Technik der
Guitarre entsprungenen, feurigen oder leichtschrvebenden Balero- und
Fandango-Weisen und Rhythmen durch den komplizierten polyphonen
Satz nicht allzusehr beschwert werden, das mag Jeder mit seinem
2. lNärzheft ttzos
6^5